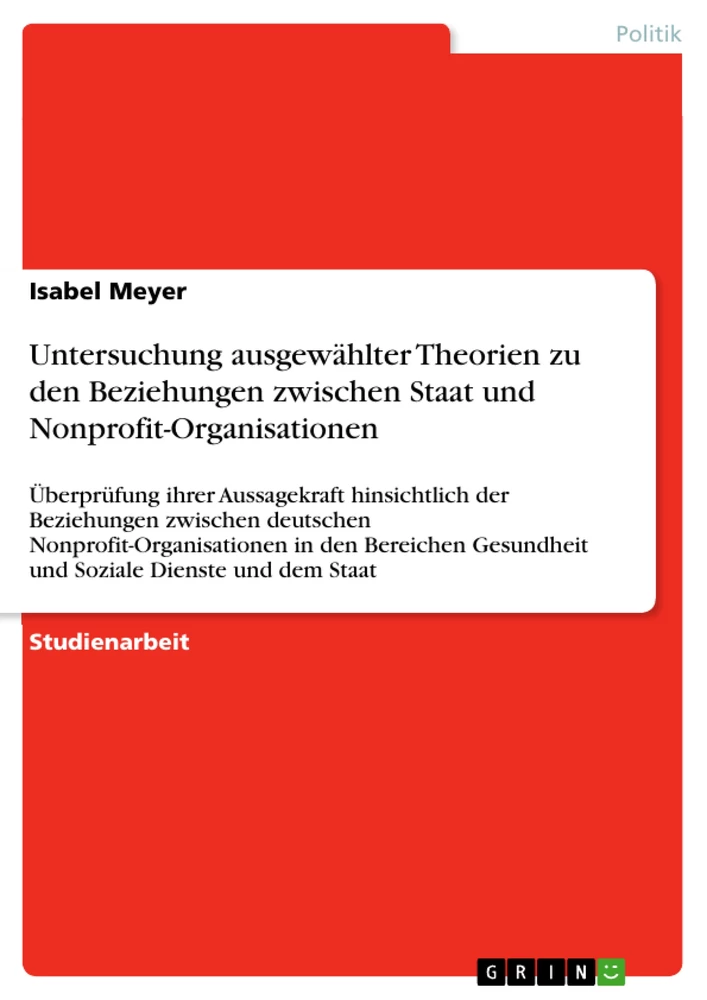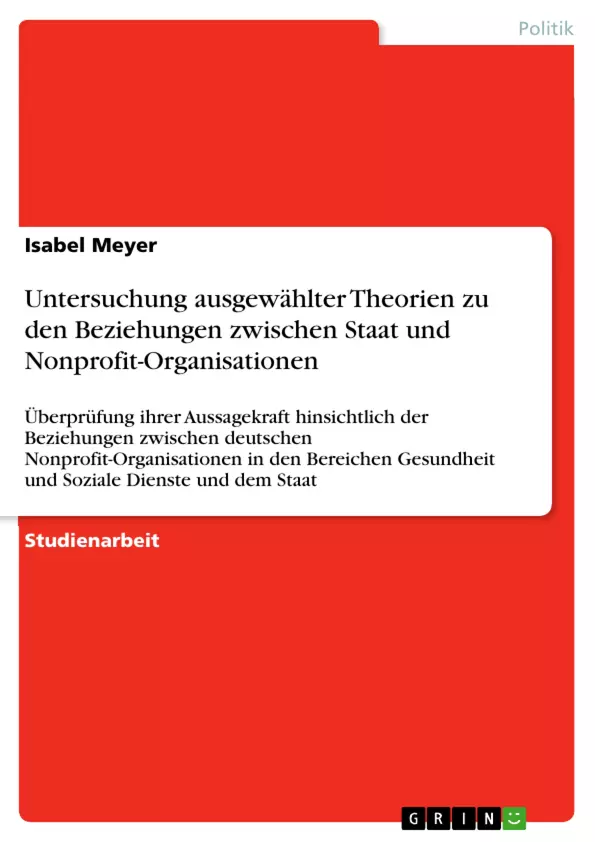In der vorliegenden Hausarbeit sollen die Beziehungen zwischen Staat und Nonprofit-Organisationen, die in den Bereichen Gesundheit und Soziale Dienste tätig sind, untersucht werden. Eine Einschränkung des Themas auf diesen Bereich der Wohlfahrtspflege wird vorgenommen, da die verschiedenen Bereiche des Nonprofit-Sektors für eine einheitliche Betrachtung zu unterschiedlich sind und es generell schwer fällt, von dem „einen“ Nonprofit-Sektor zu sprechen. Finanzierung, Struktur, Personal und andere Merkmale unterscheiden sich in den einzelnen Bereichen wie Gesundheit, Sport und Kultur zu stark, um von einem einheitlichen Sektor sprechen zu können.
Im ersten Teil der Hausarbeit werden drei ausgewählte Theorien untersucht, die die historische Entwicklung der Theorien selbst – von einem Konkurrenzmodell zwischen Staat und Nonprofit-Organisationen über ein Interdependenzmodell der beiden Akteure bis hin zu einer national und historisch differenzierenden Institutionellen Theorie – und ihres Verständnisses der Beziehungen zwischen Staat und Nonprofit-Organisationen veranschaulichen. Diese Theorien beziehen sich nicht spezifisch auf den Bereich der Wohlfahrtspflege, sondern sprechen vom gesamten Nonprofit-Sektor, haben teilweise aber dennoch starken Fokus auf den genannten Bereich. Zu jeder Theorie werden außerdem die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung von Salamon/Anheier herangezogen.
Im zweiten Teil sollen diese Theorien auf ihre Aussagekraft bezüglich des Verhältnisses zwischen den deutschen Nonprofit-Organisationen, welche in den Bereichen Gesundheit und Soziale Dienste tätig sind, und dem deutschen Staat betrachtet werden. Eine Einschränkung auf die Bereiche Gesundheit und Soziale Dienste wird erneut vorgenommen, da es sich hier im Gegensatz zu Bereichen wie Sport und Kultur in Deutschland um sehr staatsnahe und hoch subventionierte Bereiche des Nonprofit-Sektors handelt. Zum Verständnis dieser Beziehungen soll ein historischer Überblick gegeben werden, wie sich das heutige „duale“ System in Deutschland in den Bereichen Gesundheit und Soziale Dienste ausbilden konnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgewählte Theorien zu den Beziehungen zwischen Staat und Nonprofit-Organisationen
- Weisbrods Heterogenitätsthese
- Hauptaussagen der Theorie von Weisbrod
- Empirische Überprüfung der Theorie durch Salamon/Anheier
- Salamons Theorie des „, Third-Party-Government\"\n\"\n
- Hauptaussagen der Theorie von Salamon
- Empirische Überprüfung der Theorie durch Salamon/Anheier
- Die Institutionelle Theorie auf der Grundlage von Esping-Andersens Wohlfahrtsstaatmodellen
- Hauptaussagen der Institutionellen Theorie
- Empirische Überprüfung der Theorie durch Salamon/Anheier
- Weisbrods Heterogenitätsthese
- Die Beziehungen zwischen deutschen Nonprofit-Organisationen in den Bereichen Gesundheit und Soziale Dienste und dem Staat
- Die Entwicklung des dualen Systems der Wohlfahrtspflege in Deutschland
- Beurteilung der Theorien in Bezug auf das duale System der Wohlfahrtspflege in Deutschland
- Beurteilung der Heterogenitätsthese
- Beurteilung der Theorie des „,Third-Party-Government“
- Beurteilung der Institutionellen Theorie
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Analyse der Beziehungen zwischen Staat und Nonprofit-Organisationen, insbesondere im Bereich der Gesundheits- und Sozialdienste. Sie untersucht ausgewählte Theorien, die diese Beziehung im Kontext der Wohlfahrtspflege erklären, und beurteilt deren Aussagekraft für das deutsche System.
- Entwicklung und Vergleich verschiedener Theorien zu den Beziehungen zwischen Staat und Nonprofit-Organisationen
- Analyse des deutschen Wohlfahrtssystems im Kontext der ausgewählten Theorien
- Empirische Überprüfung der Theorien anhand von Studien von Salamon/Anheier
- Beurteilung der Aussagekraft der Theorien im Hinblick auf das duale System der Wohlfahrtspflege in Deutschland
- Hervorhebung der Rolle des Staates und der Nonprofit-Organisationen im Bereich der Gesundheits- und Sozialdienste in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und erläutert die Fokussierung auf den Bereich der Gesundheits- und Sozialdienste im Nonprofit-Sektor.
- Ausgewählte Theorien zu den Beziehungen zwischen Staat und Nonprofit-Organisationen: Dieses Kapitel untersucht drei Theorien, die die Beziehungen zwischen Staat und Nonprofit-Organisationen erklären: die Heterogenitätsthese von Weisbrod, die Theorie des „Third-Party-Government“ von Salamon und die Institutionelle Theorie basierend auf Esping-Andersens Wohlfahrtsstaatmodellen. Zu jeder Theorie werden die Hauptaussagen erläutert und die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung von Salamon/Anheier vorgestellt.
- Die Beziehungen zwischen deutschen Nonprofit-Organisationen in den Bereichen Gesundheit und Soziale Dienste und dem Staat: Dieser Abschnitt betrachtet die Entwicklung des dualen Systems der Wohlfahrtspflege in Deutschland und beleuchtet die Rolle des Staates und der Nonprofit-Organisationen in diesem System.
- Beurteilung der Theorien in Bezug auf das duale System der Wohlfahrtspflege in Deutschland: Das Kapitel evaluiert die drei zuvor besprochenen Theorien in Bezug auf ihre Aussagekraft für das duale System der Wohlfahrtspflege in Deutschland. Es werden die Stärken und Schwächen der Theorien im Hinblick auf die deutsche Situation analysiert.
Schlüsselwörter
Die vorliegenden Ausführungen befassen sich mit den Beziehungen zwischen Staat und Nonprofit-Organisationen, insbesondere im Bereich der Gesundheits- und Sozialdienste. Die Arbeit analysiert verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung dieser Beziehungen und beurteilt deren Relevanz für das deutsche Wohlfahrtssystem. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Nonprofit-Sektor, Wohlfahrtsstaat, duale Wohlfahrtspflege, Kollektivgüter, Heterogenitätsthese, Third-Party-Government, Institutionelle Theorie, Esping-Andersen-Modelle, Salamon/Anheier, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "duale System" der Wohlfahrtspflege in Deutschland?
Die enge Zusammenarbeit und Aufgabenteilung zwischen staatlichen Stellen und freien gemeinnützigen Trägern im Sozialwesen.
Was besagt Weisbrods Heterogenitätsthese?
Nonprofit-Organisationen entstehen dort, wo der Staat nur die Bedürfnisse des "Medianwählers" befriedigt und heterogene Minderheitenbedarfe ungedeckt bleiben.
Was ist "Third-Party-Government" nach Salamon?
Ein Modell, bei dem der Staat die Finanzierung übernimmt, die tatsächliche Leistungserbringung aber an Dritte (NPOs) delegiert.
Warum liegt der Fokus auf Gesundheits- und Sozialdiensten?
Weil diese Bereiche in Deutschland besonders staatsnah und hoch subventioniert sind, was sie von Sport oder Kultur unterscheidet.
Welche Rolle spielen Esping-Andersens Wohlfahrtsstaatmodelle?
Sie dienen als Grundlage für die Institutionelle Theorie, um nationale Unterschiede in der Einbindung von NPOs zu erklären.
Wie bewertet die Arbeit die Theorien für Deutschland?
Sie prüft die Aussagekraft der Theorien im Hinblick auf die historische Entwicklung und die spezifische Struktur des deutschen Sozialstaats.
- Citar trabajo
- Isabel Meyer (Autor), 2006, Untersuchung ausgewählter Theorien zu den Beziehungen zwischen Staat und Nonprofit-Organisationen , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157560