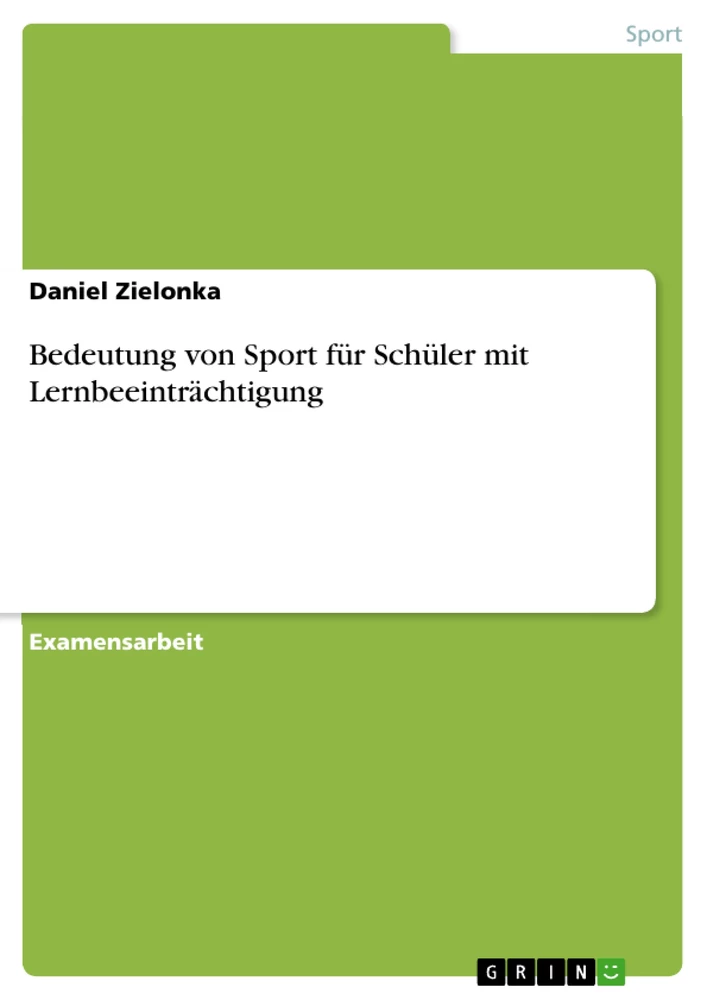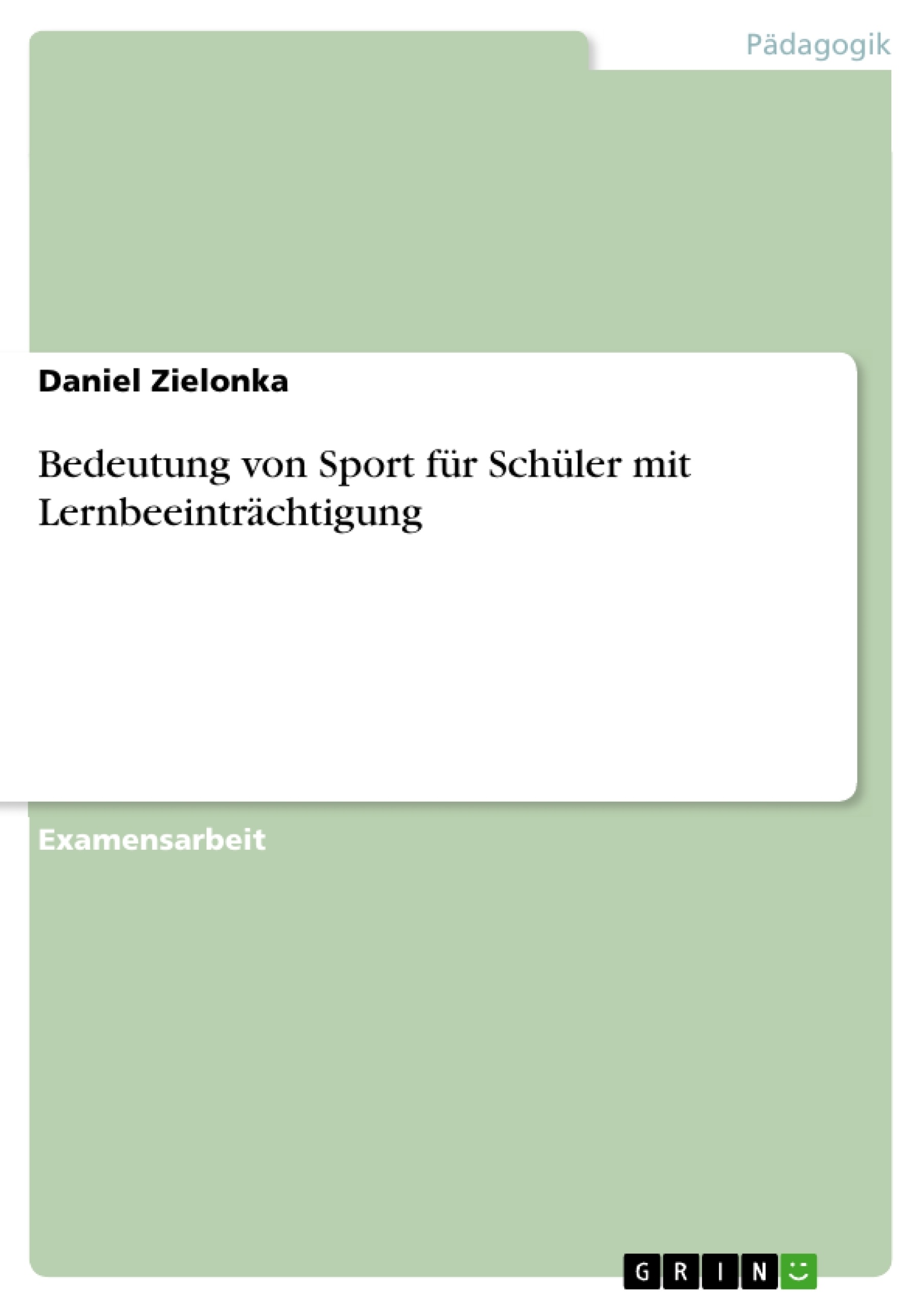Die Lebensumstände vieler FörderschülerInnen mit einer Lernbehinderung entwickeln sich oft problematisch. Sie durchlaufen zumeist eine Schulkarriere, die von Schulwechseln oder Verweisen geprägt ist und haben später schlechte Aussichten auf den Erhalt eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes. Wenn sie z.B. als ImmigrantInnen neu nach Deutschland kommen, sind sie der deutschen Sprache noch nicht beziehungsweise nur in Auszügen mächtig. Dadurch werden etliche ohne Rücksicht auf ihre intellektuellen Fähigkeiten der Förderschule zugeteilt.
So wird ihnen ein integrativer Weg in die Gesellschaft vorenthalten. Der soziale sowie berufliche Verlauf endet vielfach bei Hartz IV (Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt) zum Arbeitslosengeld II auf einem Niveau unterhalb der bisherigen Sozialhilfe, vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Hartz_IV#Hartz_IV) oder als Billiglohnkraft. In dieser Hinsicht ein ziemlich brisantes Thema, da ca. 80- 90 % der Lernbehinderten aus sozialen Unterschichten stammen und am Ende der schulischen Laufbahn auch in dieser Verbleiben (vgl. Bleidick 1995, S. 109ff).
Auch seitens der Familie treten Schwierigkeiten auf: Eltern, die mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert sind bzw. die Kinder ablehnen (vgl. ebd., S.110ff) damit die unentbehrlichen Erziehungspflichten vernachlässigen und infolgedessen den Nachwuchs sich selbst überlassen. Es fehlt einigen FörderschülerInnen schon die dringende häusliche Unterstützung von Mutter und Vater. Bleidick (1995, S. 108ff) spricht hier von fehlender „Nestwärme“. Durch diese vernachlässigten (vor allem frühkindlichen) Bedürfnisse, die auch Sicherheit und Vertrauen vermitteln, kann es im Zusammenspiel mit Entmutigungen durch überforderten Ehrgeiz und einer zu harten und das Kind in seinem Selbstständigkeitsstreben behindernde Erziehungshaltung zu dauerndem Schulversagen kommen. Die Kinder / Jugendlichen müssen daher ihr Dasein sehr früh allein regeln, was sie häufig überfordert. Ihr Leben ist dann schnell auch ein Überlebenskampf, bestimmt durch soziale oder finanzielle Nöte, unter dem die Schule durch beispielsweise Fehlzeiten leidet. Soziale Normen und Werte müssen sich selbst angeeignet werden und sind folglich oft nur teilweise bzw. rückständig entwickelt (vgl. ebd., S. 108 ff).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Auseinandersetzung mit dem Thema „Lernbehinderung“
- 2.1. Der Begriff der Lernbehinderung allgemein
- 2.2 Theorien der Lernbehinderung
- 2.2.1. Lernbehinderung als individueller Defekt
- 2.2.2. Lernbehinderung und soziale Randständigkeit
- 2.2.2.1. Etikettierungsansatz
- 2.2.2.2. Lernbehinderung aus materialistischer Sicht
- 2.2.3. Lernbehinderung als Folge des selektiven Schulsystems
- 2.2.4. Lernbehinderung aus systemisch - konstruktivistischer Sicht
- 2.2.4.1. Das konstruktivistische Verständnis der Beziehung zwischen Organismus und Umwelt
- 2.2.4.2. Das konstruktivistische Verständnis von einem Organismus
- 2.2.4.3. Die systemische Rekonstruktion von Lernbeeinträchtigung als Beziehungsstörungen in sozialen Kontexten
- 2.3. Merkmale und Erscheinungsformen einer Lernbehinderung
- 2.4. Ursachen, die eine Lernbehinderung bedingen können
- 2.4.1. Der Paradigmenwechsel nach Bleidick
- 2.4.2. Das „bio- soziale Modell der Interaktion und Kumulation“ nach Kanter
- 2.4.3. Faktorengruppen die Lernbehinderung bedingen
- 2.5. Abgrenzungen der Lernbehinderung zu anderen Behinderungsformen
- 2.5.1. Der Begriff der Behinderung
- 2.5.2. Lernbehinderung im Vergleich zur Verhaltensstörung
- 2.5.3. Lernbehinderung im Kontext einer Mehrfachbehinderung
- 2.5.4. Abgrenzung zu anderen Behinderungsformen
- 3. Bedeutung des Sports
- 3.1. Definition des Begriffs „Sport“
- 3.2. Bedeutung des Sports in der deutschen Gesellschaft
- 3.3. Die Bedeutung des Sports in der Schule
- 3.3.1. Die Bedeutung des Schulsport als Unterrichtsfach allgemein
- 3.3.2. Die Bedeutung des Schulsports für Förderschulen mit Lernbehinderten
- 3.3.2.1. Der Gesichtspunkt „Psychomotorik“ im Rahmen sonderpädagogischer Förderung
- 3.3.2.2. Das Konzept der Motopädagogik
- 3.3.2.3. Sportpädagogik - Motopädagogik
- 3.3.2.4. Sportunterricht an der Schule für Lernhilfe - ein Konzept nach Doll – Tepper
- 3.3.2.5. Ziele und Aufgaben des Sportunterrichts
- 3.3.3. Die Bedeutung des außerunterrichtlichen Sports
- 3.3.4. Außerschulischer Sport
- 3.4. Sportunterricht in der Förderschule
- 4.1. Schulsystem Förderschule
- 4.2. Die Umsetzung des Sportunterrichts an der Förderschule für Lernbehinderte
- 4.2.1. Sportunterricht in den Jahrgängen eins bis vier
- 4.2.2. Sportunterricht in den Jahrgängen fünf bis neun
- 4.2.3. Fazit für den Sportunterricht in der Primar- und Sekundarstufe
- 5. Hypothetische Auswirkungen des Sportunterrichts an Förderschulen mit Lernbeeinträchtigung
- 5.1. Die grundlegende Fragestellung der Bögen
- 5.2. Beschreibung der Fragebögen
- 5.3. Befragungssituation
- 5.4. Vorgehensweise bei der Auswertung der unterschiedlichen Daten
- 5.5. Auswertung
- 5.6. Zusammenfassung und Interpretation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Sport für Schüler mit Lernbeeinträchtigung. Ziel ist es, zu analysieren, inwiefern Sport gesellschaftliche Werte und Normen vermittelt und die Entwicklung der Schüler fördert. Dabei werden sowohl der Schulsport als auch außerschulische Aktivitäten betrachtet.
- Vermittlung sozialer Kompetenzen durch Sport
- Auswirkungen von Sport auf die Selbstwahrnehmung und das Selbstwertgefühl von Schülern mit Lernbeeinträchtigung
- Rollen von Sport im Kontext von Inklusion und Teilhabe
- Analyse verschiedener pädagogischer Ansätze im Sportunterricht für Schüler mit Lernbeeinträchtigung
- Untersuchung der Motivation und des Engagements von Schülern mit Lernbeeinträchtigung im Sport
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Forschungsfrage der Arbeit: Inwiefern fördert die Teilnahme am Sportunterricht die Aneignung gesellschaftlicher Werte und Normen bei Schülern mit Lernbeeinträchtigung und wie erleben diese Schüler den Sportunterricht? Die Autorin benennt zentrale Fragestellungen bezüglich der sozialen Integration, der Bewältigung von Herausforderungen und der individuellen Wahrnehmung des Sportunterrichts.
2. Auseinandersetzung mit dem Thema „Lernbehinderung“: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den Begriff der Lernbehinderung. Es werden verschiedene Theorien und Modelle der Lernbehinderung vorgestellt, von individuellen Defektmodellen bis hin zu systemisch-konstruktivistischen Ansätzen, die den Einfluss sozialer Faktoren und des Schulsystems betonen. Die Kapitel analysieren Ursachen, Erscheinungsformen und Abgrenzungen zu anderen Behinderungsformen, um ein ganzheitliches Verständnis zu schaffen.
3. Bedeutung des Sports: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Sports allgemein, in der Gesellschaft und speziell im schulischen Kontext. Es werden verschiedene Aspekte wie die Förderung der Psychomotorik, motopädagogische Konzepte und die Rolle des Sports im Kontext von Förderschulen für Lernbehinderte diskutiert. Es wird die Bedeutung des Schulsportes als Unterrichtsfach und des außerschulischen Sports erläutert und verschiedene Konzepte und Ziele des Sportunterrichts vorgestellt.
4. Sportunterricht in der Förderschule: Hier wird die Umsetzung des Sportunterrichts an Förderschulen für Lernbehinderte detailliert beschrieben, differenziert nach Primar- und Sekundarstufe. Das Kapitel beleuchtet die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten des Sportunterrichts für diese Schülergruppe, unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten.
Schlüsselwörter
Lernbehinderung, Sport, Inklusion, soziale Kompetenz, Schulsport, Motopädagogik, Sonderpädagogik, Selbstwertgefühl, Teilhabe, Förderung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bedeutung von Sport für Schüler mit Lernbeeinträchtigung
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Sport für Schüler mit Lernbeeinträchtigung. Der Fokus liegt auf der Analyse, inwiefern Sport gesellschaftliche Werte und Normen vermittelt und die Entwicklung der Schüler fördert, sowohl im Schulsport als auch in außerschulischen Aktivitäten.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte, darunter die Vermittlung sozialer Kompetenzen durch Sport, die Auswirkungen auf Selbstwahrnehmung und Selbstwertgefühl, die Rolle des Sports im Kontext von Inklusion und Teilhabe, verschiedene pädagogische Ansätze im Sportunterricht für Schüler mit Lernbeeinträchtigung und die Untersuchung der Motivation und des Engagements dieser Schüler im Sport.
Wie wird der Begriff "Lernbehinderung" definiert und betrachtet?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den Begriff "Lernbehinderung". Es werden verschiedene Theorien und Modelle vorgestellt, von individuellen Defektmodellen bis hin zu systemisch-konstruktivistischen Ansätzen, die soziale Faktoren und das Schulsystem berücksichtigen. Ursachen, Erscheinungsformen und Abgrenzungen zu anderen Behinderungsformen werden analysiert.
Welche Rolle spielt der Sport im schulischen Kontext, insbesondere an Förderschulen?
Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Sports in der Gesellschaft und speziell im schulischen Kontext, insbesondere an Förderschulen für Lernbehinderte. Es werden Aspekte wie die Förderung der Psychomotorik, motopädagogische Konzepte und die Rolle des Sports im Kontext von Förderschulen diskutiert. Die Bedeutung des Schulsportes als Unterrichtsfach und des außerschulischen Sports wird erläutert, inklusive verschiedener Konzepte und Ziele des Sportunterrichts.
Wie wird der Sportunterricht an Förderschulen für Lernbehinderte umgesetzt?
Die Umsetzung des Sportunterrichts an Förderschulen wird detailliert beschrieben, differenziert nach Primar- und Sekundarstufe. Spezifische Herausforderungen und Möglichkeiten des Sportunterrichts für diese Schülergruppe werden unter Berücksichtigung individueller Bedürfnisse und Fähigkeiten beleuchtet.
Welche Methoden werden zur Untersuchung der Auswirkungen des Sportunterrichts verwendet?
Die Arbeit beschreibt die grundlegende Fragestellung, die Beschreibung der Fragebögen, die Befragungssituation, die Vorgehensweise bei der Auswertung der Daten und die Interpretation der Ergebnisse. Die konkreten Methoden der Datenerhebung und -analyse werden detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lernbehinderung, Sport, Inklusion, soziale Kompetenz, Schulsport, Motopädagogik, Sonderpädagogik, Selbstwertgefühl, Teilhabe und Förderung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Auseinandersetzung mit dem Thema „Lernbehinderung“, Bedeutung des Sports, Sportunterricht in der Förderschule und Hypothetische Auswirkungen des Sportunterrichts an Förderschulen mit Lernbeeinträchtigung. Jedes Kapitel bietet detaillierte Informationen zu den jeweiligen Aspekten.
- Quote paper
- Daniel Zielonka (Author), 2006, Bedeutung von Sport für Schüler mit Lernbeeinträchtigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157581