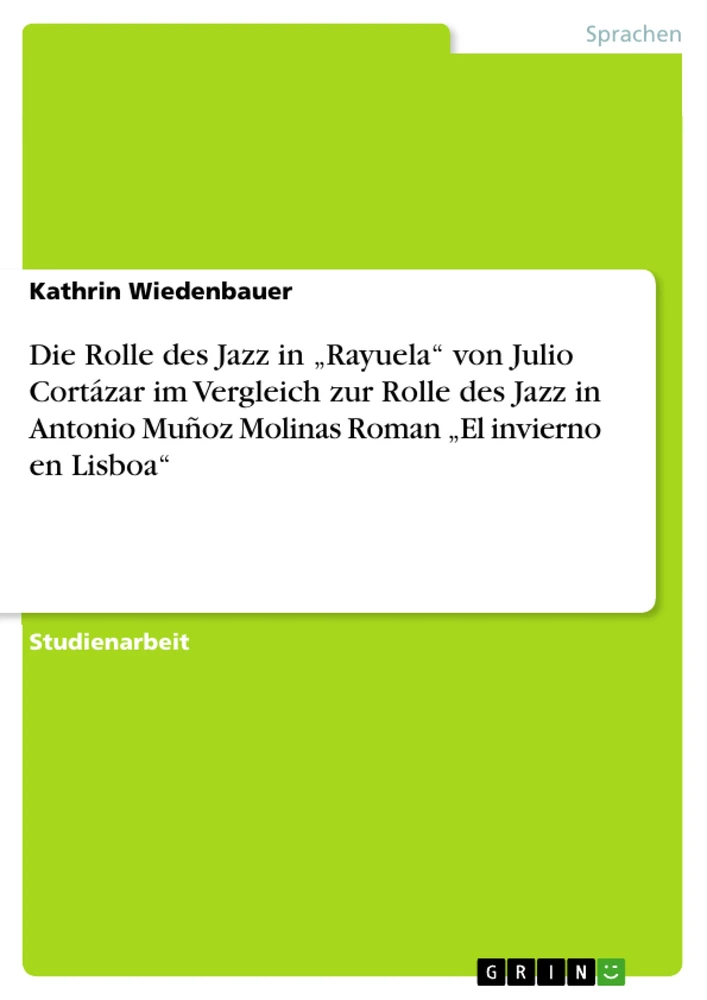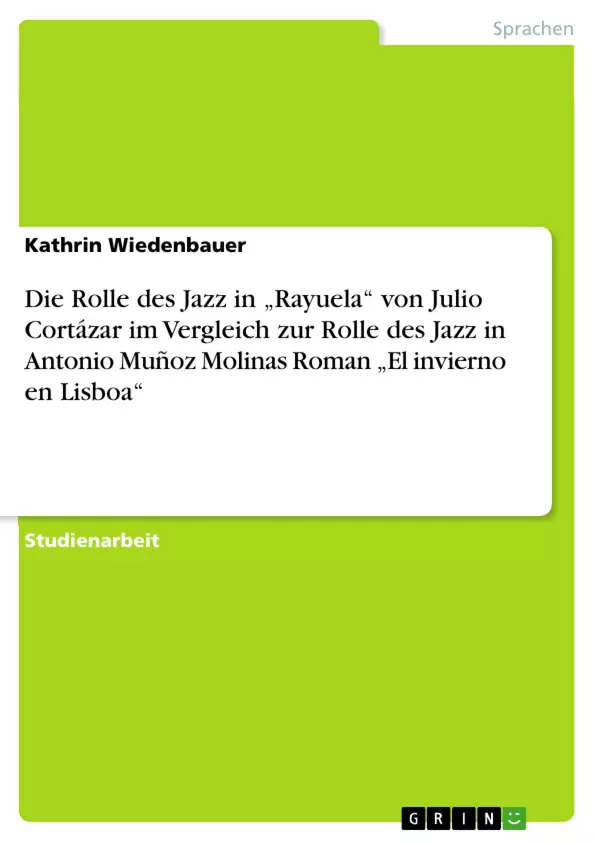Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Rolle des Jazz in „Rayuela“ von Julio Cortázar im Vergleich zu „El invierno en Lisboa“ von Antonio Muñoz Molina. Ich vergleiche hier zwei absolut unterschiedliche Romane.
Zum einen sind sie in unterschiedlichen Jahrzehnten geschrieben worden (1963 „Rayuela“; 1987 „El invierno en Lisboa“), zum anderen sind die Autoren unterschiedlicher Herkunft. So ist Cortázar ein lateinamerikanischer Autor, während Muñoz Molina Spanier ist. Zudem spielt der Jazz in beiden Werken eine völlig unterschiedliche Rolle. Bei „Rayuela“ werde ich mich im Laufe dieser Arbeit lediglich auf die Kapitel 10-18 beziehen, da hauptsächlich diese im Bezug auf den Jazz eine signifikante Rolle spielen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zu den Autoren Julio Cortázar und Antonio Muñoz Molina
- 3. Die Beziehung der Autoren zur Jazzmusik
- 4. Wesentliche Merkmale des Jazz
- 5. Überlegungen zur Strukturverwandtschaft von Musik und Literatur
- 6. Die Rolle des Jazz in „Rayuela“
- 7. Die Rolle des Jazz in „El invierno en Lisboa“
- 8. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle des Jazz in Julio Cortázars „Rayuela“ und vergleicht sie mit seiner Bedeutung in Antonio Muñoz Molinas „El invierno en Lisboa“. Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen literarischen Ansätze der Autoren und die jeweilige Funktion des Jazz innerhalb der Romane. Der Fokus liegt auf der literarischen Umsetzung und der Bedeutung des Jazz als stilistisches und thematisches Element.
- Vergleich der Darstellung des Jazz in zwei unterschiedlichen Romanen
- Analyse der Beziehung der Autoren zum Jazz
- Untersuchung der Strukturverwandtschaft von Musik und Literatur
- Die Rolle des Jazz als stilistisches Element
- Die Bedeutung des Jazz als thematisches Element
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt den Vergleich der Rolle des Jazz in „Rayuela“ von Julio Cortázar und „El invierno en Lisboa“ von Antonio Muñoz Molina. Es werden die Unterschiede der Romane hinsichtlich Entstehungszeit, Autorenschaft und der Bedeutung des Jazz hervorgehoben. Die Autorin erläutert ihre Fokussierung auf spezifische Kapitel von „Rayuela“ und ihren methodischen Ansatz.
2. Zu den Autoren Julio Cortázar und Antonio Muñoz Molina: Dieses Kapitel gibt kurze biografische Informationen über Julio Cortázar und Antonio Muñoz Molina, zwei bedeutende lateinamerikanische Autoren. Es hebt die unterschiedlichen Hintergründe und Karrieren der Autoren hervor, um Kontext für die Analyse ihrer jeweiligen Werke zu schaffen. Es werden auch einige wichtige Werke der Autoren erwähnt, um deren literarische Entwicklung zu veranschaulichen und die Unterschiede in ihrem Schreibstil zu beleuchten.
3. Die Beziehung der Autoren zur Jazzmusik: In diesem Kapitel wird die persönliche Beziehung beider Autoren zur Jazzmusik untersucht. Es wird insbesondere Cortázars Leidenschaft für den Jazz hervorgehoben, die sich in seinen Äußerungen und seiner Präferenz für diesen Musikstil widerspiegelt. Das Kapitel beleuchtet Cortázars musikalische Ausbildung und seine Vorlieben, im Gegensatz zu seiner anfänglichen Ablehnung südamerikanischer Musik. Der Bezug zur Jazzmusik der Autoren bildet die Grundlage für das Verständnis der Einbettung des Jazz in ihre Romane.
4. Wesentliche Merkmale des Jazz: Dieses Kapitel beschreibt die charakteristischen Merkmale des Jazz, die für das Verständnis seiner Rolle in den analysierten Romanen relevant sind. Durch die Hervorhebung der charakteristischen Merkmale des Jazz soll den Lesern das Verständnis der im Roman dargestellten Stimmungen erleichtert werden. Es dient als Grundlage für die Interpretation der jeweiligen literarischen Umsetzung des Jazz.
5. Überlegungen zur Strukturverwandtschaft von Musik und Literatur: Das fünfte Kapitel befasst sich mit theoretischen Überlegungen zur Strukturverwandtschaft von Musik und Literatur. Es untersucht die Gemeinsamkeiten zwischen beiden Kunstformen und analysiert, welche Anknüpfungspunkte zwischen Musik und Literatur bestehen. Die Autorin bezieht sich auf Muñoz Molinas Aufsatz „El jazz y la ficción“, um die wichtigsten Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, die er zwischen Jazz (bzw. Musik im Allgemeinen) und Literatur findet.
6. Die Rolle des Jazz in „Rayuela“: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Jazz in ausgewählten Kapiteln von Julio Cortázars „Rayuela“. Es untersucht die Art und Weise, wie der Jazz in die narrative Struktur und die Thematik des Romans eingebunden ist. Es wird die Bedeutung des Jazz für die Atmosphäre und die Charaktere eingehend beleuchtet.
7. Die Rolle des Jazz in „El invierno en Lisboa“: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der Rolle des Jazz in Antonio Muñoz Molinas „El invierno en Lisboa“. Im Gegensatz zu „Rayuela“, wo der Jazz nur in bestimmten Kapiteln eine Rolle spielt, ist er hier integraler Bestandteil der Handlung und Atmosphäre. Es werden die Unterschiede in der Darstellung des Jazz zwischen beiden Romanen hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Julio Cortázar, Antonio Muñoz Molina, Rayuela, El invierno en Lisboa, Jazzmusik, lateinamerikanische Literatur, spanische Literatur, Romanvergleich, Literaturanalyse, Strukturverwandtschaft, Musik und Literatur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich der Rolle des Jazz in Julio Cortázars "Rayuela" und Antonio Muñoz Molinas "El invierno en Lisboa"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit vergleicht die Rolle des Jazz in zwei bedeutenden Romanen der lateinamerikanischen Literatur: Julio Cortázars „Rayuela“ und Antonio Muñoz Molinas „El invierno en Lisboa“. Der Fokus liegt auf der Analyse der literarischen Umsetzung des Jazz als stilistisches und thematisches Element in beiden Werken und dem Vergleich der jeweiligen Ansätze der Autoren.
Welche Autoren werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Autoren Julio Cortázar und Antonio Muñoz Molina. Es werden biografische Informationen zu beiden Autoren gegeben, um den Kontext ihrer Werke besser zu verstehen und die unterschiedlichen Hintergründe ihrer Beziehung zur Jazzmusik zu beleuchten.
Welche Romane werden analysiert?
Die Analyse umfasst zwei Romane: Julio Cortázars „Rayuela“ und Antonio Muñoz Molinas „El invierno en Lisboa“. Die Arbeit untersucht, wie der Jazz in die narrative Struktur, die Thematik und die Atmosphäre beider Romane eingebunden ist, und hebt die Unterschiede in der Darstellung des Jazz in beiden Werken hervor.
Wie wird der Jazz in den Romanen dargestellt?
Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Arten der Darstellung des Jazz in den Romanen. In „Rayuela“ spielt der Jazz in ausgewählten Kapiteln eine Rolle, während er in „El invierno en Lisboa“ integraler Bestandteil der Handlung und Atmosphäre ist. Die Analyse beleuchtet die Bedeutung des Jazz für die Atmosphäre und die Charaktere in beiden Romanen.
Welche Themen werden neben dem Jazz behandelt?
Neben der zentralen Rolle des Jazz werden weitere Themen behandelt, wie z.B. die Beziehung der Autoren zur Jazzmusik, die Strukturverwandtschaft von Musik und Literatur (unter Bezugnahme auf Muñoz Molinas Aufsatz „El jazz y la ficción“), und ein Vergleich der literarischen Stile beider Autoren.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Vorstellung der Autoren, die Beziehung der Autoren zum Jazz, wesentliche Merkmale des Jazz, Strukturverwandtschaft von Musik und Literatur, die Rolle des Jazz in „Rayuela“, die Rolle des Jazz in „El invierno en Lisboa“ und Schlussbemerkung.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Literaturanalyse. Sie untersucht die literarische Umsetzung des Jazz in beiden Romanen und vergleicht die unterschiedlichen Ansätze der Autoren. Die Autorin beschreibt ihren methodischen Ansatz in der Einleitung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter umfassen: Julio Cortázar, Antonio Muñoz Molina, Rayuela, El invierno en Lisboa, Jazzmusik, lateinamerikanische Literatur, spanische Literatur, Romanvergleich, Literaturanalyse, Strukturverwandtschaft, Musik und Literatur.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich für lateinamerikanische Literatur, die Werke von Julio Cortázar und Antonio Muñoz Molina, und die Beziehung zwischen Musik und Literatur interessieren. Sie eignet sich insbesondere für akademische Zwecke und die Analyse literarischer Themen.
- Citar trabajo
- Kathrin Wiedenbauer (Autor), 2005, Die Rolle des Jazz in „Rayuela“ von Julio Cortázar im Vergleich zur Rolle des Jazz in Antonio Muñoz Molinas Roman „El invierno en Lisboa“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157615