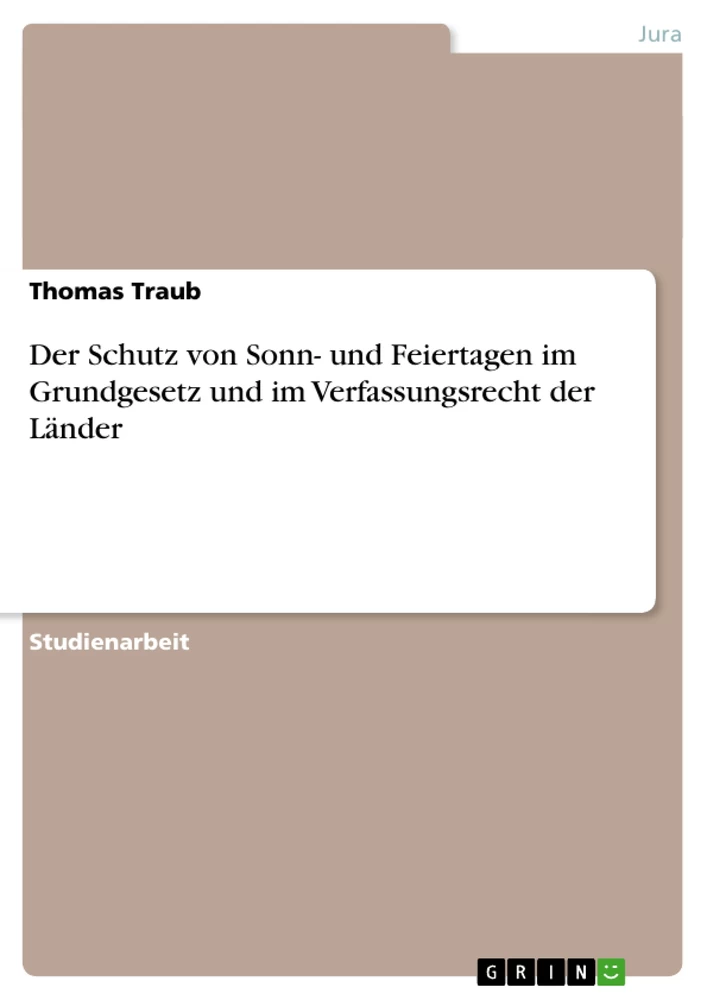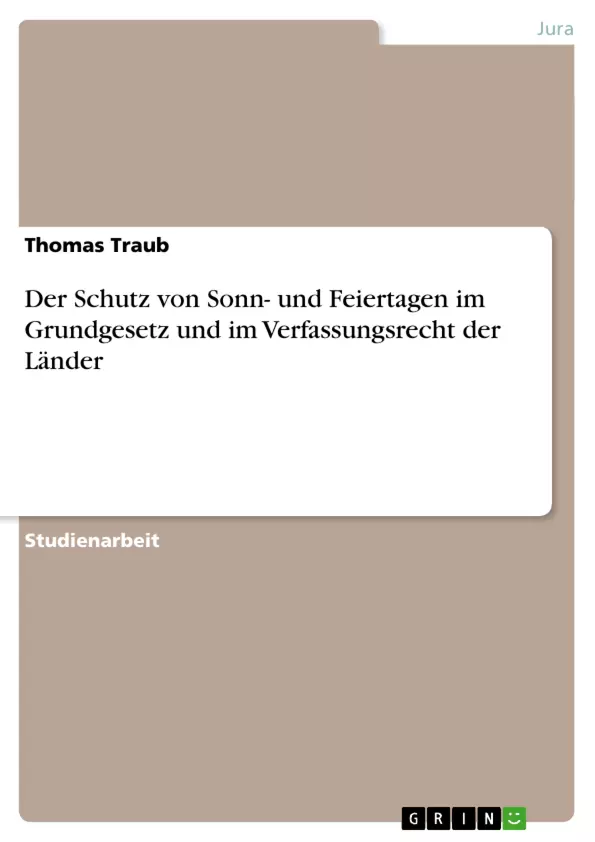Die Arbeit behandelt den Schutz von Sonn- und Feiertagen im Verfassungsrecht des Bundes und der Länder. Zentrale Vorschrift ist dabei Art. 140 GG/Art. 139 WRV, der den Schutz der Sonn- und Feiertage verfassungsrechtlich gewährleistet. Nach einem kurzen Überblick über die Entstehungsgeschichte werden zunächst der Sachbereich der Norm bestimmt und die Unterschiede zwischen staatlich anerkannten und (nur) kirchlichen Feiertagen herausgearbeitet.
Anschließend wird der Zweck des Schutzes von Sonn- und Feiertagen als Tage der Arbeitsruhe und „seelischen Erhebung“ begründet und die enge Verbindung der Verfassungsgarantie mit der Menschenwürde und dem Sozialstaatsprinzip aufgezeigt. Daneben wird die Feiertagsgarantie als Faktor der gesellschaftlichen Integration interpretiert, der ein unentbehrliches Mindestmaß an „sozialer Synchronisation“ sicherstellt. Schließlich wird die Bedeutung des Sonn- und Feiertagsschutzes als Ausdruck der „hinkenden Trennung“ von Kirche und Staat im System des Grundgesetzes analysiert.
Diese Erkenntnisse dienen als Grundlage für die konkrete Bestimmung, welchen Inhalt und Umfang die Verfassungsgarantie des Art. 140 GG/ Art. 139 WRV hat. Ausführlich wird dabei die Frage behandelt, welche verfassungsrechtlichen Vorgaben die Vorschrift für den Gesetzgeber enthält, der den Sonntagsschutz im einfachen Recht konkretisieren muss.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Frage, ob Art. 140 GG/ Art. 139 WRV allein eine institutionelle Garantie enthält oder sich aus der Norm subjektive Rechte ableiten lassen – eine Frage, die für die effektive Durchsetzung von erheblicher Relevanz ist. In einem weiteren Abschnitt wird das Verhältnis von Art. 140 GG/Art. 139 WRV zu den Grundrechten beleuchtet.
Der zweite Teil der Arbeit beinhaltet den Sonn- und Feiertagsschutz in den Landesverfassungen. Die Untersuchung ergibt, dass einige Länder die bundes-verfassungsrechtliche Garantie schlicht übernehmen, andere Landesverfassungen aber auch über die grundgesetzliche Garantie inhaltlich hinausgehende Ergänzungen des Sonn- und Feiertagsschutzes enthalten.
Der letzte Teil der Arbeit zeigt die Auswirkungen der verfassungsrechtlichen Vorgaben für die gesellschaftliche Diskussion um den Sonn- und Feiertagsschutz. Der Autor weist darauf hin, dass unter der Geltung des Grundgesetzes die „faktische Kraft des Normativen“ zu betonen ist und setzt sich kritisch mit der Ansicht auseinander, die für weitergehende Einschränkungen der Verfassungsgarantie plädiert.
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1 Historischer Überblick
- Teil 2 Sonn- und Feiertagsschutz im Grundgesetz
- A. „Der Sonntag und staatlich anerkannte Feiertage“ – Sachbereich der Norm
- I. Der Sonntag
- II. Die Feiertage
- Exkurs: Die Abschaffung des Buß- und Bettages
- B. „als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung“ – Zweck der Norm
- I. Feiertagsgarantie als Ausdruck von Menschenwürde und Sozialstaatsprinzip
- II. Feiertagsgarantie als Faktor der gesamt-gesellschaftlichen Integration
- III. Feiertagsgarantie als Ausdruck der „hinkenden Trennung“ von Kirche und Staat
- C. „bleiben gesetzlich geschützt“ – Inhalt und Ausmaß der Norm
- I. Institutionsgarantie und ihr Umfang
- 1. Art. 139 WRV als Gesetzgebungsauftrag für Bund und Land
- 2. Verfassungsrechtliche Vorgaben an den Gesetzgeber
- 3. Verfassungsrechtlich zulässige Ausnahmen von der Feiertagsruhe
- a) Arbeit trotz Sonntag
- b) Arbeit für den Sonntag
- c) Allgemeine verfassungsrechtliche Anforderungen an die Ausnahmetatbestände
- II. Subjektives Recht aus Art. 140 GG/ 139 WRV ?
- I. Institutionsgarantie und ihr Umfang
- D. Art. 139 WRV im Verhältnis zu den Grundrechten
- A. „Der Sonntag und staatlich anerkannte Feiertage“ – Sachbereich der Norm
- Teil 3 Sonn- und Feiertagsschutz in den Verfassungen der Länder
- A. Übernahme des Wortlautes aus GG/WRV
- B. Ergänzungen zum Grundgesetz
- Teil 4 Herausforderungen für den Sonn- und Feiertagsschutz im Licht des gesellschaftlichen Wandels
- A. Normative Kraft des Grundgesetzes
- B. Verfassungspolitische Diskussion – Änderung des Art. 139 WRV?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Schutz von Sonn- und Feiertagen im deutschen Grundgesetz und den Landesverfassungen. Sie beleuchtet den historischen Kontext, die verfassungsrechtlichen Grundlagen und die aktuellen Herausforderungen im Angesicht gesellschaftlicher Veränderungen.
- Historische Entwicklung des Sonn- und Feiertagsschutzes in Deutschland
- Verfassungsrechtliche Grundlagen des Sonn- und Feiertagsschutzes im Grundgesetz (Art. 139 WRV)
- Auslegung und Anwendung des Sonn- und Feiertagsschutzes in den Landesverfassungen
- Spannungsverhältnis zwischen Sonn- und Feiertagsschutz und Grundrechten (z.B. Berufsfreiheit, Religionsfreiheit)
- Herausforderungen des Sonn- und Feiertagsschutzes durch gesellschaftlichen Wandel und ökonomische Interessen
Zusammenfassung der Kapitel
Teil 1 Historischer Überblick: Dieser Teil gibt einen Überblick über die Entstehung des Sonn- und Feiertagsschutzes im deutschen Recht. Er beschreibt, wie die Vorschrift, die den Schutz der Feiertage garantiert, auf Drängen des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses in die Weimarer Reichsverfassung aufgenommen wurde, und wie dies sowohl den Interessen sozialistischer als auch bürgerlicher Parteien entgegenkam. Die Diskussion um den Schutz der christlichen Feiertage und des Sonntags wird beleuchtet, um den historischen Kontext der heutigen Rechtslage zu verstehen. Die Einigung auf diese Regelung im Jahre 1919 wird detailliert dargestellt.
Teil 2 Sonn- und Feiertagsschutz im Grundgesetz: Dieser Teil analysiert Artikel 139 des Grundgesetzes (GG), der den Schutz von Sonn- und Feiertagen regelt. Er untersucht den Sachbereich der Norm, den Zweck des Schutzes (Arbeitsruhe, seelische Erhebung) und seinen verfassungsrechtlichen Gehalt. Der Teil beleuchtet die Bedeutung des Schutzes für Menschenwürde, Sozialstaatsprinzip und gesellschaftliche Integration. Ausnahmen von der Feiertagsruhe und deren verfassungsrechtliche Zulässigkeit werden ebenfalls detailliert erörtert. Das Verhältnis von Art. 139 WRV zu anderen Grundrechten wie der Religions-, Familien-, Versammlungs- und Berufsfreiheit wird untersucht.
Teil 3 Sonn- und Feiertagsschutz in den Verfassungen der Länder: Dieser Teil befasst sich mit der Umsetzung des Sonn- und Feiertagsschutzes in den Landesverfassungen. Er untersucht, inwieweit die Landesverfassungen den Wortlaut des Grundgesetzes übernehmen und welche zusätzlichen Regelungen oder Ergänzungen vorhanden sind. Die unterschiedlichen Motivationen hinter dem Sonn- und Feiertagsschutz in den einzelnen Bundesländern werden analysiert, ebenso die Rolle der christlichen Tradition bei der Festlegung der Feiertage. Die Festlegung des 1. Mai als Feiertag wird als Beispiel für unterschiedliche landesrechtliche Ausprägungen diskutiert.
Teil 4 Herausforderungen für den Sonn- und Feiertagsschutz im Licht des gesellschaftlichen Wandels: Dieser Teil befasst sich mit den aktuellen Herausforderungen für den Sonn- und Feiertagsschutz. Er analysiert die zunehmende Kritik am bestehenden System, insbesondere aufgrund ökonomischer Interessen und veränderten Freizeitverhaltens. Die Diskussion um eine mögliche Änderung von Art. 139 WRV wird behandelt und die ökonomischen Kosten des Sonntags sowie der Wandel des Freizeitverhaltens werden als zentrale Aspekte der aktuellen Debatte herausgestellt.
Schlüsselwörter
Sonn- und Feiertagsschutz, Grundgesetz, Landesverfassungen, Arbeitsruhe, seelische Erhebung, Religionsfreiheit, Berufsfreiheit, gesellschaftlicher Wandel, ökonomische Interessen, Art. 139 WRV, Weimarer Reichsverfassung, Verfassungsrecht.
Häufig gestellte Fragen zum Sonn- und Feiertagsschutz in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert umfassend den Schutz von Sonn- und Feiertagen im deutschen Rechtssystem. Sie untersucht die historischen Wurzeln, die verfassungsrechtlichen Grundlagen im Grundgesetz und den Landesverfassungen, sowie aktuelle Herausforderungen im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und ökonomischer Interessen.
Welche Aspekte des Sonn- und Feiertagsschutzes werden behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Aspekten ab: die historische Entwicklung, die verfassungsrechtlichen Grundlagen (insbesondere Art. 139 WRV), die Auslegung und Anwendung in den Landesverfassungen, das Spannungsverhältnis zum Grundrechtsschutz (z.B. Berufsfreiheit, Religionsfreiheit), und die Herausforderungen durch den gesellschaftlichen Wandel und ökonomische Interessen. Die Arbeit beinhaltet eine detaillierte Analyse des Grundgesetzartikels, der die Feiertagsruhe schützt, sowie eine Betrachtung der Ausnahmen von dieser Regelung.
Wie wird der historische Kontext des Sonn- und Feiertagsschutzes dargestellt?
Der historische Überblick beleuchtet die Entstehung des Sonn- und Feiertagsschutzes, seine Aufnahme in die Weimarer Reichsverfassung unter dem Einfluss des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses und der Einigung verschiedener politischer Interessen. Die Diskussion um den Schutz christlicher Feiertage und des Sonntags wird detailliert dargestellt, um die heutige Rechtslage besser zu verstehen. Die Einigung auf diese Regelung im Jahre 1919 wird eingehend beschrieben.
Welche Rolle spielt Artikel 139 WRV im Grundgesetz?
Artikel 139 WRV (Weimarer Reichsverfassung), der im Grundgesetz fortgeführt wurde, bildet den Kern der Untersuchung. Die Arbeit analysiert den Sachbereich der Norm, ihren Zweck (Arbeitsruhe und seelische Erhebung), und ihren verfassungsrechtlichen Gehalt. Die Bedeutung des Schutzes für Menschenwürde, Sozialstaatsprinzip und gesellschaftliche Integration wird hervorgehoben. Ausnahmen von der Feiertagsruhe und ihre verfassungsrechtliche Zulässigkeit werden ausführlich erörtert, ebenso wie das Verhältnis zu anderen Grundrechten.
Wie wird der Sonn- und Feiertagsschutz in den Landesverfassungen behandelt?
Die Arbeit untersucht die Umsetzung des Sonn- und Feiertagsschutzes in den einzelnen Landesverfassungen. Sie vergleicht den Wortlaut mit dem des Grundgesetzes, analysiert zusätzliche Regelungen und Ergänzungen, und beleuchtet die unterschiedlichen Motivationen und die Rolle der christlichen Tradition in den verschiedenen Bundesländern. Beispiele wie die Festlegung des 1. Mai als Feiertag veranschaulichen die landesrechtlichen Unterschiede.
Welche Herausforderungen bestehen für den Sonn- und Feiertagsschutz heute?
Der letzte Teil der Arbeit widmet sich den aktuellen Herausforderungen. Er analysiert die zunehmende Kritik am bestehenden System aufgrund ökonomischer Interessen und veränderter Freizeitgewohnheiten. Die Diskussion um eine mögliche Änderung von Art. 139 WRV wird eingehend behandelt, wobei die ökonomischen Kosten des Sonntags und der Wandel des Freizeitverhaltens als zentrale Aspekte der aktuellen Debatte herausgestellt werden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sonn- und Feiertagsschutz, Grundgesetz, Landesverfassungen, Arbeitsruhe, seelische Erhebung, Religionsfreiheit, Berufsfreiheit, gesellschaftlicher Wandel, ökonomische Interessen, Art. 139 WRV, Weimarer Reichsverfassung, Verfassungsrecht.
- Quote paper
- Thomas Traub (Author), 2002, Der Schutz von Sonn- und Feiertagen im Grundgesetz und im Verfassungsrecht der Länder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15761