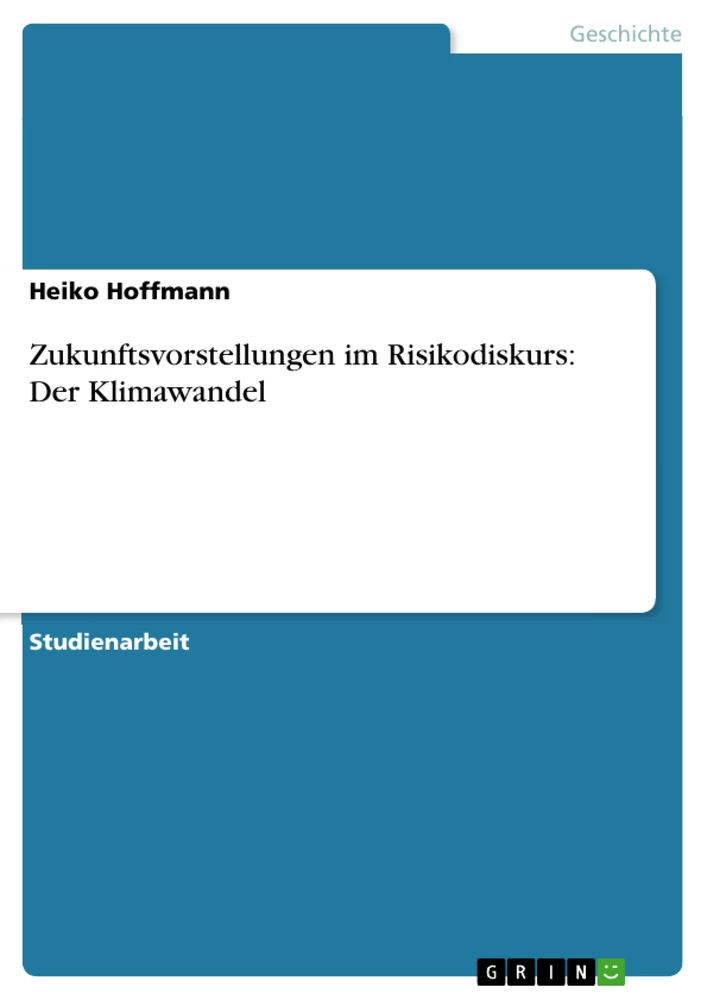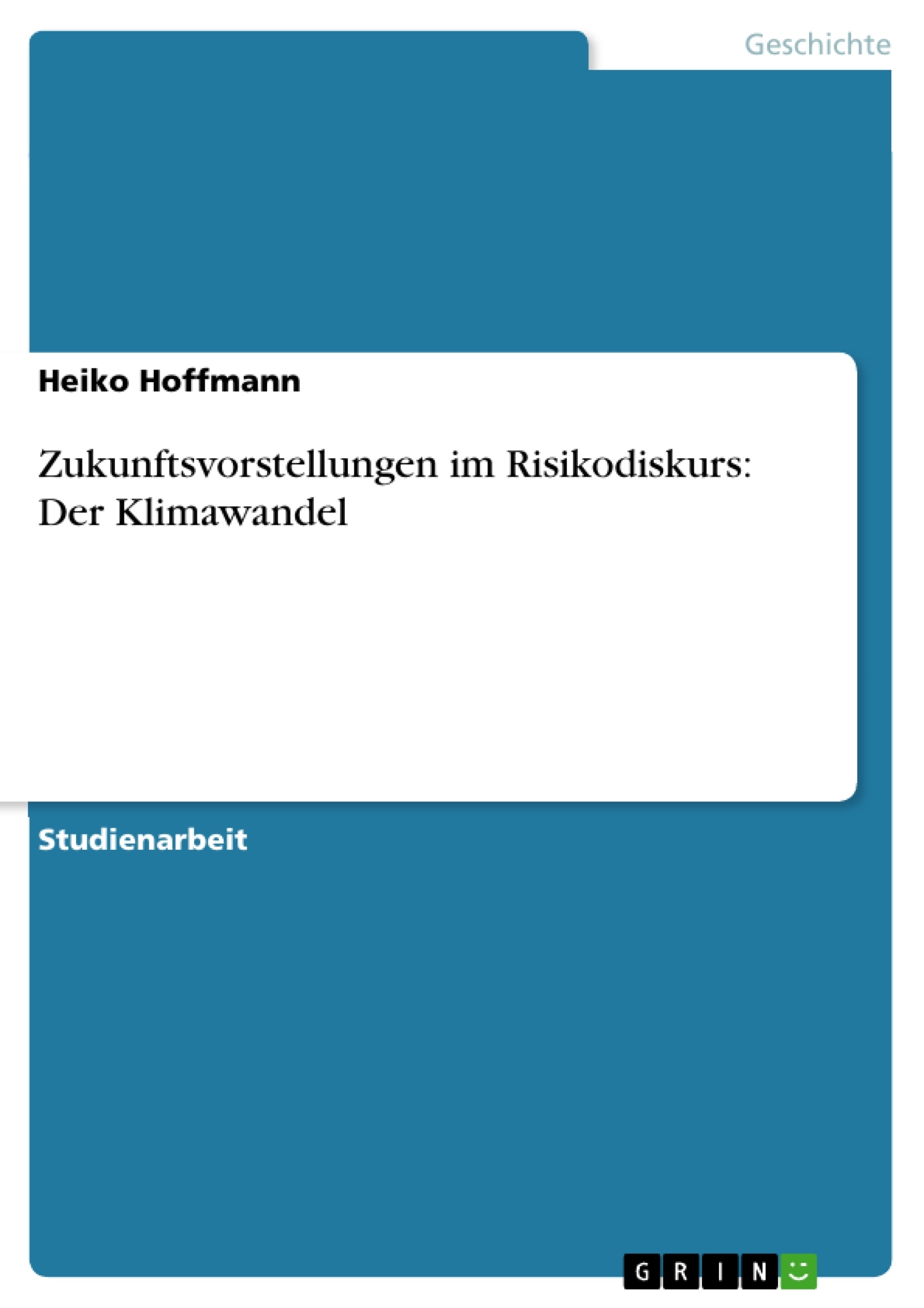1. Einleitung
Die Eiskappen schmelzen, der Meeresspiegel steigt. Großflächige Überschwemmungen und verheerende Unwetter sind die Folge. Ein Szenario, das keineswegs neu ist und bereits in Filmen wie „The Day after Tomorrow“ aufgezeigt wurde. Die Auswirkungen globaler Gefahren sind heute in Zeitung, Radio und Fernsehen allgegenwärtig. In der langen Entwicklungsgeschichte der Erde hat es immer wieder abwechselnd Kälte- und Wärmeperioden gegeben, doch die Beschleunigung dieses aktuellen Wettergeschehens schenkt diesem eine verstärkte Aufmerksamkeit. Einerseits werden uns durch die moderne Technik, die weltweiten Hochwasser, Wirbelstürme und ausbreitende Desertifikationen täglich vor Augen geführt, andererseits ist es zudem möglich mittels Computersimulationen, Weltuntergangsszenarien oder visionären Filmen die Zukunft in unsere Gegenwart zu holen. Durch die mannigfaltigsten Reportagen wird die Bevölkerung mit einer möglichen Zukunft konfrontiert, die eventuelle Risiken aufzeigt und zum Nachdenken angeregt. Durch die Mobilitätszunahme seit dem Mittelalter und den industriellen Fortschritt im letzten Jahrhundert, ist die Menschheit im Zeitalter der Globalisierung angekommen. Die weltweite Vernetzung mittels Computer und Satelliten lässt jede Veränderung in der Umwelt sichtbar werden. Das Resultat aus „wissenschaftlicher Sicht“ scheint alarmierend. Ist die Klimakatastrophe vielleicht doch keine Science-Fiction Zukunft?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellenauswahl
- Zukunftssemantik
- Risikosemantik
- Wahrnehmung der Umwelt
- Zukunftsvorstellungen im Risikodiskurs
- Prognostizierte Klimakatastrophe vs. natürliches Wettergeschehen
- Gegenwärtiges Risikobewusstsein
- Medialisierung von Risiken
- Selektion von Risiken
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht den Einfluss des Risikodiskurses rund um den Klimawandel auf die Zukunftsvorstellungen der Menschen. Sie analysiert die Ambivalenz zwischen dem medialen Fokus auf katastrophale Szenarien und der wissenschaftlichen Sicht auf natürliche Wetterschwankungen. Die Arbeit befasst sich mit der Semantik von "Risiko" und "Zukunft" im Kontext der medialen Berichterstattung und des wissenschaftlichen Diskurses.
- Die mediale Darstellung von Zukunftsprognosen im Kontext des Klimawandels.
- Der Einfluss des Risikodiskurses auf das Bewusstsein der Menschen.
- Die Semantik von "Risiko" und "Zukunft" in der gegenwärtigen Debatte.
- Die Rolle von Al Gore's Film "Eine unbequeme Wahrheit" und Dr. Wolfgang Thüne's Buch "Freispruch für CO2" im Risikodiskurs.
- Die Entwicklung des Zukunftsverständnisses im Laufe der Geschichte.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit führt in die Thematik des Klimawandels und des Risikodiskurses ein. Sie erläutert die Bedeutung von Zukunftsvorstellungen und Risikosemantik im aktuellen Kontext.
- Quellenauswahl: Die Arbeit erläutert die Auswahl von Al Gore's Film "Eine unbequeme Wahrheit" und Dr. Wolfgang Thüne's Buch "Freispruch für CO2" als Quellen für die Analyse des Risikodiskurses.
- Zukunftssemantik: Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Zukunftsverständnisses von einem "Essenzenkosmos" hin zu einer selbstbestimmten Gestaltung der Zukunft im Laufe der Geschichte.
- Wahrnehmung der Umwelt: Diese Sektion analysiert die Wahrnehmung der Umwelt und die Rolle der Medien bei der Vermittlung von Risiken.
- Zukunftsvorstellungen im Risikodiskurs: Diese Sektion befasst sich mit den unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen im Risikodiskurs, insbesondere mit der Konfrontation von Katastrophenszenarien und der natürlichen Wettergeschehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen wie Klimawandel, Risikodiskurs, Zukunftsvorstellungen, Medialisierung von Risiken, Semantik, "Eine unbequeme Wahrheit", "Freispruch für CO2", Essenzenkosmos und naturwissenschaftliche Interpretationen.
- Citation du texte
- Heiko Hoffmann (Auteur), 2008, Zukunftsvorstellungen im Risikodiskurs: Der Klimawandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157660