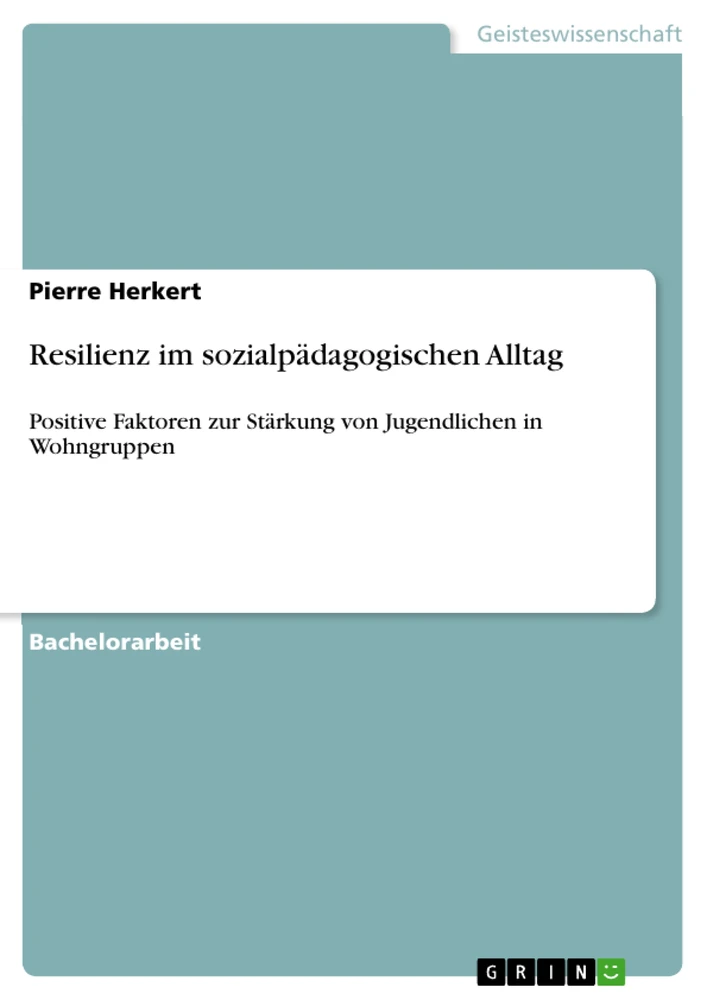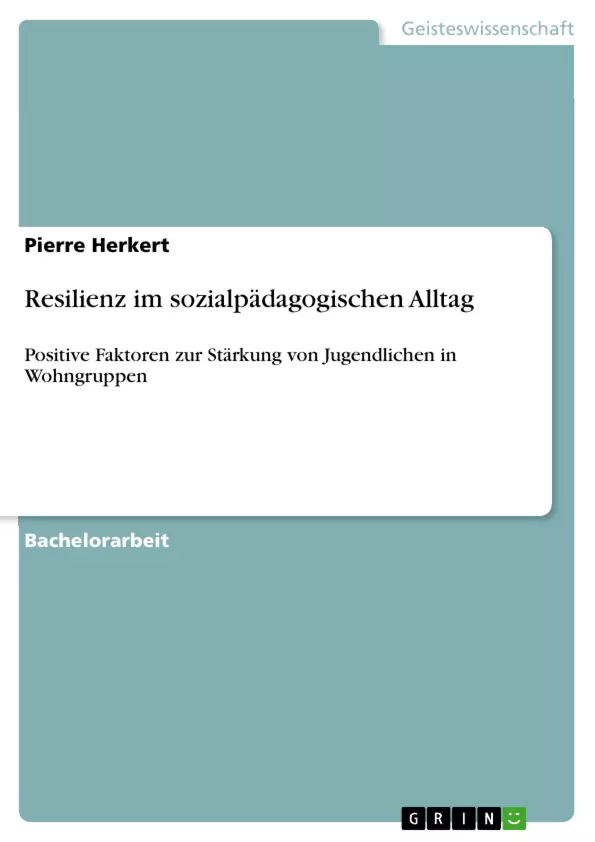Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Bedeutung und Förderung von Resilienz bei Jugendlichen in stationären Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe. Ausgangspunkt bildet die Beobachtung, dass Kinder und Jugendliche zunehmend unter belastenden Lebensbedingungen aufwachsen, etwa infolge familiärer Trennungen, Vernachlässigung, Migration, Armut oder Traumatisierung. Besonders betroffen sind jene jungen Menschen, die in Pflegefamilien, Heimen oder Wohngruppen leben. Diese Umstände stellen hohe Anforderungen an pädagogische Fachkräfte sowie an bestehende Unterstützungssysteme.
Im Zentrum der Arbeit steht die Untersuchung von Ressourcen und Schutzfaktoren, die die Resilienz von Jugendlichen in stationären Einrichtungen stärken können. Dabei wird analysiert, inwiefern pädagogische Fachkräfte durch gezielte Maßnahmen zur Förderung protektiver Faktoren sowie zur Bewältigung von Risikofaktoren beitragen können. Als theoretische Grundlage dient das Resilienzkonzept, welches die Fähigkeit beschreibt, trotz widriger Umstände eine gesunde Entwicklung zu durchlaufen.
Die Arbeit orientiert sich an folgender Forschungsfrage: Welche positiven, aber auch negativen Faktoren haben Einfluss auf die Resilienzentwicklung bei Jugendlichen in stationären Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe? Daraus ergibt sich ergänzend die Frage, wie pädagogische Fachkräfte die individuelle Resilienzentwicklung der Jugendlichen fördern können.
Drei Thesen strukturieren die Untersuchung: Erstens wird davon ausgegangen, dass die Resilienzentwicklung aufgrund biografischer Belastungen in stationären Settings besonders herausfordernd ist. Zweitens wird angenommen, dass die Beteiligung Jugendlicher an Entscheidungsprozessen ihre Selbstwirksamkeit stärkt und somit resilienzfördernd wirkt. Drittens wird die Hypothese vertreten, dass resiliente Jugendliche über stärkere soziale Kompetenzen und ein gefestigtes Selbstkonzept verfügen, was positive Entwicklungsverläufe begünstigt.
Die Relevanz des Themas wird auch durch aktuelle Daten unterstrichen: Im Jahr 2022 wurden über 66.000 Minderjährige in Deutschland in Obhut genommen – ein Anstieg von 40 % im Vergleich zum Vorjahr. Diese Zahlen verdeutlichen den wachsenden Bedarf an gezielter Resilienzförderung innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methodik
- Aufbau der Arbeit
- Theoretische Grundlagen
- Resilienz
- Salutogenese
- Das Köhärenzgefühl
- Entwicklung des Resilienzkonzepts
- Forschung zur Resilienz
- Zentrale Studien der Resilienzforschung
- Die Kauai-Längsschnittstudie
- Die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie
- Risiko- und Schutzfaktoren
- Das Risikofaktorenkonzept
- Klassifizierung der Risikofaktoren
- Zusammenfassung der Risikofaktoren
- Das Schutzfaktorenkonzept
- Klassifizierung der Schutzfaktoren
- Zusammenfassung der Schutzfaktoren
- Risiko- und Schutzfaktoren im Jugendalter
- Besonderheiten im Jugendalter
- Sozialer und kultureller Kontext
- Entwicklungsaufgaben im Jugendalter
- Identitätsentwicklung
- Emotionale Entwicklung
- Kognitive Entwicklung
- Kritische Lebensereignisse
- Kinder und Jugendhilfe
- Hilfen zur Erziehung
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Formen der stationären Unterbringung
- Die stationäre Kinder- und Jugendhilfe
- Wohngruppen als Setting für die Jugendhilfe
- Strategien zur Resilienzförderung
- Die Shortlist bekannter Resilienzfaktoren
- Resilienzförderung in der Heimerziehung
- Schlüsselstrategien
- Rolle der pädagogischen Fachkraft
- Alltagspädagogik in den erzieherischen Hilfen
- Bildungsfunktion
- Strukturgebende Funktion
- Bindung durch Beziehung
- Protektive Faktoren
- Selbst- und Fremdwahrnehmung
- Selbstwirksamkeit
- Soziale Kompetenz
- Selbstregulation
- Problemlösefähigkeiten
- Aktive Bewältigungskompetenzen/Umgang mit Stress
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Faktoren, die zur Entwicklung von Resilienz bei Jugendlichen in stationären Wohngruppen beitragen. Die Arbeit zielt darauf ab, positive und negative Einflussfaktoren auf die Resilienzentwicklung zu identifizieren und aufzuzeigen, wie pädagogische Fachkräfte die Resilienz gezielt stärken können. Resilienz wird dabei als dynamischer Prozess verstanden, der durch die Interaktion zwischen Individuum und Umwelt geprägt ist.
- Resilienzentwicklung bei Jugendlichen in Wohngruppen
- Einfluss von Risiko- und Schutzfaktoren auf die Resilienz
- Rollen sozialpädagogischer Ansätze zur Resilienzstärkung
- Bedeutung fester Bezugspersonen für die Resilienzentwicklung
- Stärkung von Selbstwirksamkeit und sozialen Kompetenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Resilienz bei Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe ein. Sie beleuchtet die Herausforderungen, denen Jugendliche in diesem Kontext begegnen, und unterstreicht die Bedeutung von Resilienz als zentrale Ressource für eine positive Entwicklung. Der hohe Anstieg der Inobhutnahmen im Jahr 2022 wird hervorgehoben, was die Aktualität und Relevanz des Themas verdeutlicht. Der Autor beschreibt seine persönliche Motivation, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert Resilienz als dynamischen Prozess und beleuchtet die Konzepte der Salutogenese und des Köhärenzgefühls. Die Entwicklung des Resilienzkonzepts wird nachgezeichnet, und es werden wichtige Studien der Resilienzforschung vorgestellt, um ein umfassendes Verständnis der Thematik zu schaffen.
Forschung zur Resilienz: Dieser Abschnitt präsentiert zentrale Studien der Resilienzforschung, wie die Kauai-Längsschnittstudie und die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie. Diese Studien liefern wichtige Erkenntnisse über Risiko- und Schutzfaktoren und deren Einfluss auf die Resilienzentwicklung. Die Ergebnisse dieser Studien werden detailliert analysiert und in Bezug zueinander gesetzt, um ein umfassendes Bild der Forschungslandschaft zu zeichnen.
Risiko- und Schutzfaktoren: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Risikofaktoren- und dem Schutzfaktorenkonzept. Es werden verschiedene Klassifizierungen von Risiko- und Schutzfaktoren vorgestellt, und deren jeweilige Bedeutung für die Resilienzentwicklung wird detailliert erläutert. Die Zusammenfassung der Risiko- und Schutzfaktoren dient als Grundlage für die weitere Analyse im Kontext der Jugendhilfe.
Besonderheiten im Jugendalter: Dieses Kapitel beleuchtet die Besonderheiten des Jugendalters im Hinblick auf Resilienz. Es werden die sozialen und kulturellen Kontexte, die Entwicklungsaufgaben, die Identitätsentwicklung, die emotionale und kognitive Entwicklung sowie kritische Lebensereignisse im Jugendalter analysiert und deren Einfluss auf die Resilienzentwicklung detailliert beschrieben.
Kinder und Jugendhilfe: Das Kapitel behandelt die Kinder- und Jugendhilfe, ihre Hilfen zur Erziehung und die rechtlichen Rahmenbedingungen. Es beschreibt verschiedene Formen der stationären Unterbringung und geht insbesondere auf die stationäre Kinder- und Jugendhilfe und Wohngruppen als Setting ein. Die Besonderheiten der Wohngruppen im Kontext der Resilienzförderung werden hervorgehoben.
Strategien zur Resilienzförderung: Dieses Kapitel widmet sich Strategien zur Resilienzförderung, insbesondere der bekannten Shortlist an Resilienzfaktoren und der Resilienzförderung in der Heimerziehung. Schlüsselstrategien und die Rolle der pädagogischen Fachkraft werden analysiert. Die Bedeutung einer ressourcenorientierten Herangehensweise wird betont.
Alltagspädagogik in den erzieherischen Hilfen: Dieses Kapitel untersucht die Alltagspädagogik in der Jugendhilfe und deren Bedeutung für die Resilienzförderung. Es betrachtet die Bildungs- und Strukturfunktion der Alltagspädagogik und hebt die Bedeutung von Bindung durch Beziehungen und protektiven Faktoren wie Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenz, Selbstregulation und Problemlösefähigkeiten hervor. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der Konzepte in der pädagogischen Arbeit.
Schlüsselwörter
Resilienz, Jugendhilfe, Wohngruppen, Risiko- und Schutzfaktoren, Salutogenese, Köhärenzgefühl, Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenz, pädagogische Fachkräfte, positive Entwicklung, stationäre Unterbringung, Ressourcenorientierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt der Bachelorarbeit über Resilienz in Wohngruppen?
Die Bachelorarbeit untersucht die Resilienz von Jugendlichen in stationären Wohngruppen. Sie analysiert Risiko- und Schutzfaktoren, die die Resilienz beeinflussen, und beleuchtet die Rolle der pädagogischen Fachkräfte bei der Resilienzförderung.
Welche Themen werden in der Bachelorarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die Resilienzentwicklung bei Jugendlichen in Wohngruppen, den Einfluss von Risiko- und Schutzfaktoren, sozialpädagogische Ansätze zur Resilienzstärkung, die Bedeutung von Bezugspersonen und die Stärkung von Selbstwirksamkeit und sozialen Kompetenzen.
Was sind die theoretischen Grundlagen der Arbeit?
Die Arbeit basiert auf theoretischen Grundlagen wie dem Resilienzkonzept, der Salutogenese und dem Köhärenzgefühl. Sie betrachtet Resilienz als dynamischen Prozess.
Welche Studien zur Resilienz werden in der Arbeit behandelt?
Zentrale Studien wie die Kauai-Längsschnittstudie und die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie werden vorgestellt und analysiert.
Was sind Risiko- und Schutzfaktoren?
Die Arbeit befasst sich ausführlich mit dem Risikofaktoren- und Schutzfaktorenkonzept, klassifiziert diese Faktoren und erläutert deren Bedeutung für die Resilienzentwicklung.
Welche Besonderheiten des Jugendalters werden berücksichtigt?
Die Arbeit beleuchtet die sozialen und kulturellen Kontexte, Entwicklungsaufgaben, Identitätsentwicklung, emotionale und kognitive Entwicklung sowie kritische Lebensereignisse im Jugendalter und deren Einfluss auf die Resilienz.
Wie wird die Kinder- und Jugendhilfe in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Kinder- und Jugendhilfe, ihre Hilfen zur Erziehung, rechtliche Rahmenbedingungen und verschiedene Formen der stationären Unterbringung, insbesondere Wohngruppen.
Welche Strategien zur Resilienzförderung werden vorgestellt?
Die Arbeit widmet sich Strategien zur Resilienzförderung, insbesondere der Shortlist bekannter Resilienzfaktoren und der Resilienzförderung in der Heimerziehung. Schlüsselstrategien und die Rolle der pädagogischen Fachkraft werden analysiert.
Welche Rolle spielt die Alltagspädagogik?
Die Arbeit untersucht die Alltagspädagogik in der Jugendhilfe und deren Bedeutung für die Resilienzförderung. Sie betrachtet die Bildungs- und Strukturfunktion und hebt die Bedeutung von Bindung durch Beziehungen und protektiven Faktoren hervor.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Resilienz, Jugendhilfe, Wohngruppen, Risiko- und Schutzfaktoren, Salutogenese, Köhärenzgefühl, Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenz, pädagogische Fachkräfte, positive Entwicklung, stationäre Unterbringung, Ressourcenorientierung.
- Quote paper
- Pierre Herkert (Author), 2024, Resilienz im sozialpädagogischen Alltag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1576934