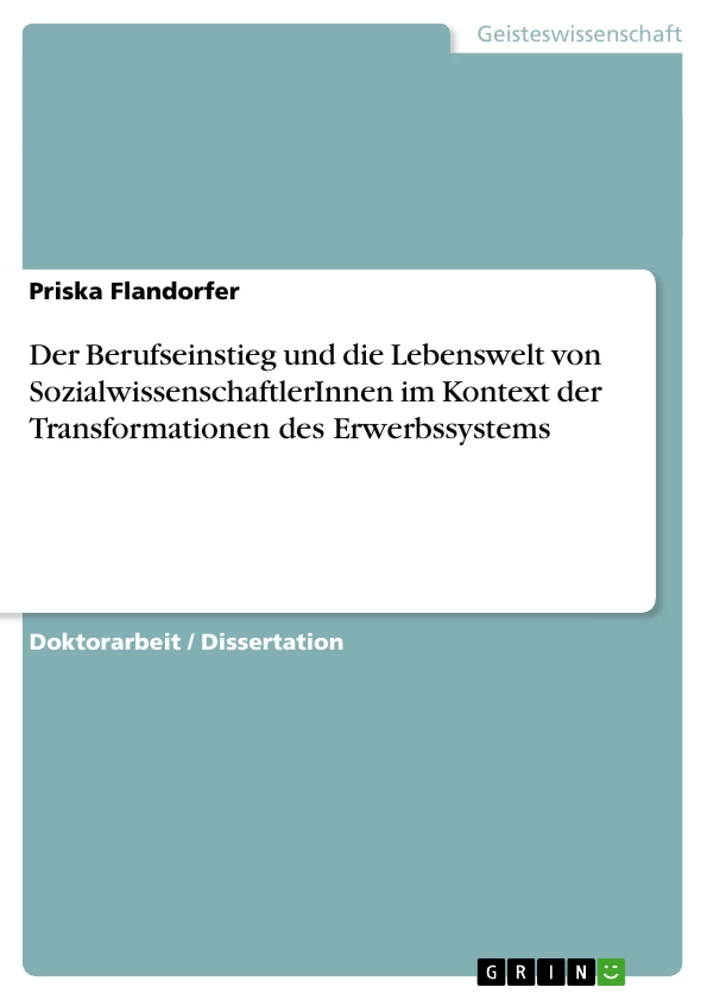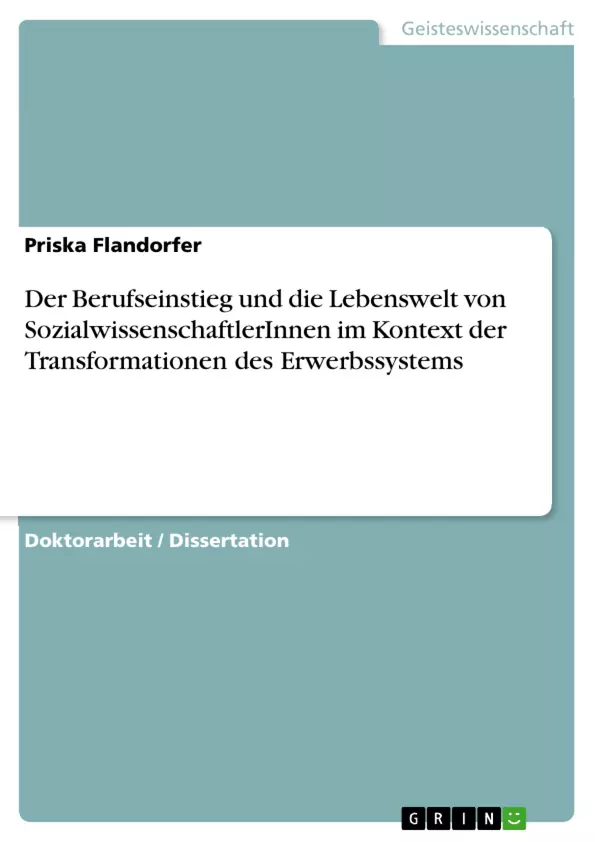Der Berufseinstieg sowie der berufliche Erfolg von SozialwissenschaftlerInnen ist hier Ausgangspunkt für eine qualitative Studie, die durch die Forschungstradition der Grounded Theory theoriegeleitet ist und sich narrativer Interviews zu Nutze macht, um die Lebenswelt von SozialwissenschaftlerInnen und im speziellen SoziologInnen, am Übergang vom Studium in den Beruf, zu untersuchen. Das moderne Erwerbssystem erfährt, in einer individualisierten Gesellschaft, Transformationen, die das Leben der AkademikerInnen beeinflussen und ihre Handlungsoptionen und subjektiven Aspirationen strukturieren. So kann der Berufseinstieg nicht per se als linear vorausgesetzt werden, denn die AbsolventInnen können teilweise, durch berufliche Tätigkeiten neben dem Studium, am Arbeitsmarkt integriert sein. Er kann sich als schwierig gestalten, wenn soziale Netzwerke nicht bestehen bzw. wenn die erworbenen Qualifikationen als nicht ausreichend empfunden werden, erfolgreich in den Arbeitsmarkt überzugehen. So können entweder Strategien gewählt werden, die die Beschäftigungsfähigkeit erhöhen bzw. Netzwerke aufgebaut werden, die eine Inklusion in Arbeitsfelder ermöglichen.
Der akademische Status, den die AbsolventInnen erworben haben bietet einen Zugang zu Positionen, der ohne einen formalen Studienabschluss nicht möglich wäre. Die spezifische sozialwissenschaftliche Fachkultur wird sichtbar, wenn das Studium realisiert wird und bereits zu Beginn wird wahrgenommen, dass sich die Fachrichtung über eine gemeinsame Kultur und Sprache auszeichnet. Der Professionalisierung der Soziologie wird aufgrund der empirischen Ergebnisse auch Beachtung geschenkt. Dass sich Transformationen im Erwerbssystem auch auf die persönlichen Aspirationen und Vorstellungen über Freizeit, Freundschaften und Familie auswirken ist hinsichtlich der theoretischen Verortung zu vermuten und wird ebenso anhand der empirischen Ergebnisse erörtert. Die Lebenswelt von SozialwissenschaftlerInnen im Kontext der Transformationen der Erwerbsgesellschaft, steht mit den Chancen und Risiken der individualisierten Gesellschaft und ihrer pluralisierten Optionen im Zusammenhang.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau der Arbeit
- Teil 1: Theoretischer Rahmen
- Transformationen im Erwerbssystem
- Prekarisierung
- Subjektive Verarbeitungsmechanismen prekärer Beschäftigung
- Exklusion und soziale Unsicherheit
- WissensarbeiterInnen
- Von der universitären Sozialisation zur professionellen Identität
- Bildung als multidimensionaler Faktor des Wissenserwerbs
- Die Studienwahlmotivation als rationale und subjektive Entscheidung
- Das universitäre System zwischen Ökonomisierung und Reproduktion
- Die universitäre Sozialisation: Vom Fachhabitus zum Homo Academicus
- Akademischer Wissenserwerb und Kompetenzentwicklung
- Der Bildungsabschluss im Zusammenhang mit Employability
- Die Relevanz von Sozialkapital und sozialen Netzwerken
- Die berufsbiographische Sozialisation und der berufliche Habitus
- Vom biographischen (Erfahrungs-)Wissen zur professionellen Identität
- Biographiegestaltung im Kontext der Erwerbstätigkeit
- Exkurs: Biographie und narrative Kompetenz
- Individualisierung im Zusammenhang mit vielfältigen biographischen Gestaltungsmodi
- Selbstsozialisation und Selbstreflexion: Das Individuum als biographischer Akteur
- Die Subjektivierung von Arbeit und ihre Auswirkungen auf die geschlechtsspezifische Lebensführung
- Weibliche Lebensplanung in Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Pluralisierte Familienformen und biographische Ambivalenzen
- Das Konzept der Work-Life-Balance als Faktor der Lebensqualität
- Der Berufseinstieg von SozialwissenschaftlerInnen
- Befunde zum Berufseinstieg von SozialwissenschaftlerInnen allgemein
- Soziologie als Studium und im Beruf - empirische und theoretische Implikationen
- Allgemeine Situation vor dem Studium
- Motivlagen, Eigenschaften der Studierenden und Relevanz der Studieninhalte
- Nützliche erworbene fachliche und soziale Kompetenzen
- Quellen der Arbeitssuche, Beschäftigungsverhältnisse und berufliche Situation
- Arbeitsbereiche und Fach-Adäquanz
- Aspekte der Professionalisierunng
- Professionalisierungschancen der Soziologie
- Fazit: Biographiegestaltung von SozialwissenschaftlerInnen als selbstreflexive Herausforderung im Kontext von Statuspassagen
- Teil 2: Forschungsdesign und Methodologie
- Theoretisches Sampling
- Eigenschaften und Auswahl des Samples
- Sampling-Strategien
- Exkurs: Forschung im eigenen Feld
- Erhebungs- und Auswertungsverfahren
- Das narrative Interview
- Transkription und Einsatz qualitativer Analysesoftware
- Abgrenzung der formalen Netzwerke von den analytischen Netzwerken
- Analysemethoden
- Grounded Theory
- Narrationsanalyse
- Die qualitative Netzwerkanalyse
- Diskussion: Limitationen und Qualitätskriterien der Methode
- Teil 3: Empirische Ergebnisse
- Beruflicher Sozialisationsprozess
- Biographische Entscheidungen und Ressourcen
- Studienwahlprozess und Motive
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation untersucht die Berufseinstiegs- und Lebenswelt von SozialwissenschaftlerInnen im Kontext der Transformationen des Erwerbssystems. Sie will verstehen, wie sich die individuellen Lebensentwürfe und die beruflichen Karrieren im Spannungsfeld zwischen prekären Arbeitsbedingungen, der universitären Sozialisation und der gesellschaftlichen Individualisierung entwickeln.
- Die Prekarisierung des Arbeitsmarktes und ihre Auswirkungen auf den Berufseinstieg von SozialwissenschaftlerInnen
- Die Bedeutung der universitären Sozialisation und die Herausbildung der professionellen Identität
- Biographiegestaltung im Kontext der Erwerbstätigkeit und die Herausforderungen der Work-Life-Balance
- Die Rolle von Sozialkapital und sozialen Netzwerken beim Berufseinstieg
- Die Bedeutung qualitativer Forschungsmethoden zur Erforschung der subjektiven Lebenserfahrungen von SozialwissenschaftlerInnen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Im ersten Teil wird der theoretische Rahmen der Dissertation gelegt. Dieser umfasst die Transformationen des Erwerbssystems, die Prekarisierung der Arbeitsbedingungen und die Auswirkungen auf die Lebenswelt von WissensarbeiterInnen. Außerdem werden die universitäre Sozialisation und die Herausbildung der professionellen Identität behandelt. Der zweite Teil widmet sich dem Forschungsdesign und der Methodologie. Hier werden das theoretische Sampling, die qualitative Datengewinnung durch narrative Interviews und die Anwendung der Grounded Theory sowie der narrativen und qualitativen Netzwerkanalyse erläutert. Im dritten Teil werden die empirischen Ergebnisse der Forschungsarbeit dargestellt. Der Fokus liegt auf dem beruflichen Sozialisationsprozess, den biographischen Entscheidungen und Ressourcen, den Studienwahlmotiven und den Herausforderungen im Berufseinstieg.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Berufseinstieg, Lebenswelt, SozialwissenschaftlerInnen, Transformationen des Erwerbssystems, Prekarisierung, universitäre Sozialisation, professionelle Identität, Biographiegestaltung, Work-Life-Balance, qualitative Forschung, narrative Interviews, Grounded Theory, Netzwerkanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Wie gestaltet sich der Berufseinstieg für Sozialwissenschaftler heute?
Der Berufseinstieg ist oft nicht mehr linear. Er wird durch Transformationen im Erwerbssystem wie Prekarisierung und die Notwendigkeit von Netzwerken geprägt, was den Übergang vom Studium in den Beruf komplex macht.
Was bedeutet "Prekarisierung" für Akademiker?
Prekarisierung bezeichnet unsichere Beschäftigungsverhältnisse, wie befristete Verträge oder niedrige Entlohnung, die trotz hoher Qualifikation das Risiko sozialer Unsicherheit bergen.
Welche Rolle spielen soziale Netzwerke bei der Jobsuche?
Sozialkapital und Netzwerke sind oft entscheidend für die Inklusion in relevante Arbeitsfelder, insbesondere wenn formale Qualifikationen allein nicht ausreichen, um sich am Markt zu positionieren.
Was ist die "Work-Life-Balance" im Kontext von Sozialwissenschaftlern?
Es beschreibt die Herausforderung, berufliche Aspirationen mit persönlichen Vorstellungen von Familie und Freizeit in Einklang zu bringen, was durch die Subjektivierung von Arbeit erschwert wird.
Welche Methode wurde für die Studie verwendet?
Die Untersuchung nutzt die Grounded Theory und narrative Interviews, um die subjektiven Lebenswelten und Erfahrungen der Absolventen qualitativ zu erfassen.
- Citar trabajo
- Dr. Priska Flandorfer (Autor), 2010, Der Berufseinstieg und die Lebenswelt von SozialwissenschaftlerInnen im Kontext der Transformationen des Erwerbssystems, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157727