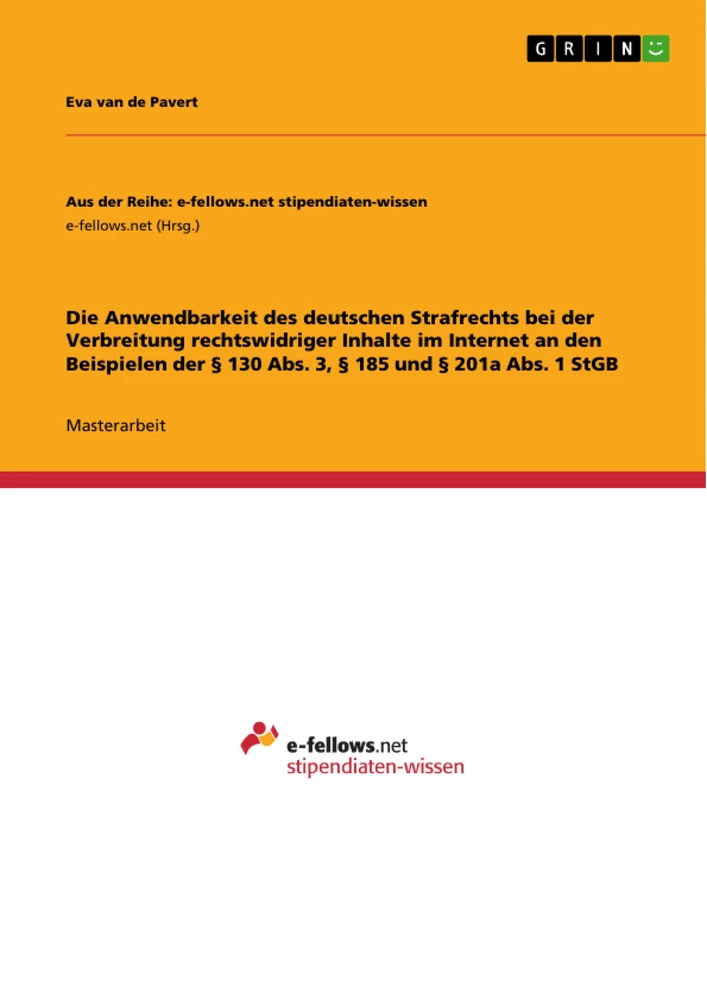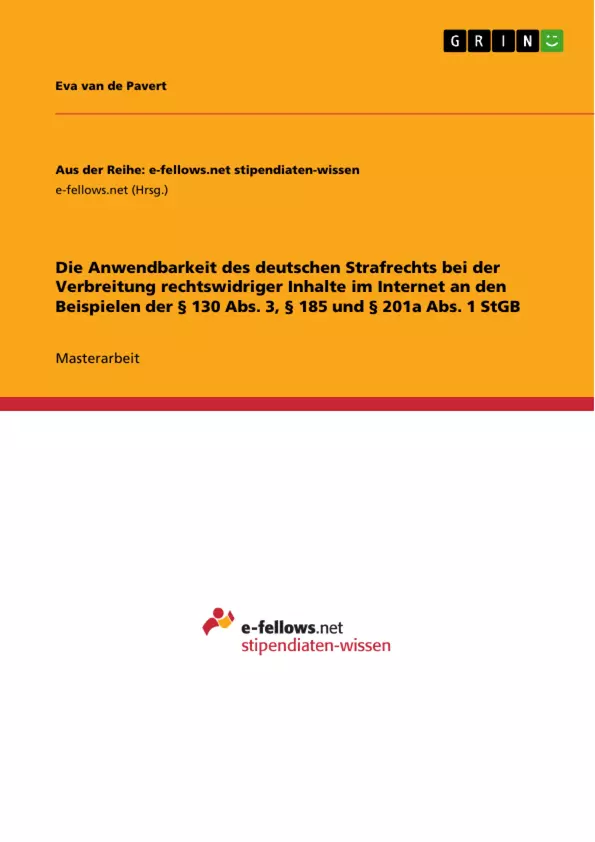Die Arbeit beschäftigt sich vorliegend damit, ob und inwieweit deutsches Strafrecht auf Internetsachverhalte aus der gesamten Welt anwendbar ist und nennt eigene Einschränkungsvorschläge des deutschen Strafanwendungsrechts.
Durch die globale Vernetzung mittels Internet ergibt sich für das deutsche Strafrecht eine unerwartet große Erweiterung auf Internetsachverhalte aus der gesamten Welt. So kann es regelmäßig passieren, dass für eine Beleidigung in einem Internetforum vom anderen Ende der Welt aus, plötzlich § 185 StGB Anwendung findet.
In der Arbeit wird die Anwendung des deutschen Strafrechts auf Internetsachverhalte anhand der Strafnormen der §§ 130 III, 185 und 201 a I StGB anschaulich dargelegt. Am Ende der Arbeit wird ein zeitgemäßer Lösungsvorschlag zur Eindämmung des deutschen Strafanwendungsrechts vorgetragen.
Die Arbeit folgt folgendem chronologischem Aufbau:
§ 1 Erläuterung zur Begrifflichkeit des Internetstrafrechts und Statistiken zur Brandaktualität und der Weite des Phänomens der Begehung von Straftaten im Internet.
§ 2 Die Besonderheiten der Strafparagraphen (uA der Volksverhetzung und Beleidigung) werden spezifisch im Kontext des Internets beschrieben. Für vertiefende Hinweise findet man verweisende Quellenangaben.
§ 3 Nun folgt der Hauptteil: Das deutsche Strafanwendungsrecht und dessen Anwendungsprobleme werden im Kontext des Internetstrafrechts dargelegt, dies chronologisch und vor allem anhand der ausgewählten Strafnormen veranschaulicht. Am Ende der Arbeit folgt ein Lösungsvorschlag zur Eindämmung des deutschen Strafanwendungsrechts. Neueste Rechtsprechung (Stand: Ende 2024) wurde eingearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Rechtsgrundlagen
- Kapitel 3: Fallbeispiele
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts auf die Verbreitung rechtswidriger Inhalte im Internet. Sie analysiert, wie effektiv bestehende Gesetze wie § 130 Abs. 3, § 185 und § 201a Abs. 1 StGB gegen diese Delikte vorgehen können. Die Arbeit konzentriert sich auf die Herausforderungen der Strafverfolgung im digitalen Raum.
- Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts im Internet
- Analyse von § 130 Abs. 3, § 185 und § 201a Abs. 1 StGB
- Herausforderungen der Strafverfolgung im digitalen Kontext
- Fallbeispiele rechtswidriger Online-Inhalte
- Effektivität bestehender Rechtsvorschriften
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung: Dieses einleitende Kapitel dürfte den Gegenstand der Arbeit, die Forschungsfrage und die Methodik vorstellen. Es wird die Relevanz der Thematik im Kontext der zunehmenden Verbreitung rechtswidriger Inhalte im Internet herausstellen und den Rahmen der Arbeit abstecken. Die Bedeutung der Untersuchung der Anwendbarkeit des Strafrechts im digitalen Raum wird hervorgehoben und die ausgewählten Paragraphen (§ 130 Abs. 3, § 185 und § 201a Abs. 1 StGB) werden als Gegenstand der Analyse eingeführt. Die Einleitung wird die zentralen Fragestellungen der Arbeit formulieren, die im weiteren Verlauf beantwortet werden sollen.
Kapitel 2: Rechtsgrundlagen: Dieses Kapitel wird eine detaillierte Analyse der relevanten Rechtsgrundlagen, insbesondere § 130 Abs. 3, § 185 und § 201a Abs. 1 StGB, bieten. Es werden die jeweiligen Tatbestände, ihre Voraussetzungen und die Rechtsprechung dazu eingehend untersucht. Hierbei dürfte es um die Auslegung der Paragraphen im Kontext der digitalen Verbreitung von Inhalten gehen, sowie die Herausforderungen bei der Definition von „Verbreitung“ und „öffentlich zugänglich machen“ im Internet. Möglicherweise werden auch internationale Rechtsaspekte und die Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden verschiedener Länder angesprochen. Das Kapitel wird die theoretischen Grundlagen für die Fallstudien im folgenden Kapitel legen.
Kapitel 3: Fallbeispiele: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Anwendung der im vorherigen Kapitel analysierten Rechtsgrundlagen auf konkrete Fallbeispiele der Verbreitung rechtswidriger Inhalte im Internet. Es wird sich wahrscheinlich mit verschiedenen Szenarien befassen, die die praktische Umsetzung der Paragraphen verdeutlichen. Die Fallbeispiele dürften verschiedene Formen rechtswidriger Inhalte wie Volksverhetzung, Beleidigung und üble Nachrede abdecken und zeigen, wie die Strafverfolgungsbehörden in der Praxis mit solchen Fällen umgehen. Die Analyse wird die Stärken und Schwächen der bestehenden Gesetze aufzeigen und die Notwendigkeit von Anpassungen oder Weiterentwicklungen beleuchten.
Schlüsselwörter
Deutsches Strafrecht, Internet, Rechtswidrige Inhalte, Cybercrime, § 130 Abs. 3 StGB, § 185 StGB, § 201a Abs. 1 StGB, Strafverfolgung, Digitale Medien, Volksverhetzung, Beleidigung, Üble Nachrede, Rechtsprechung.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit
Was ist der Hauptgegenstand dieser Masterarbeit?
Diese Masterarbeit untersucht die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts auf die Verbreitung rechtswidriger Inhalte im Internet. Sie analysiert die Effektivität bestehender Gesetze wie § 130 Abs. 3, § 185 und § 201a Abs. 1 StGB im Kampf gegen diese Delikte und konzentriert sich auf die Herausforderungen der Strafverfolgung im digitalen Raum.
Welche Rechtsgrundlagen werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert insbesondere § 130 Abs. 3 StGB (Volksverhetzung), § 185 StGB (Beleidigung) und § 201a Abs. 1 StGB (Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen).
Welche thematischen Schwerpunkte werden behandelt?
Die thematischen Schwerpunkte umfassen die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts im Internet, die Analyse der genannten Paragraphen, die Herausforderungen der Strafverfolgung im digitalen Kontext, Fallbeispiele rechtswidriger Online-Inhalte und die Effektivität bestehender Rechtsvorschriften.
Was beinhaltet Kapitel 1 (Einleitung)?
Kapitel 1 stellt den Gegenstand der Arbeit, die Forschungsfrage und die Methodik vor. Es betont die Relevanz der Thematik und steckt den Rahmen der Arbeit ab. Die Bedeutung der Untersuchung der Anwendbarkeit des Strafrechts im digitalen Raum wird hervorgehoben, und die ausgewählten Paragraphen werden als Gegenstand der Analyse eingeführt.
Was behandelt Kapitel 2 (Rechtsgrundlagen)?
Kapitel 2 bietet eine detaillierte Analyse der relevanten Rechtsgrundlagen, insbesondere § 130 Abs. 3, § 185 und § 201a Abs. 1 StGB. Es werden die jeweiligen Tatbestände, ihre Voraussetzungen und die Rechtsprechung dazu untersucht. Die Auslegung der Paragraphen im Kontext der digitalen Verbreitung von Inhalten und die Definition von „Verbreitung“ und „öffentlich zugänglich machen“ im Internet werden erörtert.
Was ist der Inhalt von Kapitel 3 (Fallbeispiele)?
Kapitel 3 konzentriert sich auf die Anwendung der analysierten Rechtsgrundlagen auf konkrete Fallbeispiele der Verbreitung rechtswidriger Inhalte im Internet. Es werden verschiedene Szenarien betrachtet, die die praktische Umsetzung der Paragraphen verdeutlichen. Die Fallbeispiele decken verschiedene Formen rechtswidriger Inhalte ab und zeigen, wie die Strafverfolgungsbehörden in der Praxis mit solchen Fällen umgehen.
Welche Schlüsselwörter sind für diese Arbeit relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Deutsches Strafrecht, Internet, Rechtswidrige Inhalte, Cybercrime, § 130 Abs. 3 StGB, § 185 StGB, § 201a Abs. 1 StGB, Strafverfolgung, Digitale Medien, Volksverhetzung, Beleidigung, Üble Nachrede, Rechtsprechung.
- Citation du texte
- Eva van de Pavert (Auteur), 2024, Die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts bei der Verbreitung rechtswidriger Inhalte im Internet an den Beispielen der § 130 Abs. 3, § 185 und § 201a Abs. 1 StGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1577287