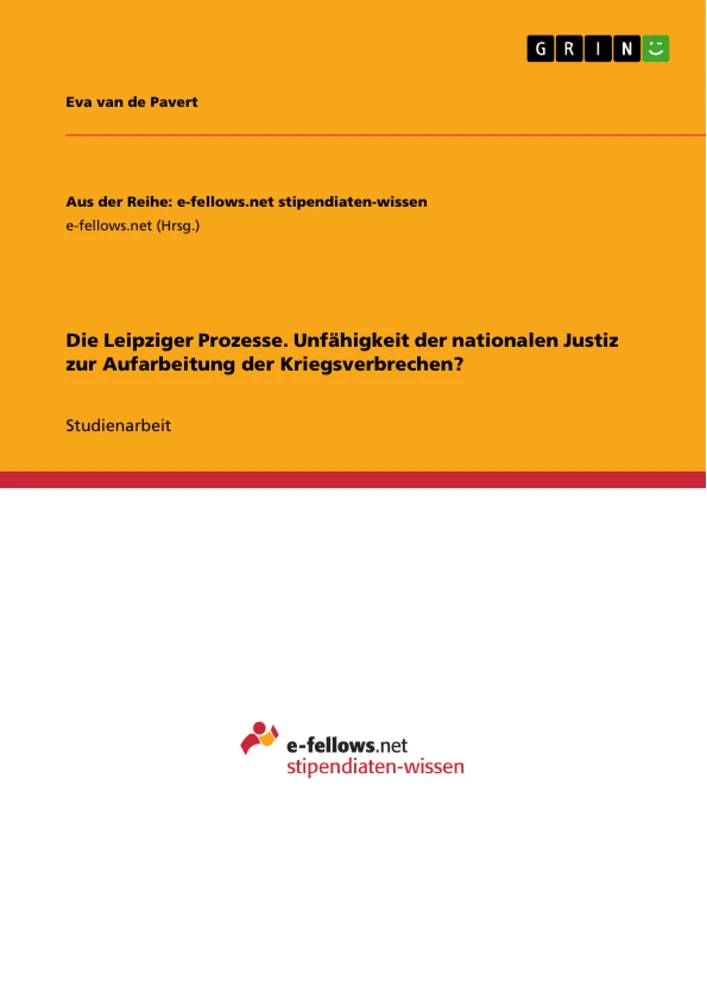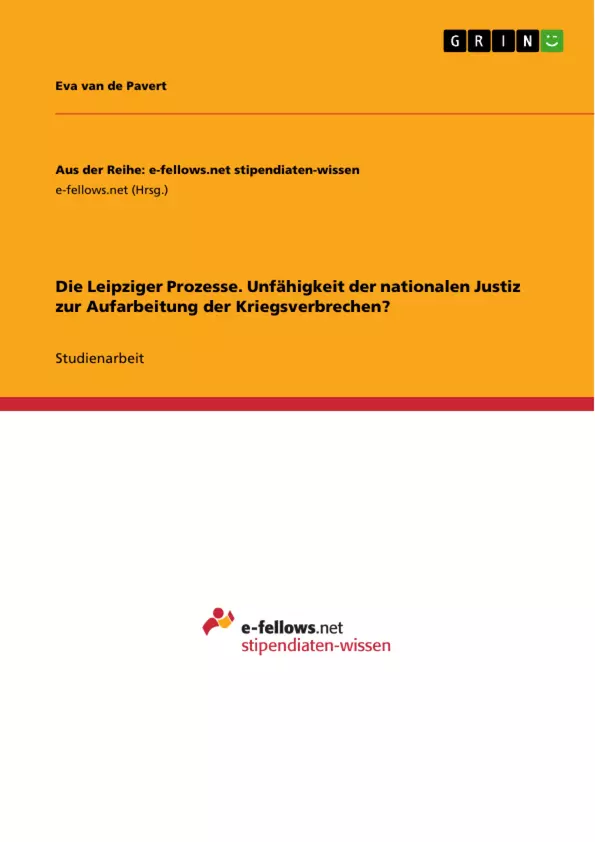Diese Arbeit zeigt die Farce der Aburteilung deutscher Kriegsverbrecher nach dem 1. Weltkrieg.
Das Fiasko der Verfolgung und Aburteilung deutscher Kriegsverbrecher durch deutsche Staatsanwälte (bzw. Reichsanwaltschaft) und Gerichte (bzw. Reichsgericht) wird anhand der Darlegung und Analyse strafrechtlicher Sachverhalte, staatsanwaltlicher Verfügungen sowie der Gerichtsurteile aufgezeigt. Dabei wird eine Gesamterhebung der Beschuldigten mit Urteilserlass erstellt und das deutsche Versagen in einer anschaulichen Endbilanz verdeutlicht.
Die Arbeit widmet sich zudem eingehend den damaligen Gesetzen zur Aburteilung der deutschen Kriegsverbrecher, der Begriffsdefinition zum Kriegsverbrechen und den damaligen völkerrechtlichen Besonderheiten.
Deutlich lässt sich in den Leipzigern Prozessen der deutsche Nationalstolz erkennen, der die Zeit zum 2. Weltkrieg deutlich vorgab und die völlig andere Vorgehensweise in den Nürnberger Prozessen maßgeblich prägte.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Der lange Weg bis zu den Leipziger Prozessen vor dem Reichsgericht
- I. Die Strafbarkeit der deutschen Kriegsverbrechen
- 1. Keine Amnestie im ersten Weltkrieg– Der Bestrafungswunsch der Alliierten als Kriegsziel
- 2. Der Begriff des Kriegsverbrechens vor dem 18.12.1919
- 3. Das Bestrafungsverlangen nach dem Friedensvertrag von Versailles und Auslieferungswidersetzen der Deutschen
- a) Der Friedensvertrag von Versailles
- b) Anbieten einer Kompromisslösung zur Verhinderung einer Auslieferung nach Art. 228 und die dafür notwendige Schaffung der rechtlichen Rahmenbedinungen
- 4. Einigung auf die deutsche Gerichtsbarkeit und Schaffen weiterer rechtlicher Voraussetzungen für die Aburteilung der Kriegsbeschuldigten
- I. Die Strafbarkeit der deutschen Kriegsverbrechen
- C. Die Verfahren des Reichsgerichts
- I. Der schleppende Beginn der Verfahren und ein erstes Urteil
- II. Die Verfahren anhand der Probeliste
- 1. Britische Probelistenfälle vom 23.05.1921-04.06.1921
- 2. Der belgische Probelistenfall vom 08.-11.06.1921
- 3. Die französischen Probelistenfälle vom 29.06-10.07.1921 und der neunte Fall, erneut ein britischer
- III. Zwischenbilanz, Einwände gegen die Aburteilung und weiteres Vorgehen des Deutschen Reichs in der Kriegsbeschuldigtenfrage
- 1. Beschluss des Alliierten Obersten Kriegsrats im August 1921 und Ergebnis der alliierten Juristenkommission
- 2. Die Einwände „Tu quoque“ und „nullum crimen, nulla poena sine lege“
- 3. Weiteres Vorgehen des Dt. Reichs in der Kriegsbeschuldigtenfrage
- 4. Strafvollzug und Flucht
- IV. Endbilanz der Leipziger Prozesse
- 1. Endbilanz der Leipziger Prozesse
- 2. Reaktionen und Bilanz der Einstellungen durch Reichsanwaltschaft und Reichsgericht
- V. Bedeutung der Prozesse für die Entwicklung des Transitional Justice-Konzepts
- D. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Leipziger Prozesse nach dem Ersten Weltkrieg und deren Bedeutung für die Entwicklung des internationalen Strafrechts und des Konzepts der Transitional Justice. Sie analysiert den langen Weg bis zur Durchführung der Prozesse, die Verfahren selbst und deren Ergebnisse, sowie die damit verbundenen rechtlichen und politischen Herausforderungen.
- Die Strafbarkeit deutscher Kriegsverbrechen nach dem Ersten Weltkrieg
- Der Verhandlungsprozess zwischen Deutschland und den Alliierten über die Gerichtsbarkeit
- Die Durchführung der Prozesse vor dem Reichsgericht und deren Ergebnisse
- Die rechtlichen Einwände gegen die Prozesse (z.B. "Tu quoque" und "nullum crimen, nulla poena sine lege")
- Die Bedeutung der Leipziger Prozesse für die Entwicklung des Konzepts der Transitional Justice
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und beschreibt den Fokus auf die Leipziger Prozesse nach dem Ersten Weltkrieg und deren Bedeutung für die Entwicklung des internationalen Strafrechts und des Konzepts der Transitional Justice. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die Forschungsfragen.
B. Der lange Weg bis zu den Leipziger Prozessen vor dem Reichsgericht: Dieses Kapitel beleuchtet den komplexen Prozess der juristischen Auseinandersetzung mit deutschen Kriegsverbrechen nach dem Ersten Weltkrieg. Es analysiert den Widerstand Deutschlands gegen die Auslieferung von Kriegsbeschuldigten und die anschließenden Verhandlungen mit den Alliierten, welche schließlich zur Einigung auf die Durchführung der Prozesse vor dem deutschen Reichsgericht führten. Besondere Aufmerksamkeit wird dem schwierigen Prozess der Definition von Kriegsverbrechen und der Schaffung der notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen gewidmet. Der Abschnitt beschreibt die Bemühungen um eine Kompromisslösung, um eine Auslieferung nach Artikel 228 des Versailler Vertrags zu vermeiden und gleichzeitig die juristische Aufarbeitung der Kriegsverbrechen zu ermöglichen.
C. Die Verfahren des Reichsgerichts: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Verfahren des Reichsgerichts in den Leipziger Prozessen. Es analysiert den schleppenden Beginn der Prozesse und die Auswahl der Fälle anhand der von den Alliierten vorgelegten Probelisten. Das Kapitel untersucht die einzelnen Prozesse, einschließlich der britischen, belgischen und französischen Fälle, und bewertet die Vorgehensweise des Reichsgerichts. Es geht auf die Zwischenbilanz ein, die Einwände gegen die Aburteilung (wie "Tu quoque" und "nullum crimen, nulla poena sine lege") und das weitere Vorgehen des Deutschen Reichs in der Frage der Kriegsbeschuldigten. Die Analyse umfasst auch die Reaktionen auf die Urteile und die Bewertung der Einstellungen durch Reichsanwaltschaft und Reichsgericht. Schließlich wird die Bedeutung der Prozesse für die Entwicklung des Transitional Justice-Konzepts untersucht.
Schlüsselwörter
Leipziger Prozesse, Kriegsverbrechen, Erster Weltkrieg, Versailler Vertrag, Transitional Justice, Reichsgericht, internationales Strafrecht, "Tu quoque", "nullum crimen, nulla poena sine lege", Alliierte, deutsche Gerichtsbarkeit.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Seminararbeit über die Leipziger Prozesse?
Die Seminararbeit untersucht die Leipziger Prozesse nach dem Ersten Weltkrieg und deren Bedeutung für die Entwicklung des internationalen Strafrechts und des Konzepts der Transitional Justice. Sie analysiert den Weg bis zur Durchführung der Prozesse, die Verfahren selbst und deren Ergebnisse, sowie die damit verbundenen rechtlichen und politischen Herausforderungen.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Strafbarkeit deutscher Kriegsverbrechen nach dem Ersten Weltkrieg, den Verhandlungsprozess zwischen Deutschland und den Alliierten, die Durchführung der Prozesse vor dem Reichsgericht, die rechtlichen Einwände gegen die Prozesse ("Tu quoque" und "nullum crimen, nulla poena sine lege") und die Bedeutung der Leipziger Prozesse für die Entwicklung des Konzepts der Transitional Justice.
Was beinhaltet das Kapitel "Der lange Weg bis zu den Leipziger Prozessen vor dem Reichsgericht"?
Dieses Kapitel beleuchtet den komplexen Prozess der juristischen Auseinandersetzung mit deutschen Kriegsverbrechen nach dem Ersten Weltkrieg. Es analysiert den Widerstand Deutschlands gegen die Auslieferung von Kriegsbeschuldigten und die anschließenden Verhandlungen mit den Alliierten, die zur Einigung auf die Durchführung der Prozesse vor dem deutschen Reichsgericht führten. Es wird der schwierige Prozess der Definition von Kriegsverbrechen und der Schaffung der notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen behandelt, sowie die Bemühungen um eine Kompromisslösung, um eine Auslieferung nach Artikel 228 des Versailler Vertrags zu vermeiden.
Was wird im Kapitel "Die Verfahren des Reichsgerichts" untersucht?
Dieses Kapitel beschreibt die Verfahren des Reichsgerichts in den Leipziger Prozessen detailliert. Es analysiert den Beginn der Prozesse und die Auswahl der Fälle anhand der von den Alliierten vorgelegten Probelisten. Es untersucht die einzelnen Prozesse, einschließlich der britischen, belgischen und französischen Fälle, und bewertet die Vorgehensweise des Reichsgerichts. Das Kapitel geht auf Einwände gegen die Aburteilung ein und untersucht die Bedeutung der Prozesse für die Entwicklung des Transitional Justice-Konzepts.
Welche Schlüsselwörter sind für die Leipziger Prozesse relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Leipziger Prozesse, Kriegsverbrechen, Erster Weltkrieg, Versailler Vertrag, Transitional Justice, Reichsgericht, internationales Strafrecht, "Tu quoque", "nullum crimen, nulla poena sine lege", Alliierte, deutsche Gerichtsbarkeit.
Welche Einwände gegen die Prozesse werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Einwände "Tu quoque" und "nullum crimen, nulla poena sine lege", die gegen die Aburteilung der deutschen Kriegsverbrechen vorgebracht wurden.
Was ist das Ziel der Leipziger Prozesse?
Das Ziel der Leipziger Prozesse war die juristische Aufarbeitung deutscher Kriegsverbrechen nach dem Ersten Weltkrieg im Rahmen des Versailler Vertrags und zur Befriedung der Alliierten.
- Quote paper
- Eva van de Pavert (Author), 2019, Die Leipziger Prozesse. Unfähigkeit der nationalen Justiz zur Aufarbeitung der Kriegsverbrechen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1577292