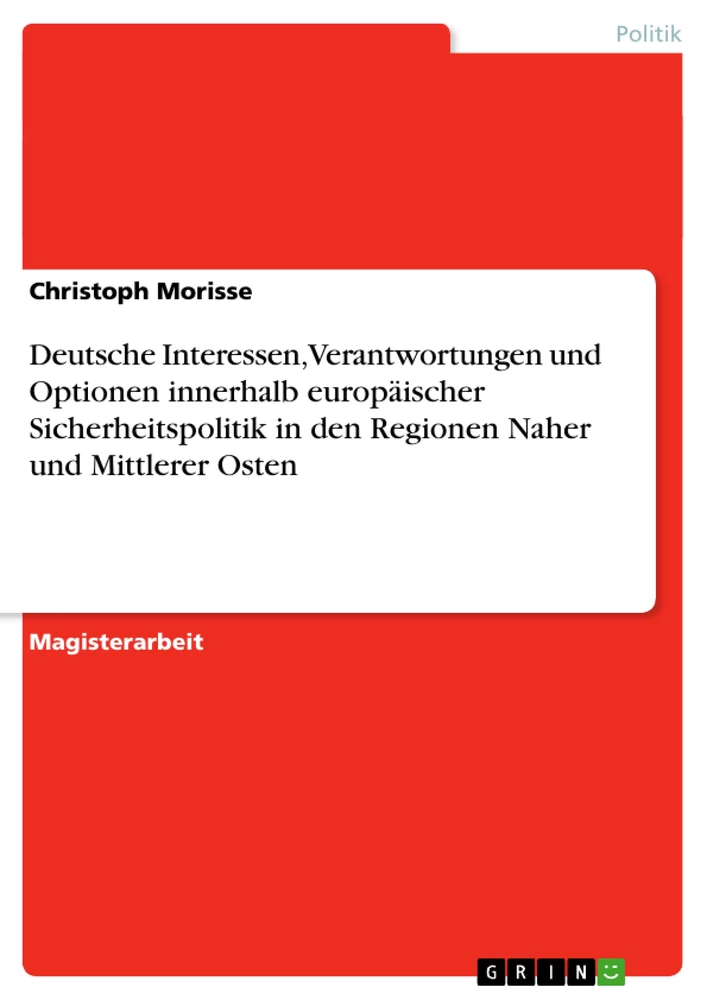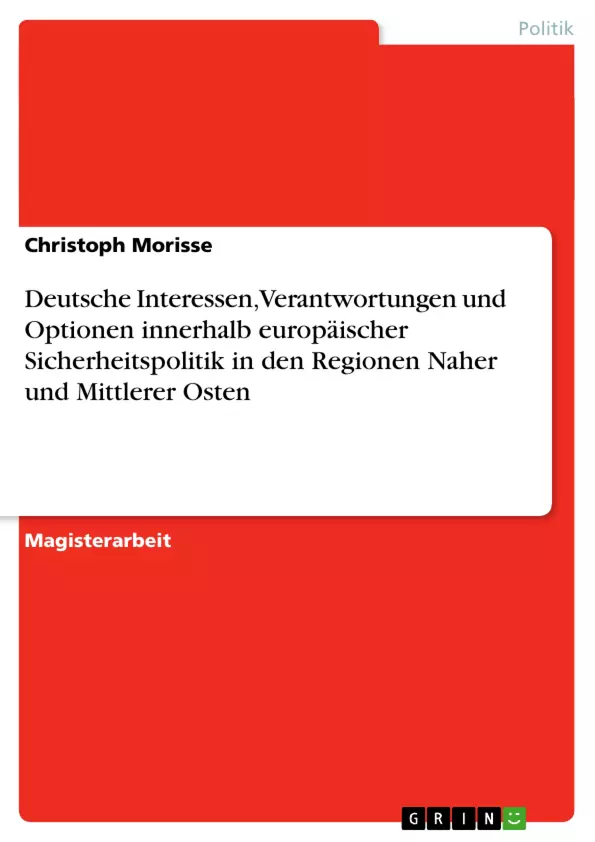Vor knapp einem Jahr deutete Bundeskanzler Schröder an, dass die Bundeswehr im Rahmen einer UN-Friedensregelung im Nahen Osten eingesetzt werden könnte.1 Die Presse titelte einen Tag später kommentierend ′Tabubruch′, ′historische Ignoranz′ und ′deplatziertes Wahlkampfkalkül′. Die Opposition sprach von ′befremdlichen Äußerungen′, ′spekulativer Diskussion′ und ′Schaumschlägerei.′ Aber auch Javier Solana antwortete im letzten Jahr positiv auf die Interviewfrage, ob er sich „ernsthaft deutsche Soldaten an einer israelischen Grenze vorstellen könne“2: „Ich kann mir viel vorstellen. Als NATO-Chef bat ich 1996 bei Bundeskanzler Kohl vergeblich um deutsche Truppen für den Balkan. Nur wenig später kommandierte ein Deutscher die Schutztruppe im Kosovo. Geschichte verändert sich rasend schnell.“3 Für die schnelle Entwicklung in der internationalen Sicherheitspolitik spricht, dass Kanzler Schröder und Außenminister Fischer schon mehr Auslandseinsätze der Bundeswehr zu verantworten haben als alle anderen deutschen Regierungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Zwar ist die extreme Vorstellung von deutschen Soldaten auf Patrouillie in Israel in der Tat befremdlich und wenig realistisch. Aber Ereignisse wie das Ende des Kalten Krieges, die Stagnation im nahöstlichen Friedensprozess und die zweite Intifada, die Anschläge vom 11. September 2001, der ′Kampf gegen den Terror′ und nicht zuletzt die aktuelle Irak-Krise sind Anlässe, um in Deutschland und Europa über langfristige sicherheitspolitische Konzepte für die Großregion Naher und Mittlerer Osten nachzudenken. Diese Untersuchung soll ein Beitrag zur Diskussion um die Neuausrichtung deutscher Sicherheitspolitik im Nahen und Mittleren Osten nach dem Ende der Bipolarität sein. Die Ergebnisse der Bestimmung von ′deutschen Interessen, Verantwortungen und Optionen innerhalb europäischer Sicherheitspolitik in den Regionen Naher und Mittlerer Osten′ könnten in außen- und sicherheitspolitische Konzepte, die sich an deutschen Interessen orientieren wollen, einfließen. Die Zeit nach dem Ende der Bipolarität ist der Betrachtungszeitraum dieser Arbeit. Doch bei der Untersuchung der deutschen und europäischen Nahostpolitik auf bilateraler und multilateraler Ebene musste der Betrachtungszeitraum für die Analyse von Verlauf und Entwicklung punktuell ausgedehnt werden, um Zusammenhänge und Konstanten besser darstellen und erklären zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Deutsche Interessen in der Außen- und Sicherheitspolitik
- 1.1. Begriffsbestimmung
- 1.1.1. Prämissen der Begriffsbestimmung
- 1.1.2. Schwierigkeiten mit dem Begriff 'deutsche Interessen'
- 1.1.3. Warum deutsche Interessen definieren?
- 1.1.4. Interessen nach Prioritäten geordnet
- 1.2. Zwei vitale Schwerpunkte der deutschen Interessen
- 1.2.1. Deutschlands als mächtiger Akteur im internationalem Rahmen
- 1.2.2. Exportnation im westlichen Interdependenzsystem
- 1.2.3. Analyseschema 'Systemstabilität und Exportwirtschaft'
- 1.3. Artikulation der Interessen in der deutschen Sicherheitspolitik
- 1.3.1. Verteidigungspolitische Richtlinien 1992
- 1.3.2. Weißbuch 1994
- 1.3.3. Bericht der Bundeswehrkommission 2000
- 2. Deutsche Nah- und Mittelostpolitik im europäischen Rahmen
- 2.1. Begriffsbestimmung 'Naher und Mittlerer Osten'
- 2.2. Verlauf der deutschen Nah- und Mittelostpolitik
- 2.2.1. Prämissen seit 1945
- 2.2.2. Phase der 'Wiedergutmachung'
- 2.2.3. Phase der Annäherung
- 2.2.4. Deutsches Dilemma: Rüstungsexporte
- 2.2.5. Neue Chancen nach der Bipolarität
- 2.2.6. Übergeordnete Interessen dominieren deutsche Nahostpolitik
- 3. Die Multilaterale Ebene: Die Entwicklung der europäischen Nah- und Mittelostpolitik
- 3.1. Methodische Überlegungen
- 3.2. Europäische Uneinigkeit in frühen Phasen
- 3.3. Europäische und arabische Staaten im Dialog
- 3.4. Dilemma der europäischen Nahostpolitik
- 3.5. Grundlegende europäische Erklärung von Venedig
- 3.6. Unterentwickelte Beziehungen zur Golfregion
- 3.7. Nicht-Beziehungen zum Iran und zum Irak
- 3.8. Barcelona-Prozess ohne sicherheitspolitische Erfolge
- 3.9. Moratinos' Aktionismus
- 3.10. 'Berliner Erklärung' kommt Arafat zuvor
- 3.11. Symbolische Beteiligung Solanas
- 3.12. Nach den Anschlägen: 'Nahost-Quartett'
- 4. Die Bilaterale Ebene: Deutschlands Beziehungen zu ausgewählten Staaten der Region
- 4.1. Zwei Vorzeichen der bilateralen Beziehungen
- 4.2. Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde (PA)
- 4.2.1. Deutsche Verantwortung gegenüber Israel
- 4.2.2. Keine deutschen Sicherheitsgarantien
- 4.2.3. Deutsch-Israelische Zusammenarbeit
- 4.2.4. Unfreiwillige Vermittlerrolle
- 4.2.5. Dilemmata
- 4.2.6. Drei Problemkreise
- 4.3. Beziehungen zur Türkei
- 4.3.1. Fünf Problemfelder
- 4.3.2. Türkei zwischen den Interessen
- 4.3.3. Deutsche Waffen für türkisches Militär
- 4.4. Deutsch-Iranische Low-Level-Beziehung
- 4.5. Irak
- 5. Sicherheitspolitische Herausforderungen
- 5.1. Prämissen der Bedrohungsanalyse
- 5.2. Risiko der unterschiedlichen Perzeption im Bündnis
- 5.3. Mögliche Bedrohung durch Proliferation
- 5.3.1. Proliferationsdynamik durch den Nahost-Konflikt
- 5.3.2. Wettbewerb um regionale Vormachtstellung
- 5.3.3. Proliferation als Problemlösung
- 5.4. Bedrohung durch Terrorismus
- 5.4.1. Zerreißproben im 'Krieg gegen den Terror'
- 5.4.2. Terrorismus und Massenvernichtungswaffen
- 5.4.3. Terrorismus und der Nahost-Konflikt
- Identifizierung der Interessen Deutschlands im Nahen und Mittleren Osten
- Analyse der deutschen Verantwortungen in der Region
- Bewertung der Handlungsoptionen Deutschlands im europäischen Kontext
- Beurteilung der sicherheitspolitischen Herausforderungen für Deutschland und Europa
- Entwicklung von Empfehlungen für die deutsche Sicherheitspolitik im Nahen und Mittleren Osten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die deutsche Sicherheitspolitik im Nahen und Mittleren Osten nach dem Ende der Bipolarität und untersucht dabei, inwiefern sich die Bundesrepublik in den Kontext der europäischen Sicherheitspolitik einordnen lässt. Sie befasst sich mit der Frage nach den Interessen Deutschlands in der Region, den daraus entstehenden Verantwortungen und den Handlungsoptionen, die sich für die Bundesrepublik im Rahmen der europäischen Sicherheitspolitik ergeben.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer detaillierten Analyse der deutschen Interessen in der Außen- und Sicherheitspolitik. Dabei wird der Begriff 'deutsche Interessen' definiert und die Schwierigkeiten, die sich bei der Bestimmung von Interessen ergeben, beleuchtet. Im Anschluss werden zwei vitale Schwerpunkte der deutschen Interessen identifiziert: Deutschlands Rolle als mächtiger Akteur im internationalen Rahmen und die Bedeutung der deutschen Exportwirtschaft. Die Artikulation dieser Interessen in der deutschen Sicherheitspolitik wird anhand der Verteidigungspolitischen Richtlinien von 1992, dem Weißbuch von 1994 und dem Bericht der Bundeswehrkommission von 2000 untersucht. Das zweite Kapitel befasst sich mit der deutschen Nah- und Mittelostpolitik im europäischen Rahmen. Es wird der Begriff 'Naher und Mittlerer Osten' definiert und der Verlauf der deutschen Nahostpolitik seit 1945 dargestellt. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Entwicklung der deutschen Nahostpolitik nach dem Ende des Kalten Krieges gelegt.
Das dritte Kapitel widmet sich der multilateralen Ebene der europäischen Nah- und Mittelostpolitik. Es wird die Entwicklung der europäischen Nahostpolitik von den frühen Phasen der Uneinigkeit hin zu einer gemeinsamen Position untersucht. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der Grundlegenden Europäischen Erklärung von Venedig und dem Barcelona-Prozess gewidmet. Im vierten Kapitel werden die bilateralen Beziehungen Deutschlands zu ausgewählten Staaten der Region, wie Israel, die Palästinensische Autonomiebehörde, die Türkei und der Iran, analysiert. Abschließend werden im fünften Kapitel die sicherheitspolitischen Herausforderungen, denen sich Deutschland und Europa im Nahen und Mittleren Osten gegenübersehen, betrachtet. Dabei werden die Bedrohungen durch Proliferation, Terrorismus und regionale Konflikte in den Mittelpunkt gerückt.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die deutsche Sicherheitspolitik, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten. Die zentralen Schlüsselwörter sind dabei: deutsche Interessen, Verantwortungen und Optionen innerhalb der europäischen Sicherheitspolitik, Nahost-Konflikt, Proliferation, Terrorismus, regionale Konflikte, Exportwirtschaft, Systemstabilität, multilaterale und bilaterale Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Kerninteressen Deutschlands im Nahen Osten?
Zentrale Interessen sind die Systemstabilität in der Region, die Sicherung von Exportwegen und die besondere historische Verantwortung gegenüber Israel.
Könnten deutsche Soldaten in Israel eingesetzt werden?
Obwohl dies politisch oft als Tabubruch gilt, wird die Diskussion über deutsche Beiträge zu UN-Friedensregelungen im Rahmen europäischer Sicherheitspolitik geführt.
Was ist der Barcelona-Prozess?
Es ist eine Partnerschaft zwischen der EU und den Mittelmeer-Anrainerstaaten, die auf wirtschaftliche Zusammenarbeit und politische Stabilität zielt, jedoch im Sicherheitsbereich oft als wenig erfolgreich gilt.
Welche Rolle spielt die Proliferation von Massenvernichtungswaffen?
Die Arbeit analysiert die Bedrohung durch die Verbreitung von Waffen im Kontext regionaler Vormachtstellung und des Nahost-Konflikts.
Wie hat sich die deutsche Sicherheitspolitik seit 1945 gewandelt?
Von einer Phase der reinen Wiedergutmachung hin zu einer aktiven Rolle als mächtiger Akteur in internationalen Bündnissen mit zunehmenden Auslandseinsätzen.
- Citar trabajo
- Christoph Morisse (Autor), 2003, Deutsche Interessen, Verantwortungen und Optionen innerhalb europäischer Sicherheitspolitik in den Regionen Naher und Mittlerer Osten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15778