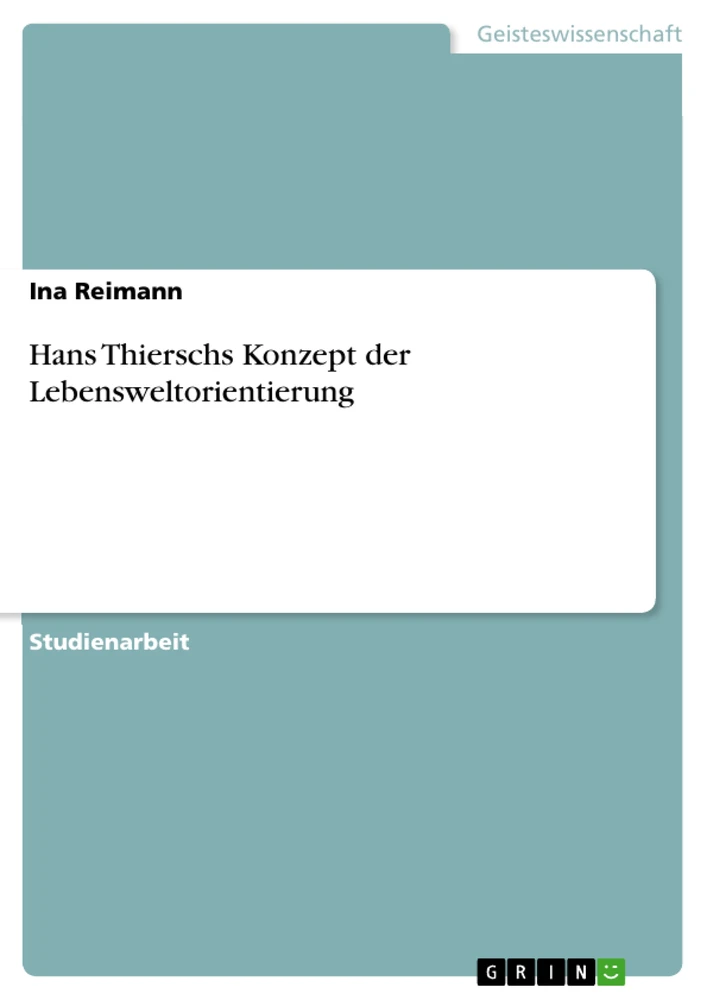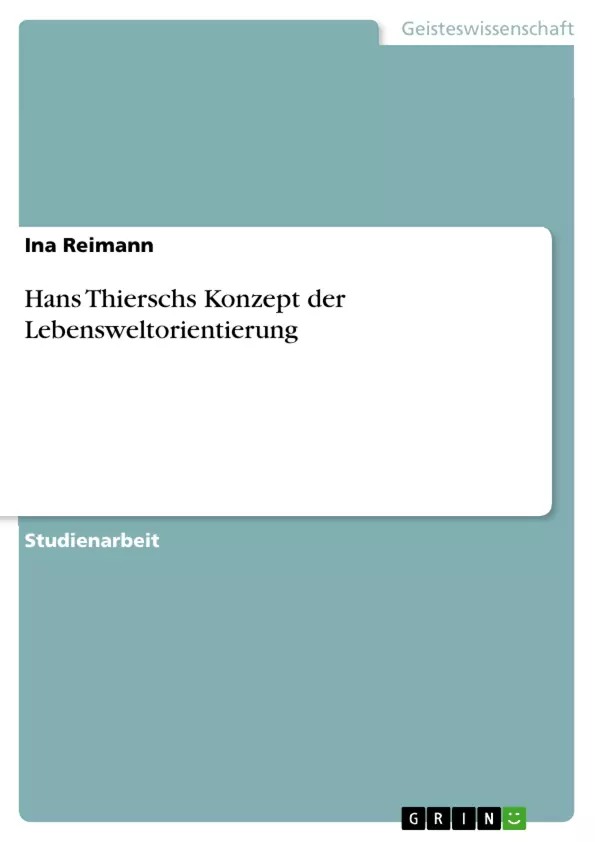In der folgenden Arbeit beschäftige ich mich mit dem Konzept der Lebensweltorientierung von Hans Thiersch. Zu Beginn wird kurz der Lebenslauf von Hans Thiersch geschildert. Im zweiten Punkt geht es um die von ihm formulierte Theorie der Sozialpädagogik, welche mit der Lebensweltorientierung eng in Zusammenhang steht. Im weiteren Teil meiner Arbeit soll es dann um das Konzept der Lebensweltorientierung gehen, wobei ich zunächst die Entwicklung des Konzepts skizziere. Dann soll das Ziel dieses Konzepts dargestellt werden, um anschließend auf die Dimensionen und die Handlungsprinzipien der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit einzugehen. Schließlich soll dann die lebensweltorientierte Jugendhilfe in einzelnen Aspekten erläutert werden und die Arbeit zuletzt durch eine kurze Zusammenfassung abgerundet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hans Thiersch
- Theorie der Sozialpädagogik
- Das Konzept der Lebensweltorientierung
- Entwicklung des Konzepts
- Ziel der Lebensweltorientierung
- Dimensionen der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
- Handlungsprinzipien der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
- Lebensweltorientierte Jugendhilfe
- Zusammenfassung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Lebensweltorientierung, wie es von Hans Thiersch entwickelt wurde. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des Konzepts, dessen Zielsetzung sowie die Dimensionen und Handlungsprinzipien der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit.
- Entwicklung des Konzepts der Lebensweltorientierung
- Die Zielsetzung der Lebensweltorientierung
- Dimensionen der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
- Handlungsprinzipien der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
- Die Rolle der Lebensweltorientierung in der Jugendhilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Struktur und den Inhalt der Arbeit. Sie skizziert die behandelten Themenbereiche und ihre Reihenfolge.
Hans Thiersch
Dieser Abschnitt stellt den Autor des Konzepts, Hans Thiersch, vor und skizziert seinen Lebenslauf und seine wichtigsten akademischen Stationen.
Theorie der Sozialpädagogik
Hier wird die von Hans Thiersch formulierte Theorie der Sozialpädagogik vorgestellt. Die fünf zentralen Dimensionen dieser Theorie werden erläutert und ihre Bedeutung für das Verständnis des Konzepts der Lebensweltorientierung hervorgehoben.
Das Konzept der Lebensweltorientierung
Dieser Abschnitt geht detailliert auf das Konzept der Lebensweltorientierung ein. Er beschreibt die Entwicklung des Konzepts, seine Zielsetzung und die wichtigsten Dimensionen und Handlungsprinzipien der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe und Fokusthemen der Arbeit sind: Lebensweltorientierung, Hans Thiersch, Theorie der Sozialpädagogik, Sozialarbeit, Jugendhilfe, Alltag, Selbsthilfe, Handlungsprinzipien, Dimensionen, Gesellschaftliche Funktionen, Professionalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Hans Thiersch unter „Lebensweltorientierung“?
Es ist ein Konzept der Sozialen Arbeit, das die individuellen Alltagserfahrungen und Bewältigungsstrategien der Klienten in den Mittelpunkt stellt.
Welche Ziele verfolgt die lebensweltorientierte Soziale Arbeit?
Ziel ist es, Menschen zur Selbsthilfe zu befähigen und ihre Lebensverhältnisse so zu gestalten, dass sie ihren Alltag erfolgreich bewältigen können.
Welche Handlungsprinzipien sind für Thiersch zentral?
Dazu gehören unter anderem Prävention, Alltagsnähe, Regionalisierung, Dezentralisierung und Integration.
Wie wird das Konzept in der Jugendhilfe angewendet?
In der Jugendhilfe bedeutet es, Hilfen nicht isoliert, sondern im sozialen Nahraum der Jugendlichen zu verankern und deren Lebensrealität ernst zu nehmen.
Welche Dimensionen umfasst Thierschs Theorie?
Die Arbeit erläutert fünf zentrale Dimensionen, die für das Verständnis der modernen Sozialpädagogik nach Thiersch essenziell sind.
- Quote paper
- Ina Reimann (Author), 2009, Hans Thierschs Konzept der Lebensweltorientierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157813