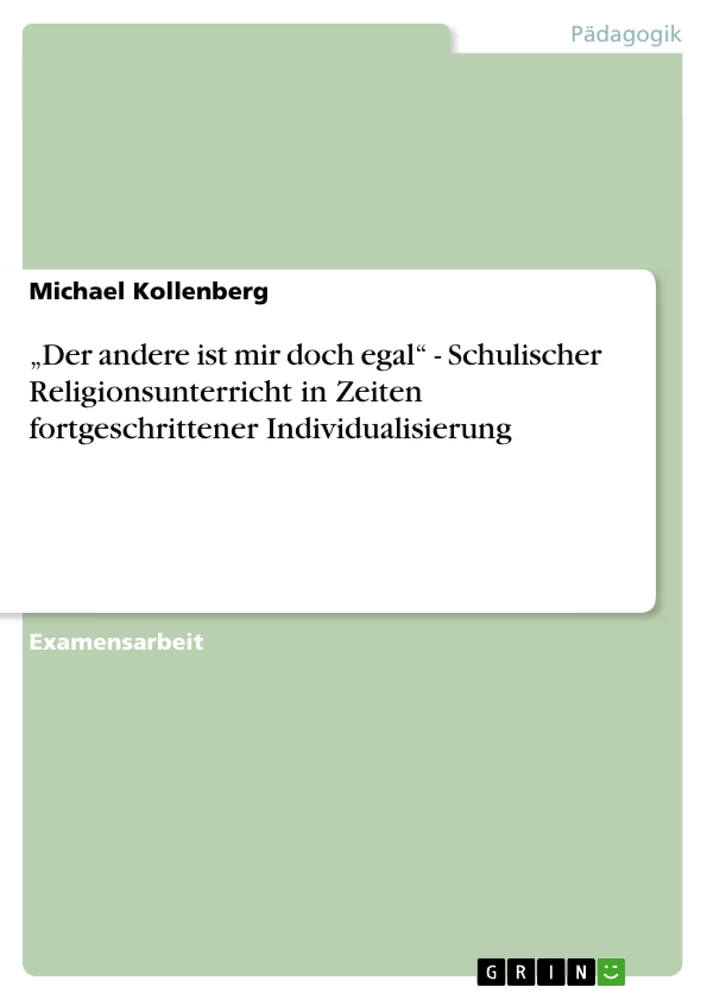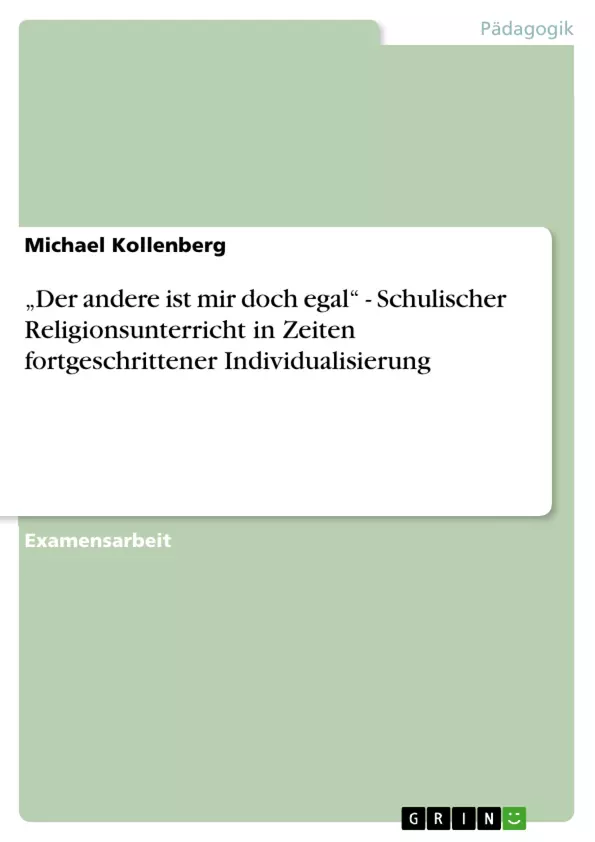Nach der Rückgabe einer Klassenarbeit bittet die Lehrerin einige Kinder, einem schwächeren Mitschüler nachmittags bei der Korrektur zu helfen. Aus der Klasse kommt keine Resonanz. Die Lehrerin fragt nach einer Erklärung. Mehr oder weniger gemurmelt heißt es von Seiten der Schüler: „Das ist uns doch egal, was mit dem ist.“ – So oder ähnlich könnte es sich heute in vielen Klassenräumen ereignen. Der Gedanke einander zu helfen, scheint vielfach nicht mehr sehr ausgeprägt. Viele Ältere sind der Auffassung, dass im Laufe der vergangenen Jahrzehnte Egoismus und Gleichgültigkeit
zugenommen hätten – früher sei alles besser gewesen, meinen sie: Man habe
sich gegenseitig unterstützt und dafür gesorgt, dass niemand auf der Strecke bliebe. Egoismus und Ellenbogenmentalität habe es damals in diesem Ausmaß nicht gegeben. Mit den modernen Zeiten habe sich alles zum Schlechteren verändert.
Liegen die Dinge wirklich so einfach? Kann man -zugegebenermaßen verkürzendsagen, die Moderne sei schuld an einer Entwicklung, die zur Individualisierung führt?
Und stimmt es, dass Individualisierung automatisch Entsolidarisierung nach sich zieht?
Es müsste gefragt werden, wodurch sich moderne Gesellschaften eigentlich auszeichnen und was genau der Begriff der ‚Modernität’ meint? Vordergründig scheint die Modernisierung eine Kennzeichnung der heutigen Zeit zu sein, die überwiegend positiv bewertet wird, wenn man sich beispielsweise technische oder wirtschaftliche Errungenschaften vor Augen führt.
Weil die fortschreitende Modernisierung des 20. und 21. Jahrhunderts in nahezu allen Bereichen der menschlichen Wirklichkeit zu grundlegenden Veränderungen führte, hat sie auch erhebliche gesellschaftliche Umbrüche erzeugt. Wer also die Situation unserer Kinder und Jugendlichen verstehen will, muss sich zunächst gründlich mit den Fragen der Modernisierung und ihren gesellschaftlichen Folgen beschäftigen. Betrachtet man die Schule als ein Spiegelbild der Gesellschaft, müssten deren Strömungen
und Akzentverschiebungen auch im Lehrbetrieb ankommen und dort berücksichtigt
werden. Stellt man in der Gesellschaft beispielsweise verstärkt aufkommende
Individualisierungstendenzen fest, dürfte auch in der Schule ein Rückgang des Zusammengehörigkeitsgefühls und des Sozialengagements zu verzeichnen sein. Ist die festzustellende Entsolidarisierung also eine Folge gesellschaftlicher Individualisierung?[...]
Inhaltsverzeichnis
- Modernisierung – Individualisierung – Solidarität: Versuch einer Annäherung
- Zum Begriff der Modernisierung
- Einführung und provisorische Begriffbestimmung
- Klassische Modernisierungsbegriff
- Ferdinand Tönnies
- Émile Durkheim
- Georg Simmel
- Max Weber
- Karl Marx
- Modernisierung in der sogenannten, Postmoderne’
- Charakteristika einer modernen Gesellschaft
- Individualisierung
- Begriffsbestimmung
- Dimensionen der Individualisierung
- Entwicklungslinien der Individualisierung
- Ambivalenz der Individualisierung
- Zum Begriff der Modernisierung
- Solidarität
- Was bedeutet Solidarität?
- Bedeutungsdimensionen
- Ist Solidarität ein christlicher Grundbegriff?
- Zugänge zum Solidaritätsbegriff in Christentum und Theologie
- Solidarität unter den Bedingungen fortschreitender Individualisierung - ein Auslaufmodell?
- Entgrenzung der Solidarität
- Neue Bedingungen von Solidarität
- Religiosität im Wandel der Postmoderne
- Individualisierung des Religiösen – eine Säkularisierung der Religionen?
- Jugend und Individualisierung
- Einleitung
- Der Begriff der Jugend heute
- Instanzen der Sozialisation
- Die Familie
- Die Peer-Group
- Schule und Beruf
- Konsequenzen für die Jugendlichen
- Veränderung jugendlicher Solidarität und Religiosität
- Jugend, Religion und die Rolle der Kirche
- Der Wandel der jugendlichen Solidarität
- Jugendliche Religiositätsstil
- Die Sinus-Milieustudie
- Was sind Milieus?
- Jugend und Religion in den Milieus
- Traditionelle Jugendliche
- Bürgerliche Jugendliche
- Konsum-materialistische Jugendliche
- Postmaterielle Jugendliche
- Hedonistische Jugendliche
- Performer-Jugendliche
- Experimentalistische Jugendliche
- Ergebnisse der Sinus-Studie
- Fazit
- Einleitung
- Erziehung zur Solidarität - Ein Beitrag der Schule
- Die Aufgabe des Religionsunterrichts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage der Solidarität und Individualisierung, insbesondere bei Jugendlichen in der sogenannten postmodernen Gesellschaft. Die Analyse zielt darauf ab, die Auswirkungen der Modernisierung auf die Lebenslage junger Menschen zu untersuchen, wobei die Veränderungen in ihren religiösen Einstellungen und Solidaritätspotentialen im Vordergrund stehen. Die Arbeit hinterfragt, ob sich eine Generation von Individualisten unter den Jugendlichen herausbildet, in der Solidarität und Religion immer weniger Platz finden.
- Modernisierung und ihre gesellschaftlichen Folgen
- Individualisierungstendenzen in der modernen Gesellschaft und ihre Auswirkungen auf die Jugend
- Entwicklung der Solidarität und Religiosität in der postmodernen Gesellschaft
- Die Rolle von Familie, Peer-Group und Schule in der Sozialisation junger Menschen
- Konsequenzen der gesellschaftlichen Veränderungen für Schule und Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit befasst sich mit den Begriffen Modernisierung, Individualisierung und Solidarität. Es analysiert die klassische Definition dieser Konzepte und untersucht deren Bedeutung im Kontext der sogenannten „Postmoderne“. Das zweite Kapitel widmet sich der spezifischen Lage der Jugend in der postmodernen Gesellschaft. Es analysiert die Auswirkungen der Individualisierung auf junge Menschen und beleuchtet die verschiedenen Instanzen ihrer Sozialisation, wie Familie, Peer-Group und Schule. Das dritte Kapitel untersucht die Folgen der gesellschaftlichen Veränderungen für Schule und Unterricht, insbesondere im Hinblick auf die Erziehung zur Solidarität. Es beleuchtet die Rolle des Religionsunterrichts in diesem Zusammenhang und diskutiert mögliche Ansätze für eine an den Bedürfnissen der heutigen Jugend ausgerichtete schulische Bildung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselbegriffe Modernisierung, Individualisierung, Solidarität und Religiosität. Die Untersuchung befasst sich mit den Auswirkungen dieser Konzepte auf die Lebenslage der Jugend in der postmodernen Gesellschaft, wobei die Sinus-Milieustudie als wichtige Forschungsquelle dient. Die Analyse beleuchtet die Rolle von Schule und Religionsunterricht in der Gestaltung von Solidarität und religiösen Einstellungen in einer individualisierten Gesellschaft.
- Citation du texte
- Michael Kollenberg (Auteur), 2009, „Der andere ist mir doch egal“ - Schulischer Religionsunterricht in Zeiten fortgeschrittener Individualisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157816