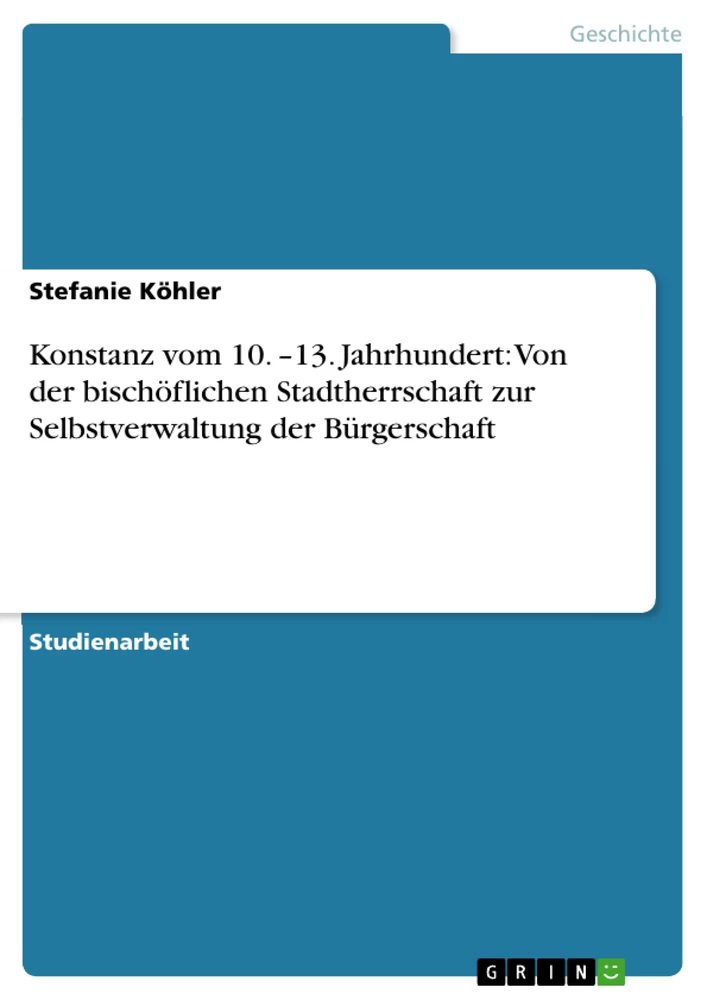Das Ziel meiner Hausarbeit ist es darzulegen, wie diese Entwicklung von einer Stadt mit
autoritärer Bischofsherrschaft hinzu einer Bürgerstadt mit eingeschränkter Macht des
Bischofs überhaupt möglich war. Welchen Anlass gab zu dieser Entwicklung
beziehungsweise zu den aufkommenden Streitigkeiten zwischen der Bürgerschaft Konstanz
und ihrem bischöflichen Stadtherren? Wie war es überhaupt möglich, dass es die Bürgerschaft
schaffte, die Macht des Bischofs so zu minimieren und vor allem mit wessen Hilfe gelang es
ihnen? Ebenfalls möchte ich den starken Umbruch der Rechtslage darstellen. Welche Rechte
besaßen beide Partein noch im 10. Jahrhundert und wie sah es schließlich zwei Jahrhunderte
später aus?
Um den Weg der Entwicklung von Bischofsstadt zu Bürgerstadt zu skizzieren, werde ich zu
Beginn meiner Hausarbeit die Rechte der Bewohner und die Rechte des Bischofs aufführen.
Anschließend komme ich auf den Wandel des Selbstbewusstseins der Bürger zu sprechen,
welcher durch wesentliche Faktoren, wie die Nachbildung Konstanz angelehnt an die
Romidee, den ständigen Königsbesuchen in der Stadt und letztendlich dem Investiturstreit,
beeinflusst wurde. Des weiteren möchte ich explizit auf die dadurch resultierenden Konflikte
zwischen den Bürgern und ihrem Stadtherrn eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Rechte des Bischofs im 10. Jahrhundert
- Die Rechte der Bürger im 10. Jahrhundert
- Der Wandel des Selbstbewusstseins der Bürger
- Konflikte zwischen Bischof und Bürgerschaft
- Die Bürger - Wer zählte überhaupt zur Bürgerschaft?
- Wer stand hinter dem Bischof?
- Seitenblick: Welche Rolle spielte der König bei den Streitigkeiten?
- Sieger des Konfliktes
- Das Zusammenleben in der Stadt während des konfliktreichen 13. Jahrhunderts
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Entwicklung der Bischofsstadt Konstanz hin zu einer Bürgerstadt im Mittelalter. Das Ziel ist es, aufzuzeigen, wie diese Entwicklung möglich war, welche Konflikte zwischen Bischof und Bürgerschaft entstanden sind und welche Faktoren den Wandel des Selbstbewusstseins der Bürger beeinflusst haben.
- Die Rechte und Pflichten des Bischofs als Stadtherr im 10. Jahrhundert
- Die Rechte und Pflichten der Bürger von Konstanz im 10. Jahrhundert
- Der Wandel des Selbstbewusstseins der Bürger im 11. und 12. Jahrhundert
- Die Konflikte zwischen Bischof und Bürgerschaft im 12. und 13. Jahrhundert
- Die Rolle des Königs in den Streitigkeiten zwischen Bischof und Bürgerschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Hausarbeit beginnt mit der Beschreibung der Rechte des Bischofs von Konstanz im 10. Jahrhundert. Der Bischof war Stadtherr und besaß weitreichende Rechte gegenüber den Bürgern, einschließlich der Gerichtsbarkeit, der Kontrolle über den Markt und der Ausübung der Leibeigenschaft.
Im folgenden Kapitel werden die Rechte der Bürger im 10. Jahrhundert beleuchtet. Obwohl sie unter der Autorität des Bischofs standen, entwickelten sie mit der Zeit ein stärkeres Selbstbewusstsein, was durch Faktoren wie die Nachbildung Konstanz angelehnt an die Romidee, die ständigen Königsbesuche in der Stadt und den Investiturstreit beeinflusst wurde. Diese Entwicklung führte zu Konflikten zwischen dem Bischof und der Bürgerschaft.
Die Kapitel 6.1 und 6.2 befassen sich mit den Kontrahenten in diesen Streitigkeiten. Dabei werden die Zusammensetzung der Bürgerschaft und die Unterstützer des Bischofs genauer betrachtet.
Kapitel 7 beleuchtet die Rolle des Königs in den Auseinandersetzungen. Das Kapitel 8 analysiert den Ausgang des Konfliktes. Schließlich geht Kapitel 9 auf das Zusammenleben in der Stadt Konstanz während der Streitigkeiten ein.
Schlüsselwörter
Bischofsstadt, Bürgerstadt, Selbstverwaltung, Rechte, Pflichten, Konflikte, Bischof, Bürgerschaft, König, Mittelalter, Konstanz.
Häufig gestellte Fragen
Wie wandelte sich Konstanz von der Bischofsstadt zur Bürgerstadt?
Zwischen dem 10. und 13. Jahrhundert erkämpften sich die Bürger schrittweise Rechte zur Selbstverwaltung, wodurch die ursprünglich autoritäre Macht des Bischofs als Stadtherr minimiert wurde.
Welche Rechte besaß der Bischof von Konstanz im 10. Jahrhundert?
Der Bischof besaß weitreichende Befugnisse, darunter die Gerichtsbarkeit, die Kontrolle über den Markt und das Recht auf Leibeigenschaft gegenüber den Bewohnern.
Welche Rolle spielte der Investiturstreit für die Bürger von Konstanz?
Der Investiturstreit schwächte die bischöfliche Autorität und ermöglichte es der Bürgerschaft, sich als eigenständiger politischer Akteur zu positionieren und mehr Freiheiten einzufordern.
Was war die „Romidee“ in Konstanz?
Die Nachbildung von Konstanz angelehnt an das Vorbild Roms stärkte das Selbstbewusstsein der Bürger und unterstrich die Bedeutung der Stadt als geistiges und politisches Zentrum.
Wer zählte im mittelalterlichen Konstanz zur „Bürgerschaft“?
Zur Bürgerschaft zählten freie Bewohner mit städtischen Rechten, wobei sich innerhalb dieser Gruppe im 13. Jahrhundert ein wachsender Widerstand gegen die bischöfliche Herrschaft formierte.
- Citar trabajo
- Stefanie Köhler (Autor), 2010, Konstanz vom 10. –13. Jahrhundert: Von der bischöflichen Stadtherrschaft zur Selbstverwaltung der Bürgerschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157832