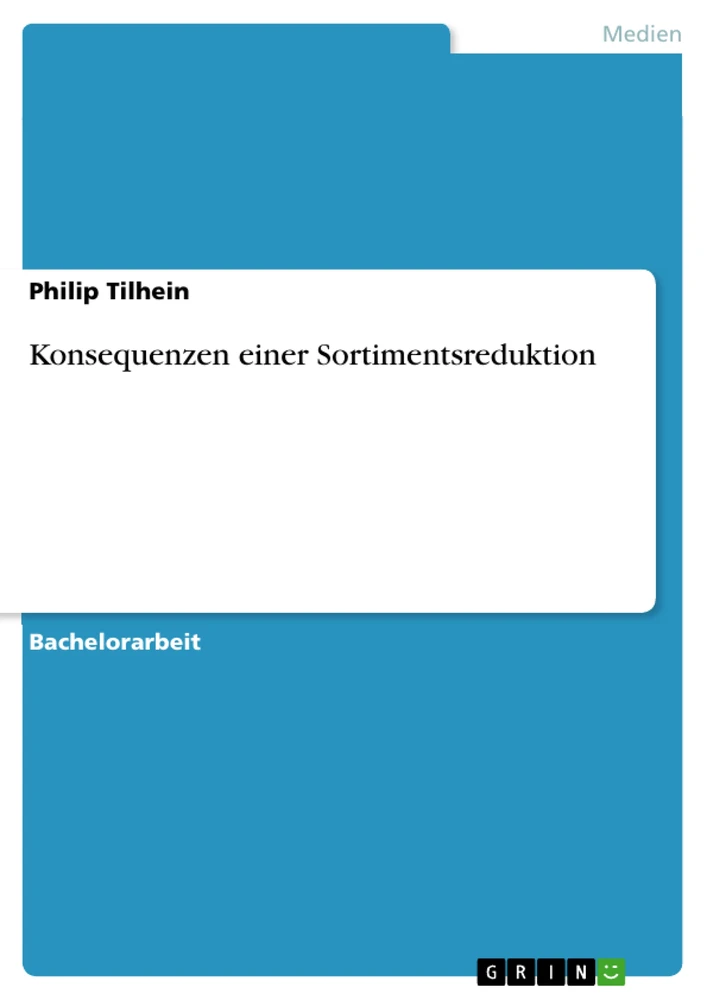Aufgabe des Marketing ist es die Bedürfnisse und Wünsche der Konsumenten zu befriedigen (vgl. Kotler 2006, S. 5). Deswegen stehen Anbieter vor der Herausforderung ihr Sortiment an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen, indem sie versuchen ihren Kunden genau die Produkte anzubieten, mit denen sie ihre Bedürfnisse befriedigen können. Eine größere Vielfalt an Produkten erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Angebot mit den Bedürfnissen der Kunden übereinstimmt. Dem Konsumenten eine große Vielfalt und ausreichende Auswahlmöglichkeiten zur Befriedigung seiner Bedürfnisse zu bieten ist außerdem von großer Relevanz, da der Konsument sich oft nicht sicher ist, mit Hilfe welcher Produkte er seine Bedürfnisse befriedigen möchte und sich seine Wünsche im Laufe der Zeit ändern (vgl. Hoch/Bradlow/Wansik 1999, S. 528). Das heißt, Handelsunternehmen müssen ihren Kunden durch ein ausreichendes Angebot von Produkten, die Möglichkeit geben das passende Produkt zur Bedürfnisbefriedigung zu finden. Möchte ein Anbieter seinen Kunden also ein ausreichendes Repartoir an Auswahlmöglichkeiten bieten, muss sein Sortiment ausreichend groß sein. Doch neue Studien bezüglich dieser Thematik zeigen, dass eine Vergrößerung des Sortiments nicht zwingend mit einem Anstieg der wahrgenommenen Vielfalt einhergeht und dass zu große Sortimente negative Konsequenzen für den Anbieter als auch für den Konsumenten haben können (vgl. Rudolph/Kotouc 2007, S. 171-174). Da die traditionelle Handelsforschung aber davon ausgeht, dass man mit der Ausdehnung des Sortiments automatisch auch die Attraktivität und die Vielfalt des Sortiments steigert, wächst die Anzahl der angebotenen Produkte kontinuierlich. Als Folge sind Konsumenten heutzutage enormen Auswahlmöglichkeiten und einem sehr umfangreichen Warenangebot ausgesetzt, wodurch sie teilweise verunsichert und entmutigt werden. Zu große Sortimente können somit negative Konsequenzen für den Konsumenten und für den Anbieter der Produkte haben (vgl. Rudolph/Kotouc 2007, S. 171-173). Deswegen wurden zahlreiche Studien durchgeführt, die erforschen, wie sich eine Reduktion des Sortiments auswirkt. Entgegen dem „Mehr-ist-besser-Leitsatz“ der traditionellen Handelsforschung (vgl. Rudolph/Kotouc 2007, S. 171), war das Ergebnis der Experimente dieser Arbeiten, dass der Umsatz mit Hilfe einer Sortimentsreduktion sogar gesteigert werden kann und dass außerdem der Nutzen für den Konsumenten durch eine solche Reduktion erhöht wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Gang der Untersuchung
- Definitionen
- Sortimentsreduktion
- Perspektive der Kanalpartner
- Perspektive des Konsumenten
- Perspektive des Anbieters
- Perspektive des Herstellers
- Konsequenzen einer Sortimentsreduktion
- Konsequenzen für den Konsumenten
- Konsequenzen für den Anbieter
- Konsequenzen für den Hersteller
- Schlussbetrachtung
- Fazit
- Implikationen für Praxis und Forschung
- Limitationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit den Konsequenzen einer Sortimentsreduktion im Einzelhandel. Ziel ist es, die Auswirkungen einer Sortimentsreduktion aus der Perspektive des Konsumenten, des Anbieters und des Herstellers zu analysieren und zu verstehen.
- Die Relevanz der Sortimentsreduktion in einer Zeit, in der Konsumenten mit einer großen Auswahl an Produkten konfrontiert sind
- Die Auswirkungen einer Sortimentsreduktion auf die Kaufentscheidungen der Konsumenten und deren Kaufverhalten
- Die Folgen einer Sortimentsreduktion für die Kosten und die Profitabilität von Anbietern
- Die Rolle des Herstellers im Prozess der Sortimentsreduktion und die Auswirkungen auf seine Absatzmöglichkeiten
- Die interdependente Beziehung zwischen den drei Parteien (Konsument, Anbieter, Hersteller) im Kontext der Sortimentsreduktion
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das erste Kapitel führt in die Thematik der Sortimentsreduktion ein und begründet die Relevanz des Themas. Es wird die Forschungsfrage formuliert, auf die sich die Arbeit konzentriert, und der Aufbau der Arbeit erläutert.
- Definitionen: In diesem Kapitel werden wichtige Begriffe, wie Sortimentsreduktion und die Perspektiven der beteiligten Parteien (Konsument, Anbieter, Hersteller), definiert und abgegrenzt.
- Konsequenzen einer Sortimentsreduktion: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen einer Sortimentsreduktion auf die drei wichtigsten Akteure im Handel - den Konsumenten, den Anbieter und den Hersteller. Dabei wird der Fokus auf die jeweiligen Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung, das Kaufverhalten und die Profitabilität gelegt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Sortimentsreduktion, Konsumentenverhalten, Kaufentscheidungen, Anbieterperspektive, Herstellerperspektive, Kostenoptimierung, Profitabilität, Interdependenz, Handel, Marketing und wissenschaftliche Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Kann eine Sortimentsreduktion den Umsatz steigern?
Ja, Studien zeigen, dass eine Reduzierung zu großer Sortimente den Umsatz steigern und den Nutzen für den Konsumenten erhöhen kann.
Warum fühlen sich Konsumenten von großen Sortimenten oft entmutigt?
Zu umfangreiche Auswahlmöglichkeiten können zu Verunsicherung führen, da die Entscheidungskomplexität steigt (Choice Overload).
Welche Vorteile hat eine Sortimentsreduktion für den Anbieter?
Anbieter können Kosten optimieren, die Profitabilität steigern und die Attraktivität des Sortiments durch bessere Übersichtlichkeit erhöhen.
Wie wirkt sich die Reduktion auf den Hersteller aus?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen auf die Absatzmöglichkeiten und die strategische Positionierung der Herstellerprodukte im Handel.
Was ist der „Mehr-ist-besser-Leitsatz“?
Ein traditioneller Ansatz der Handelsforschung, der davon ausgeht, dass eine Ausdehnung des Sortiments automatisch dessen Attraktivität steigert.
- Quote paper
- Philip Tilhein (Author), 2010, Konsequenzen einer Sortimentsreduktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157837