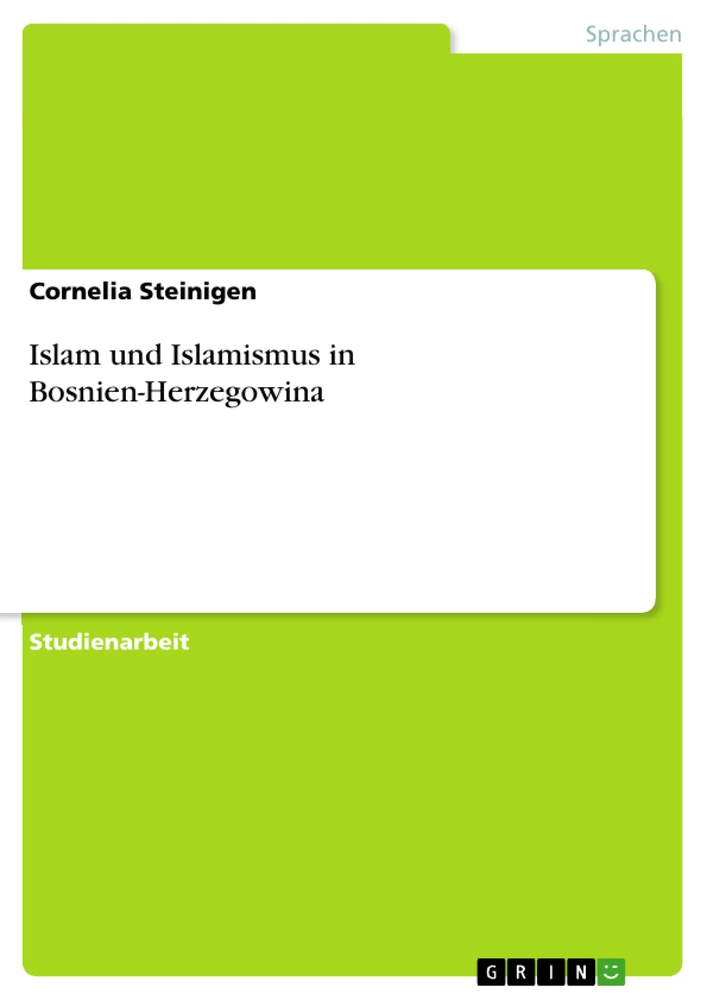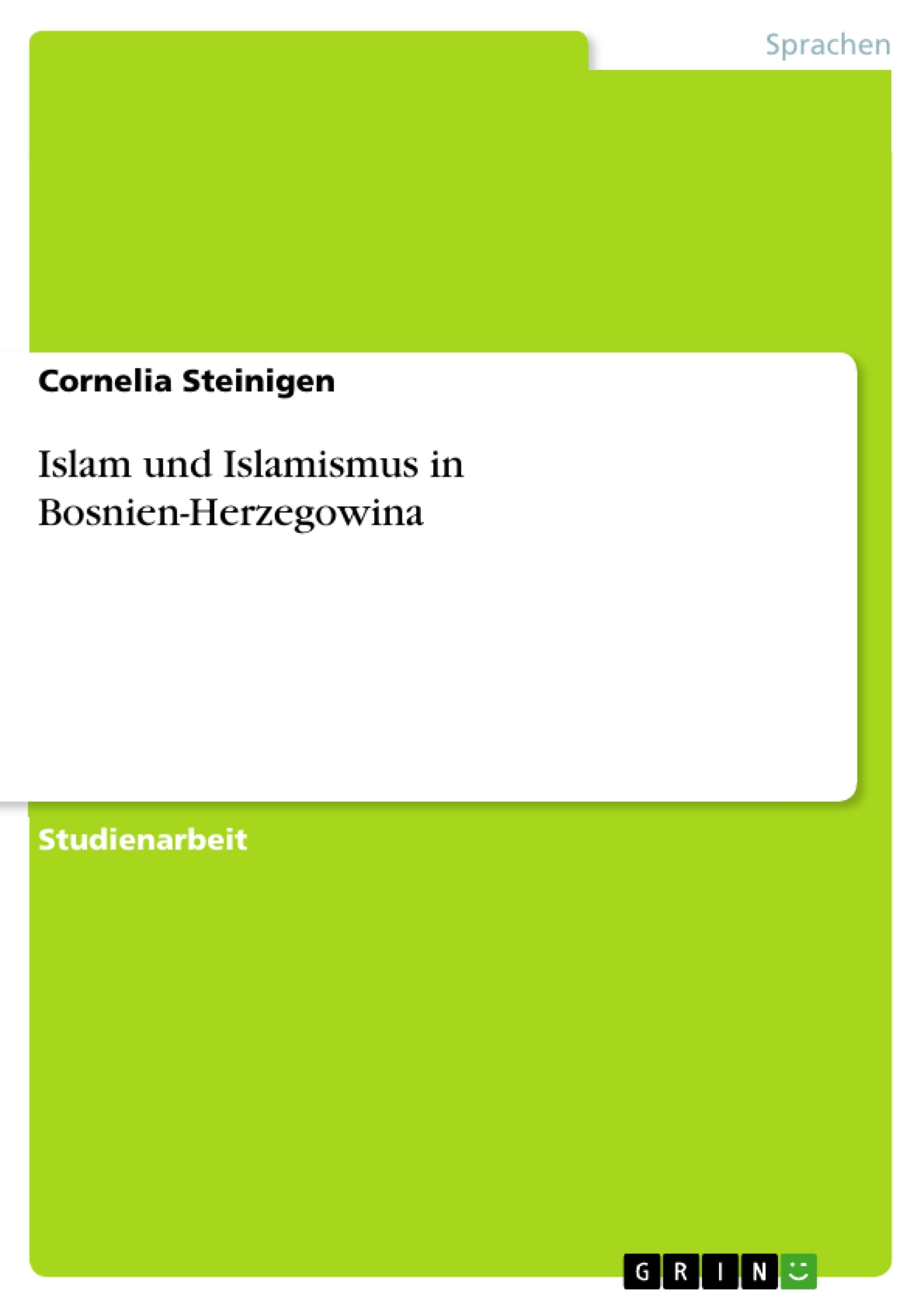Auf der diesjährigen Berlinale war „Na Putu“ (engl. Titel „On the Path“) zu sehen, ein Film der bosnischen Regisseurin Jasmila Žbanić von 2010. Es geht um Luna und Amar, ein bosnisches Paar, das einer schweren Belastungsprobe unterzogen wird, als Amar wegen Trunkenheit seine Arbeit verliert. Auch der gemeinsame Kinderwunsch lässt sich nicht verwirklichen, da Amar aufgrund seiner Alkoholabhängigkeit zeu-gungsunfähig geworden ist. Durch einen Veteranen aus dem Bosnienkrieg, den er zufällig wiedertrifft, findet Amar schließlich eine neue, gutbezahlte Arbeit in einer muslimischen, einer wahhabitischen Gemeinde. Diese beeinflusst ihn so stark, dass er sein ganzes bisheriges Leben in Frage stellt und sich der radikalen islamischen Doktrin des Wahhabismus zuwendet. Luna erkennt Amar nicht wieder und hegt erst Misstrauen, dann große Abneigung gegenüber dem Einfluss, den die wahhabistischen Fundamentalisten auf Amar ausüben.
Der Film zeigt einen Aspekt des bosnischen Islam, der seit dem Bosnienkrieg (1992-1995) immer mehr an Bedeutung gewonnen hat: Der zunehmende Einfluss ausländi-scher islamistischer und wahhabistischer Gruppierungen in dem noch immer wirt-schaftlich und sozial geschwächten Land. Seit dem Kriegsende hat Saudi-Arabien beispielsweise etwa 3000 Projekte in ganz Bosnien-Herzegowina finanziert. Somit gelangte nicht nur eine beträchtliche Summe an wirtschaftlicher Aufbauhilfe ins Land, sondern auch die fundamentalistische wahhabistische Doktrin der Saudis.
Das aggressive Vorgehen islamistischer und wahhabistischer Aktivisten in Bosnien, aber auch in anderen Balkanstaaten, resultiert in internen Streitigkeiten und Schismen innerhalb der muslimischen Gemeinschaften, die tradi-tionellerweise einen moderaten, toleranten und westlich orientierten Islam vertreten. Von den Wahhabisten werden sie deswegen als „Ungläubige“ angesehen und verfolgt.
Mit der vorliegenden Arbeit soll zunächst ein kurzer Überblick über die Etablierung und die Charakteristika des Islams auf dem Balkan, speziell in Bosnien, gegeben werden. Im Folgenden stehen islamistische und wahhabistische Gruppierungen im Fokus, die in Bosnien aktiv sind. Insbesondere geht es um die Darstellung der Me-thoden, mit denen sie versuchen, Einfluss auf die bosnische muslimische Bevölkerung auszuüben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Überblick über die Geschichte des Islams auf dem Balkan
- 3 Islam und Islamismus in Bosnien-Herzegowina
- 3.1 Merkmale des bosnischen Islams
- 3.2 Die Bedeutung Bosniens für internationale islamistische Organisationen
- 3.3 Alija Izetbegović und seine „Islamische Deklaration“
- 3.4 Der Bosnienkrieg (1992-1995) und die Rekrutierung ausländischer Muğāhidūn
- 3.5 Der Islam nach dem Bosnienkrieg: Europäischer vs. fundamentalistischer Islam
- 3.5.1 Allgemeine Entwicklungstendenzen und deren Einschätzung
- 3.5.2 Die Etablierung islamistischer und wahhabitischer Organisationen
- 3.5.3 Ziele und Zielgruppen der islamistischen und wahhabitischen Aktivisten
- 3.5.4 Methoden islamistischer und wahhabitischer Aktivisten, um an Einfluss zu gewinnen
- 3.4.5.1 Finanzierung neuer Moscheebautent
- 3.4.5.2 Rekrutierung junger, gebildeter Muslime in den Städten
- 3.4.5.3 Eingriff in und Kontrolle des Alltagslebens der muslimischen Bevölkerung
- 3.4.5.4 Einsatz ausländischer islamischer NGOs
- 3.5.5 Reaktionen der bosnischen Muslime auf den Einfluss islamistischer und wahhabitischer Gruppierungen
- 4 Fazit und Ausblick
- 5 Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit verfolgt das Ziel, einen Überblick über die Entwicklung des Islams in Bosnien-Herzegowina zu geben, mit besonderem Fokus auf den Einfluss islamistischer und wahhabitischer Gruppierungen seit dem Bosnienkrieg. Es wird untersucht, wie diese Gruppen versuchen, Einfluss auf die bosnische muslimische Bevölkerung auszuüben.
- Die Geschichte des Islams auf dem Balkan
- Die Merkmale des bosnischen Islams vor und nach dem Krieg
- Der Einfluss saudischer und anderer internationaler islamistischer Organisationen
- Die Methoden islamistischer und wahhabitischer Aktivisten zur Einflussnahme
- Reaktionen der bosnischen Muslime auf den Einfluss dieser Gruppierungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt mit dem Film "Na Putu" in die Thematik ein und beleuchtet den zunehmenden Einfluss ausländischer islamistischer und wahhabitischer Gruppierungen in Bosnien nach dem Krieg. Der Film illustriert die Herausforderungen, die mit der Verbreitung des Wahhabismus in einer Gesellschaft verbunden sind, die traditionell einen moderaten Islam pflegt. Die Arbeit kündigt an, einen Überblick über den Islam in Bosnien zu geben und den Fokus auf die Aktivitäten islamistischer und wahhabitischer Gruppen zu legen.
2 Überblick über die Geschichte des Islams auf dem Balkan: Dieses Kapitel skizziert die Ankunft des Islams auf dem Balkan im 14. Jahrhundert durch die osmanischen Eroberungen. Es hebt die Bedeutung der Schlacht auf dem Amselfeld 1389 hervor und beschreibt die weitreichenden Folgen für die Region, insbesondere die Verbreitung des Islams in Bosnien. Das Kapitel beleuchtet die Rolle der bosnischen Kirche vor der osmanischen Herrschaft und den Prozess der Islamisierung, der teilweise mit der Praxis eines Kryptochristentums einherging. Die Bevorzugung von Muslimen im Osmanischen Reich wird als ein Faktor für die hohe Konversionsrate genannt. Das Kapitel endet mit einem Hinweis auf den Niedergang des Osmanischen Reiches und die daraus resultierenden Unabhängigkeitsbestrebungen der südslawischen Völker.
3 Islam und Islamismus in Bosnien-Herzegowina: Dieses Kapitel analysiert den Islam in Bosnien-Herzegowina, insbesondere im Kontext des Bosnienkrieges und der anschließenden Etablierung islamistischer und wahhabitischer Organisationen. Es untersucht die Merkmale des bosnischen Islams, die Rolle Bosniens für internationale islamistische Organisationen, die Bedeutung der „Islamischen Deklaration“ von Alija Izetbegović und die Rekrutierung ausländischer Kämpfer während des Krieges. Im Mittelpunkt stehen die Methoden der Einflussnahme dieser Gruppen, wie die Finanzierung von Moscheebauprojekten, die Rekrutierung junger, gebildeter Muslime und die Beeinflussung des Alltagslebens der muslimischen Bevölkerung. Die Reaktionen der bosnischen Muslime auf den Einfluss dieser Gruppierungen werden ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Islam, Islamismus, Wahhabismus, Bosnien-Herzegowina, Bosnienkrieg, Islamistische Organisationen, Einflussnahme, Radikalisierung, Moderater Islam, Saudisches Königreich, Muğāhidūn, Kryptochristentum, Balkan.
Häufig gestellte Fragen zum Text über den Islam in Bosnien-Herzegowina
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung des Islams in Bosnien-Herzegowina, mit besonderem Fokus auf den Einfluss islamistischer und wahhabitischer Gruppierungen seit dem Bosnienkrieg. Er analysiert deren Methoden der Einflussnahme auf die bosnische muslimische Bevölkerung und die Reaktionen der Bevölkerung darauf.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Geschichte des Islams auf dem Balkan, die Merkmale des bosnischen Islams (vor und nach dem Krieg), den Einfluss saudischer und anderer internationaler islamistischer Organisationen, die Methoden islamistischer und wahhabitischer Aktivisten zur Einflussnahme (Finanzierung von Moscheen, Rekrutierung junger Muslime, Beeinflussung des Alltagslebens), und die Reaktionen der bosnischen Muslime auf diesen Einfluss. Die Rolle von Alija Izetbegović und seiner „Islamischen Deklaration“ wird ebenfalls beleuchtet, ebenso wie die Rekrutierung ausländischer Kämpfer während des Bosnienkrieges.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in diesen?
Der Text gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und benutzt den Film "Na Putu" als Beispiel. Kapitel 2 bietet einen geschichtlichen Überblick über den Islam auf dem Balkan, inklusive der osmanischen Eroberungen und der Islamisierung Bosniens. Kapitel 3 analysiert den Islam und Islamismus in Bosnien-Herzegowina, mit Schwerpunkt auf dem Einfluss islamistischer und wahhabitischer Gruppen nach dem Bosnienkrieg. Kapitel 4 (Fazit und Ausblick) fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick. Kapitel 5 listet die verwendeten Quellen auf.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Islam, Islamismus, Wahhabismus, Bosnien-Herzegowina, Bosnienkrieg, Islamistische Organisationen, Einflussnahme, Radikalisierung, Moderater Islam, Saudisches Königreich, Muğāhidūn, Kryptochristentum, Balkan.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Entwicklung des Islams in Bosnien-Herzegowina zu vermitteln, insbesondere in Bezug auf den Einfluss von islamistischen und wahhabitischen Gruppierungen nach dem Bosnienkrieg. Er möchte die Methoden dieser Gruppen und die Reaktionen der Bevölkerung darauf analysieren.
Wie wird der Film "Na Putu" im Text verwendet?
Der Film "Na Putu" wird in der Einleitung verwendet, um die Thematik des zunehmenden Einflusses ausländischer islamistischer und wahhabitischer Gruppierungen in Bosnien nach dem Krieg zu illustrieren und die Herausforderungen der Verbreitung des Wahhabismus in einer traditionell moderat-islamischen Gesellschaft zu verdeutlichen.
Welche Rolle spielt Alija Izetbegović im Text?
Alija Izetbegovićs „Islamische Deklaration“ wird im Text als ein relevanter Faktor im Kontext des bosnischen Islams und seiner Entwicklung diskutiert. Der Text beleuchtet die Bedeutung dieser Deklaration im Hinblick auf den Einfluss auf die politische und religiöse Landschaft Bosniens.
Wie werden die Methoden der islamistischen und wahhabitischen Aktivisten beschrieben?
Der Text beschreibt die Methoden der Einflussnahme islamistischer und wahhabitischer Gruppen, unter anderem durch die Finanzierung neuer Moscheen, die Rekrutierung junger, gebildeter Muslime in Städten, den Eingriff in und die Kontrolle des Alltagslebens der muslimischen Bevölkerung und den Einsatz ausländischer islamischer NGOs.
- Quote paper
- Cornelia Steinigen (Author), 2009, Islam und Islamismus in Bosnien-Herzegowina, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157912