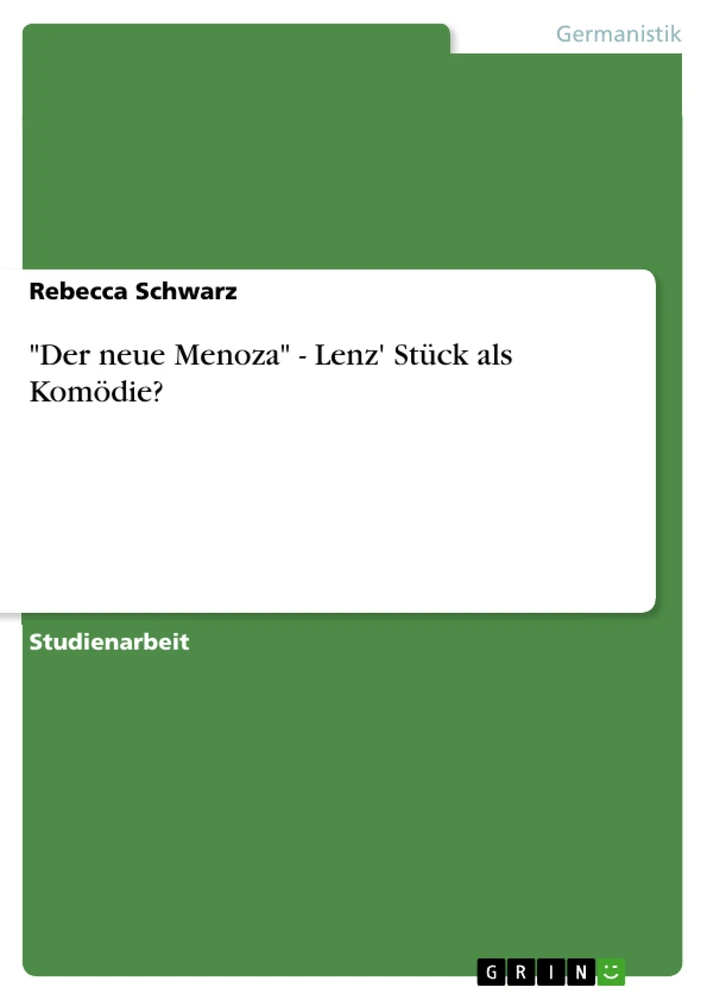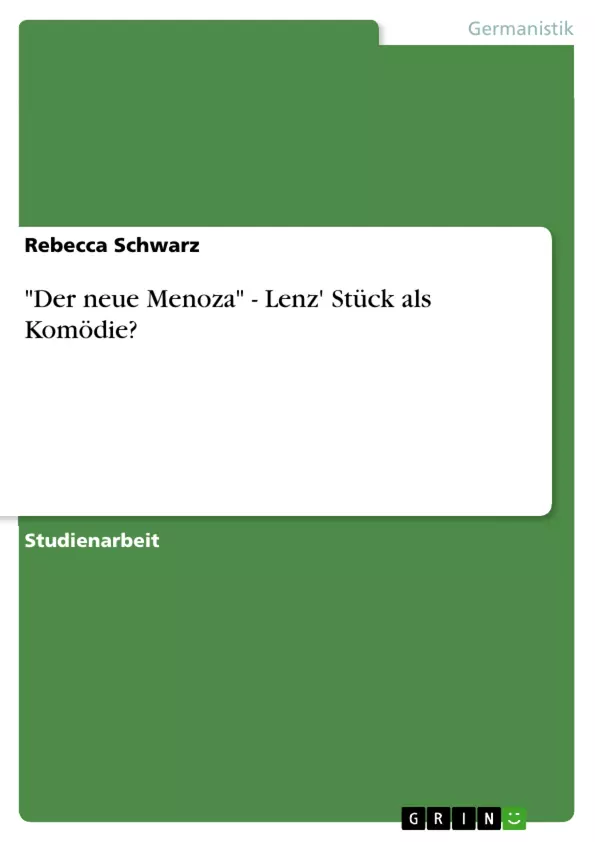Noch vor den Soldaten verfasst Jakob Michael Reinhold Lenz im Jahre 1773 eine Komödie bestehend aus fünf Akten: Der neue Menoza. Oder Geschichte des cumbanischen Prinzen Tandi. Das Drama greift viele Aspekte des Sturm und Drang auf und Lenz verwendet hierin eine leidenschaftliche, bewegte und ausdrucksstarke Sprache voller Gefühle und Spannungen.
Doch nicht nur diese ist ein gängiges Zeitmotiv, das Lenz aufgreift. Darüber hinaus bringt er mit Prinz Tandi die Figur des ‚edlen Wilden‘ in seine Komödie ein. Diesem sollen die Gebräuche und Gewohnheiten Europas näher gebracht werden, wobei Tandi diese durch persönliche Erfahrungen und Bekanntschaften – beispielsweise mit dem Grafen Camäleon - schnell durchschaut und Ablehnung gegenüber ihnen äußert. Bereits der Titel von Lenz' Komödie Der neue Menoza macht den Bezug auf den dänischen Roman von Eric Pontoppidan, Menoza, ein asiatischer Prinz, welcher die Welt umher gezogen, Christen zu suchen, aber des Gesuchten wenig gefunden, deutlich. Doch Lenz nimmt kaum etwas von diesem Roman in sein eigenes Stück mit auf. Stattdessen lässt er gegenwärtige und aktuelle Motive und Gedanken die Komödie bestimmen: unter anderem Rousseaus Urteil gegenüber der Aufklärung.
Insgesamt wählt Lenz somit bedeutende und einschneidende Themen seiner Zeit und baut diese in sein Stück mit ein. Dennoch stellt er für die Komödie fest: „Komödie ist Gemählde der menschlichen Gesellschaft, und wenn die ernsthaft wird, kann das Gemählde nicht lachend werden.“
In seiner Selbstrezension weist Lenz darauf hin, dass er diese menschliche Gesellschaft mit Prinz Tandi, der nach „Wahrheit, Größe und Güte“6 sucht, konfrontiert. Dadurch ist es schließlich für das Publikum möglich, Vergleiche heranzuziehen.
Doch weshalb wählt Lenz für den Neuen Menoza trotz seiner darin stark enthaltenen Kritik an der europäischen Gesellschaft überhaupt die Form der Komödie, kommt es hierin doch zur Vermittlung bedeutsamer Botschaften für das Publikum. Wenn das Gemälde für Lenz nicht lachend sein darf, weshalb zieht er die Komödie als Werkzeug der Tragödie vor?
Insgesamt fallen die Kritiken am Neuen Menoza fast durchgehend negativ aus, nur selten ist in der Forschung Positives über Lenz' Komödie zu lesen. Hat Lenz einfach nur das falsche Sprachrohr für sein Stück gewählt und wäre eine Tragödie nicht angebrachter gewesen? Oder handelt es sich überhaupt um eine Komödie, welche komischen Elemente enthält das Stück und wie ist dies zu bewerten?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Handlungsstränge und Charaktere
- Der Inhalt des Neuen Menoza
- Nachtrag
- Die Figuren
- Der ,,edle Wilde“
- Sprechende Namen
- Zopf, Zierau und Beza
- Komisch oder tragisch?
- Komische Elemente
- Aktives Bühnengeschehen
- Die Commedia dell'arte als Inspiration
- Überrumpelung und Sprachlosigkeit
- Reaktionen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Lenz' Stück "Der neue Menoza" mit dem Ziel, die Komik des Stücks und die Frage nach seiner Eignung als Komödie zu beleuchten. Lenz' Werk greift das Motiv des "edlen Wilden" auf und setzt sich kritisch mit der europäischen Gesellschaft auseinander.
- Die Figur des "edlen Wilden" als Kritik an der europäischen Gesellschaft
- Komische Elemente im Stück
- Die Frage nach der Tragik in der Komödie
- Die Rolle der Commedia dell'arte
- Die Rezeption des "Neuen Menoza"
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Werk ein und beleuchtet die Entstehungszeit, das Thema und die Kritik des Stücks. Das zweite Kapitel analysiert die Handlungsstränge und Figuren, insbesondere die Figur des Prinzen Tandi und die Rolle der "edlen Wildheit". Das dritte Kapitel setzt sich mit der Frage nach Komik und Tragik auseinander, beleuchtet komische Elemente und den Einfluss der Commedia dell'arte.
Schlüsselwörter
Der neue Menoza, Jakob Michael Reinhold Lenz, "edler Wilder", Komödie, Tragödie, Commedia dell'arte, Kritik an der europäischen Gesellschaft, Sturm und Drang, Theatralische Darstellung, Drei Einheiten der Tragödie.
- Quote paper
- Rebecca Schwarz (Author), 2010, "Der neue Menoza" - Lenz' Stück als Komödie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157937