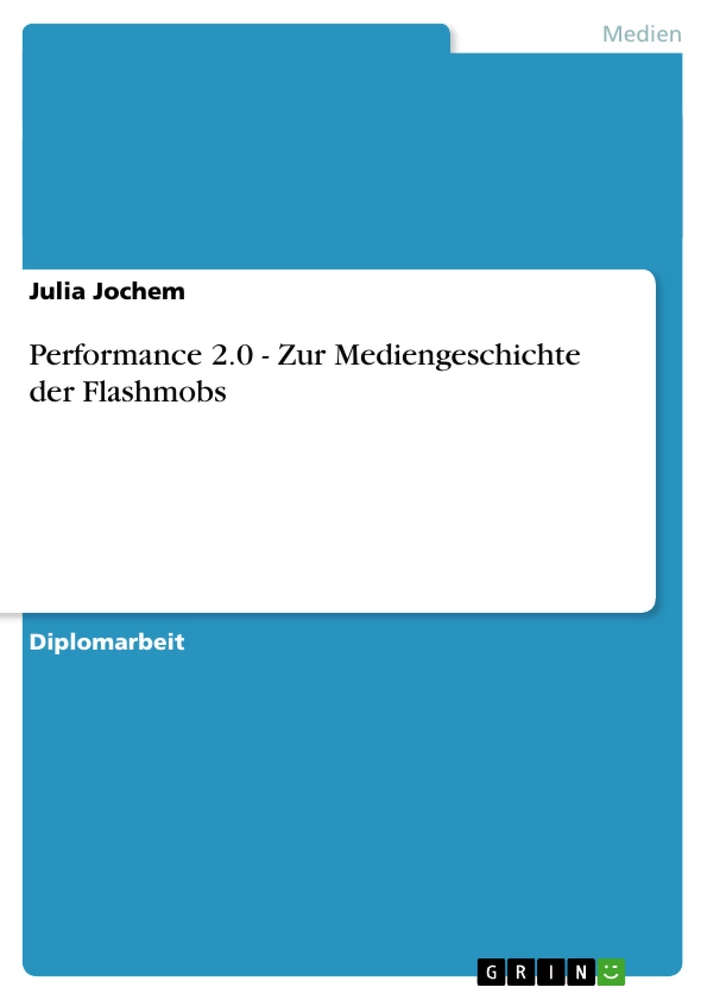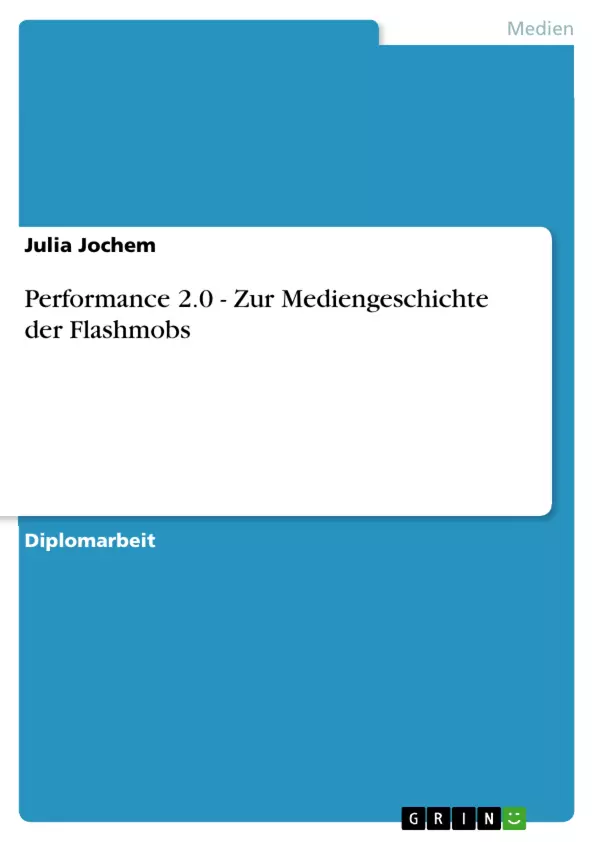[...]Ich möchte Flashmobs in dieser Arbeit unter folgenden Fragestellungen vorstellen und untersuchen: Neben dem visuellen Ereignis im Stadtraum, als das Flashmobs im Allgemeinen wahrgenommen werden, interessiert hier, welche Schritte dem Ereignis vorangehen und was im Anschluss an die Aktion im urbanen öffentlichen Raum geschieht. Gezeigt werden soll, dass Flashmobs einen Prozess9 darstellen, der auch die Vor- und Nachbereitung der Aktionen beinhaltet. Anders als die Live-Aktion
finden diese im virtuellen Raum des Internets statt. Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit ist es, mit Performance 2.0 einen Begriff vorzustellen, der dem prozessualen Charakter des Untersuchungsgegenstandes gerecht wird. Der Aspekt der Performance rekurriert dabei auf die Aufführung des visuellen Ereignisses, während 2.0 auf die Bedeutung des Internets, respektive des Web 2.0, für den Ablauf eines Flashmob verweist. Dies geschieht aus einer mediengeschichtlichen Perspektive, womit ich einen interdisziplinären
Ansatz verfolge, der es möglich macht, den Prozess eines Flashmobs aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Forschungsstand und Zielsetzung der Arbeit
- 2. Ver-rückte Meute. Geschichte und Begriffsbestimmung von Flashmobs
- 2.1 Mob = Mob?
- 2.2
- 3. Zwischen Kunst und Populärer Kultur
- 3.1 Aktionskunst
- 3.1.1 „Something to take place: a Happening“
- 3.1.2 Fluxus: Ein soziales Netzwerk
- 3.1.3 Performance Art: Aktion und Reproduktion
- 3.2 Populäre Kultur
- 3.2.1 Freizeitkultur
- 3.2.2 Erlebniskultur und Erlebnisgesellschaft
- 3.2.3 Event
- 3.2.4 Posttraditionale Vergemeinschaftung
- 3.3 Flashmobs als Cross-Over-Ereignis
- 4. Performance im Zeitalter des Web 2.0
- 4.1 Exkurs: Was ist das Web 2.0?
- 4.2 Phase der Vorbereitung
- 4.2.1 Flashmob-Community Hamburg
- 4.3 Phase der Durchführung
- 4.3.1 FREEZE - „Wir sind heute eingefroren“
- 4.4 Phase der Bilderwanderung
- 4.4.1 Exkurs: Die Debatte um das Verhältnis von Live-Performance und ihrer medialen Aufzeichnung
- 4.4.2 Flashmob-Videos auf YouTube
- 4.5 Entgrenzung der Räume = Performance 2.0
- 5. Schlussbemerkungen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen Flashmobs aus einer mediengeschichtlichen Perspektive. Ziel ist es, den prozessualen Charakter von Flashmobs zu beleuchten, der über die visuelle Aktion im öffentlichen Raum hinausgeht und die Vor- und Nachbereitung im virtuellen Raum des Internets mit einschließt. Der Begriff "Performance 2.0" wird eingeführt, um diesen Prozess umfassend zu beschreiben.
- Die Geschichte und Begriffsbestimmung von Flashmobs.
- Die Einordnung von Flashmobs im Kontext von Aktionskunst und Populärkultur.
- Die Rolle des Web 2.0 und neuer Medien in der Organisation und Verbreitung von Flashmobs.
- Die drei Phasen eines Flashmobs: Vorbereitung, Durchführung und mediale Nachbereitung.
- Die Bedeutung von Gemeinschaft, Provokation und Selbstermächtigung im Kontext von Flashmobs.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt einen Flashmob am Kölner Hauptbahnhof als Beispiel für das Phänomen und führt in die Thematik ein. Sie hebt die plötzliche und unerwartete Natur der Aktionen hervor, sowie die geteilten Reaktionen der Öffentlichkeit. Die Einleitung unterstreicht die Bedeutung der medialen Dokumentation und die Forschungslücke bezüglich wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit Flashmobs.
1.1 Forschungsstand und Zielsetzung der Arbeit: Dieser Abschnitt analysiert den bisherigen Forschungsstand zu Flashmobs, wobei Arbeiten von Rheingold und Shirky sowie die ethnologische Betrachtung von Bauer hervorgehoben werden. Die Arbeit selbst zielt darauf ab, Flashmobs als einen dreistufigen Prozess (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung) zu betrachten und den Begriff "Performance 2.0" einzuführen, um den medialen Aspekt des Phänomens zu erfassen.
2. Ver-rückte Meute. Geschichte und Begriffsbestimmung von Flashmobs: Dieses Kapitel behandelt die Entstehung und Definition von Flashmobs. Es beleuchtet den historischen Kontext, um die Entwicklung und Verbreitung des Phänomens zu verstehen. Hier wird der Begriff "Flashmob" genauer definiert und abgegrenzt von ähnlichen sozialen Ereignissen. Der Abschnitt dürfte auch einen Vergleich mit ähnlichen sozialen Ereignissen ziehen, um den eindeutigen Charakter der Flashmobs hervorzuheben.
3. Zwischen Kunst und Populärer Kultur: Dieser Teil untersucht die Einordnung von Flashmobs in den Kontext von Aktionskunst und Populärkultur. Es werden verschiedene künstlerische Strömungen wie Happenings, Fluxus und Performance Art diskutiert, um die künstlerischen Parallelen und die kulturellen Bezüge zu beleuchten. Der Abschnitt wird die Verbindung von Flashmobs zu Trends der Freizeit- und Erlebniskultur sowie dem Konzept der posttraditionellen Vergemeinschaftung analysieren und die Hybridität und den einzigartigen Charakter von Flashmobs herausstellen.
4. Performance im Zeitalter des Web 2.0: Das Kapitel widmet sich der entscheidenden Rolle des Web 2.0 bei der Organisation und Durchführung von Flashmobs. Die drei Phasen (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung) werden im Detail untersucht und anhand von Beispielen wie der "Flashmob-Community Hamburg" und dem Flashmob "FREEZE" illustriert. Der Einfluss von Online-Plattformen wie YouTube auf die Verbreitung und Wahrnehmung von Flashmobs wird eingehend analysiert, und die Bedeutung der medialen Dokumentation für die Definition des Phänomens wird hervorgehoben. Der Begriff "Performance 2.0" wird im Kontext dieser medialen Vernetzung weiter konkretisiert.
Schlüsselwörter
Flashmobs, Performance 2.0, Web 2.0, Aktionskunst, Populäre Kultur, mediale Inszenierung, Gemeinschaft, Provokation, Selbstermächtigung, virtueller Raum, öffentlicher Raum, mediale Aufzeichnung, Netzwerkbildung, Jugendkultur.
Häufig gestellte Fragen zu: "Ver-rückte Meute. Flashmobs als Performance 2.0"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen Flashmobs aus einer mediengeschichtlichen Perspektive. Der Fokus liegt auf dem prozessualen Charakter von Flashmobs, der die Vor- und Nachbereitung im virtuellen Raum des Internets ebenso einschließt wie die visuelle Aktion im öffentlichen Raum. Der Begriff "Performance 2.0" wird eingeführt, um diesen Prozess umfassend zu beschreiben.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Geschichte und Begriffsbestimmung von Flashmobs, ihre Einordnung im Kontext von Aktionskunst und Populärkultur, die Rolle des Web 2.0 in der Organisation und Verbreitung, die drei Phasen eines Flashmobs (Vorbereitung, Durchführung, mediale Nachbereitung), sowie die Bedeutung von Gemeinschaft, Provokation und Selbstermächtigung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (mit Forschungsstand und Zielsetzung), Geschichte und Begriffsbestimmung von Flashmobs, Einordnung im Kontext von Kunst und Populärkultur, Performance im Zeitalter des Web 2.0 (mit detaillierter Analyse der drei Phasen), und Schlussbemerkungen mit Ausblick. Jedes Kapitel baut auf dem vorherigen auf und trägt zum umfassenden Verständnis des Phänomens Flashmob bei.
Welche Rolle spielt das Web 2.0?
Das Web 2.0 spielt eine entscheidende Rolle bei der Organisation und Verbreitung von Flashmobs. Die Arbeit analysiert die drei Phasen eines Flashmobs im Kontext des Web 2.0: die Vorbereitungsphase (z.B. Nutzung von Online-Plattformen), die Durchführungsphase (die Aktion selbst im öffentlichen Raum) und die Nachbereitungsphase (mediale Verbreitung und Diskussion, z.B. auf YouTube).
Welche künstlerischen Strömungen werden im Zusammenhang mit Flashmobs betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Parallelen zwischen Flashmobs und verschiedenen künstlerischen Strömungen wie Happenings, Fluxus und Performance Art. Dadurch wird die Einordnung von Flashmobs im Kontext der Aktionskunst beleuchtet und ihre künstlerischen Bezüge aufgezeigt.
Wie werden Flashmobs definiert und von ähnlichen Ereignissen abgegrenzt?
Die Arbeit liefert eine genaue Definition von Flashmobs und grenzt sie von ähnlichen sozialen Ereignissen ab. Dabei wird der historische Kontext berücksichtigt, um die Entwicklung und Verbreitung des Phänomens zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Flashmobs, Performance 2.0, Web 2.0, Aktionskunst, Populäre Kultur, mediale Inszenierung, Gemeinschaft, Provokation, Selbstermächtigung, virtueller Raum, öffentlicher Raum, mediale Aufzeichnung, Netzwerkbildung, Jugendkultur.
Welche konkreten Beispiele werden genannt?
Die Arbeit verwendet Beispiele wie die "Flashmob-Community Hamburg" und den Flashmob "FREEZE", um die drei Phasen eines Flashmobs zu illustrieren und die Rolle des Web 2.0 zu verdeutlichen. Ein Flashmob am Kölner Hauptbahnhof dient als einführendes Beispiel.
Was ist "Performance 2.0"?
Der Begriff "Performance 2.0" wird in dieser Arbeit eingeführt, um den medialen Aspekt von Flashmobs zu erfassen. Er beschreibt den dreistufigen Prozess von Vorbereitung im virtuellen Raum, Durchführung im öffentlichen Raum und Nachbereitung durch mediale Verbreitung im Internet.
- Quote paper
- Julia Jochem (Author), 2010, Performance 2.0 - Zur Mediengeschichte der Flashmobs , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157938