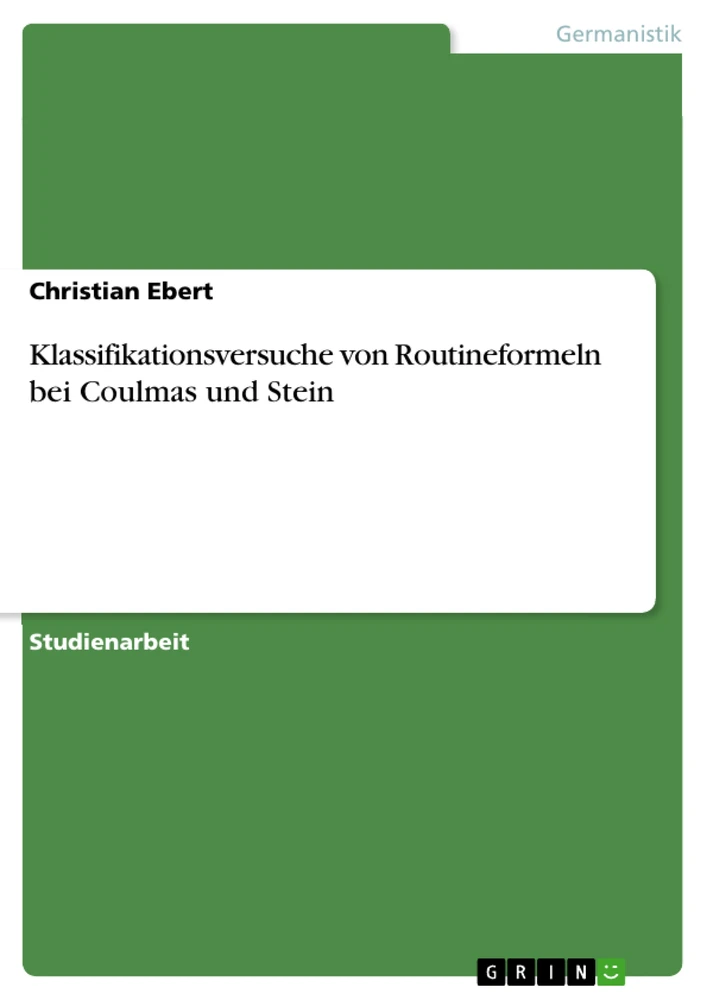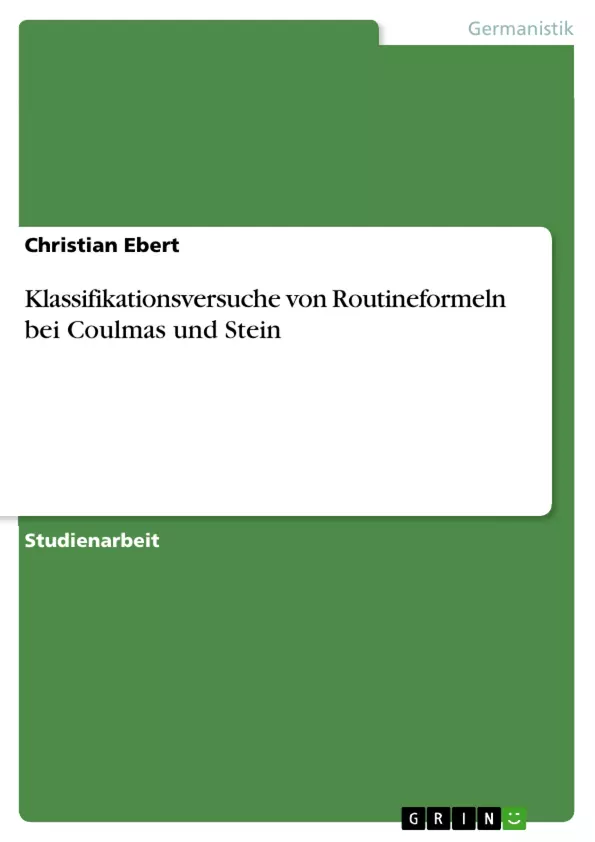Routineformeln können wohl kaum auf eine einheitliche und eindimensionale Art klassifiziert werden. Das macht allein schon ihre Inkompatibilität mit herkömmlichen syntaktischen und morphologischen Beschreibungsmitteln auf der einen Seite und auf der anderen ihre Vielschichtigkeit auf funktionaler und pragmatischer Ebene klar. Der Kriterien zur Einteilung sind viele, was es der Übersichtlichkeit nicht leicht macht, sich zu behaupten; und wäre eine solche Aufteilung selbst vollständig und erschöpfend, so hieße es doch lediglich, sich neuerdings dem Problem gegenübergestellt zu sehen, die Vielzahl der Formeln in die vorgefertigten Kategorien zu zwängen, was ein mindestens ebenso schwieriges Unterfangen zu sein scheint wie ersteres. Eine Einheitlichkeit kann auf diese Weise kaum erreicht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Definition
- II. Einteilungsversuche
- II. 1. Coulmas
- II.1.1 Funktionale Differenzierung
- II.1.2 Systematisierung, Typologie und das Modell der Typzuweisung
- II. 2. Stein
- II.2.1 Grobgliederung
- II.2.2 Gesprächssteuernde Formeln und die Methode der Funktionszuweisung
- III. Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Klassifizierung von Routineformeln. Sie analysiert die Ansätze von Coulmas und Stein und beleuchtet die Unterschiede in ihrer Herangehensweise.
- Definition und Merkmale von Routineformeln
- Klassifikationsversuche von Coulmas und Stein
- Funktionale Differenzierung und Typologie von Routineformeln
- Die Methode der Funktionszuweisung
- Vor- und Nachteile der beiden Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Routineformeln als ein allgegenwärtiges Phänomen in der Kommunikation vor. Sie beleuchtet die zunehmende Forschungsaktivität zu diesem Thema und hebt die Divergenzen in den Einteilungsversuchen hervor. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Ansätze von Coulmas und Stein zu analysieren und deren Vor- und Nachteile zu bewerten.
I. Definition
Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Routineformeln. Coulmas argumentiert, dass eine rein formale Klassifizierung aufgrund der Heterogenität dieser Ausdrücke ungeeignet ist. Stattdessen entwickelt er eine kommunikationssituative Definition, die Routineformeln als funktionsspezifische Ausdrücke mit wörtlicher Bedeutung betrachtet. Stein verfolgt einen ähnlichen Ansatz, konzentriert sich jedoch stärker auf die Gesprächsstruktur und definiert Formeln als komplexe Einheiten, die eine oder mehrere kommunikative Funktionen übernehmen. Beide Definitionen betonen die pragmatische Perspektive auf Routineformeln.
II. Einteilungsversuche
II. 1. Coulmas
Coulmas unterscheidet zwischen diskursiven und situationsabhängigen Formeln. Er analysiert die funktionale Differenzierung dieser Formeln und stellt ein Systematisierungsmodell vor, das auf der Zuweisung von Typen basiert.
II. 2. Stein
Stein konzentriert sich auf die Analyse von Gesprächssteuerungsformeln. Seine Grobgliederung unterscheidet zwischen verschiedenen Formeltypen. Er verwendet die Methode der Funktionszuweisung, um die kommunikativen Funktionen der Formeln zu identifizieren.
Schlüsselwörter
Routineformeln, Phraseologie, Kommunikation, Pragmatik, Funktion, Typologie, Klassifikation, Coulmas, Stein, Gesprächssteuerung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Routineformeln in der Linguistik?
Routineformeln sind funktionsspezifische, oft feste Ausdrücke, die in der Kommunikation bestimmte pragmatische Aufgaben übernehmen (z.B. Begrüßungen).
Wie klassifiziert Coulmas Routineformeln?
Coulmas unterscheidet zwischen diskursiven und situationsabhängigen Formeln und nutzt ein Modell der Typzuweisung basierend auf der Kommunikationssituation.
Worauf liegt der Schwerpunkt bei Steins Ansatz?
Stein konzentriert sich auf gesprächssteuernde Formeln und nutzt die Methode der Funktionszuweisung, um deren Rolle im Gesprächsverlauf zu bestimmen.
Warum ist eine rein formale Klassifizierung schwierig?
Aufgrund der morphologischen und syntaktischen Heterogenität der Formeln sowie ihrer Vielschichtigkeit auf funktionaler Ebene greifen herkömmliche Mittel oft zu kurz.
Was ist das Ziel des Vergleichs zwischen Coulmas und Stein?
Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen pragmatischen Herangehensweisen und bewertet die Vor- und Nachteile der jeweiligen Systematisierungsmodelle.
- Quote paper
- Christian Ebert (Author), 2010, Klassifikationsversuche von Routineformeln bei Coulmas und Stein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158107