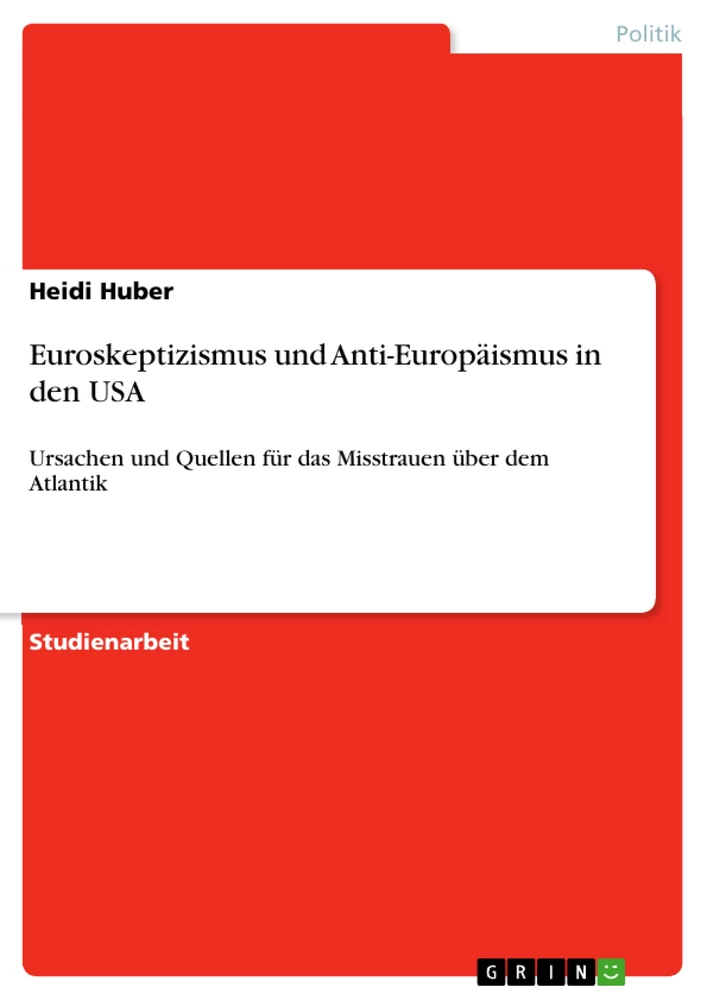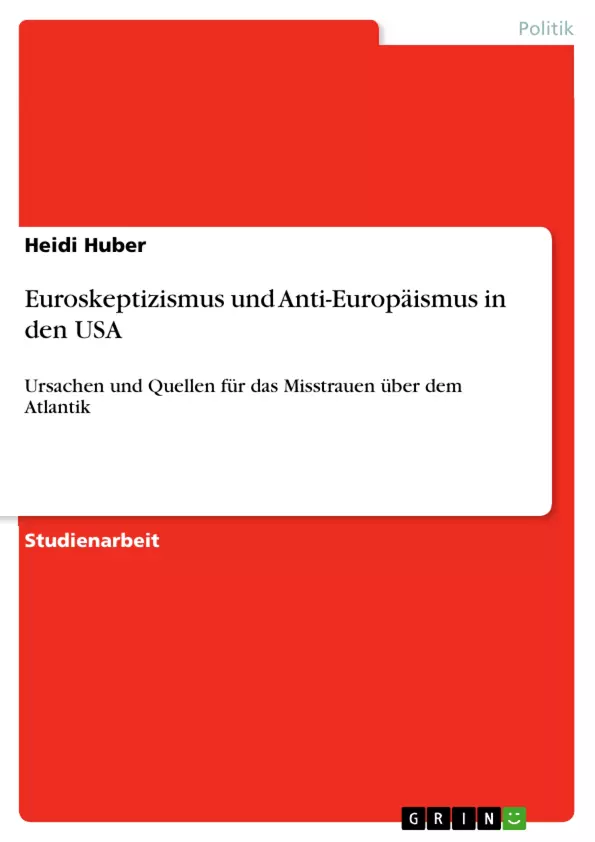Der Euroskeptizismus als kritische Haltung gegenüber der Europäischen Integration und der EU an sich ist in vielen europäischen Staaten kein neues Phänomen. Es existiert seit Anbeginn der Entstehung des Projektes Europa und die Eurobarometer-Umfragen der Europäischen Kommission ermitteln in sämtlichen EU-Mitgliedsländern die Beliebtheitswerte der Union und wenig überraschend sind es immer dieselben Länder, die sich ausgeprägt skeptisch zeigen.
Umgekehrt ist das Phänomen des Anti-Amerikanismus, also die ablehnende Haltung gegenüber den USA, in Europa kein neues Phänomen und in aller Munde. Die Supermacht „erfreut“ sich auch in Europa, wie dem Rest der Welt, sinkender Beliebtheitswerte. Die USA und Europa hat vor allem im Kalten Krieg der gemeinsame Kampf gegen den Kommunismus und die Sowjetunion verbunden. Die Vereinigten Staaten galten zu diesem Zeitpunkt als Befürworter des Europäischen Integrationsprozesses. Nach dem Ende des Kalten Krieges, als der gemeinsame Feind verschwunden war, entwickelte sich Europa zum ernsthaften Konkurrenten für die USA und stellte mit dem Vertrag von Maastricht 1991 die Gemeinschaft auf ein neues Level. Seit den Terroranschlägen am 11. September reagieren die Amerikaner noch verstimmter auf eine ablehnende Haltung gegenüber ihrer Nation. Umso stärker rückt daher der Anti-Amerikanismus in Europa ins Bild und umso stärker kommt der amerikanische Euroskeptizismus und Anti-Europäismus hervor.
Zwei auf den ersten Blick ähnliche, aber verschiedene Phänomene entwickeln sich seit den 1990er Jahren parallel: der Anti-Europäismus und der amerikanische Euroskeptizismus.
Die Ursachen für diese Phänomene, die seither eine Renaissance erleben, sind vielfältig. Wie vielfältig, soll diese Arbeit verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Themenrelevanz
- Zentrale Forschungsfrage
- Operationalisierung
- Aufbau der Arbeit
- Anti-Amerikanismus, Euroskeptizismus und Anti-Europäismus
- Euroskeptizismus – ein vielschichtiges Phänomen
- Der wenig beachtete Anti-Europäismus
- Der viel beachtete Anti-Amerikanismus
- Ursachen und Quellen amerikanischer EU-Skepsis
- Viribus Unitis? - Die Geschichte entzweit
- Eine Frage des Charakters
- Die Europäer als „Softies“
- Hard vs. Soft Power – die USA hat einen Herausforderer
- Wirtschaft, Kultur und Ideologie
- Frankophobie und britische Skepsis
- Konklusion
- Resümee
- Beantwortung der Forschungsfrage
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Phänomen des amerikanischen Euroskeptizismus und Anti-Europäismus. Sie untersucht die Ursachen und Quellen für diese ablehnende Haltung gegenüber der Europäischen Union in den USA. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Hintergründe und die Entwicklung dieser Haltung zu verstehen.
- Die Entstehung des Euroskeptizismus in den USA im Kontext historischer und politischer Entwicklungen
- Die Rolle von Charaktereigenschaften und dem Verhältnis von Hard- und Soft Power in der Wahrnehmung Europas durch die USA
- Die Bedeutung von wirtschaftlichen, kulturellen und ideologischen Faktoren für die Entstehung von Euroskeptizismus
- Die Rolle von Frankophobie und britischer Skepsis in der amerikanischen Debatte über Europa
- Die Auswirkungen des Anti-Amerikanismus auf die amerikanische Haltung gegenüber Europa
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Seminararbeit stellt die Problemstellung und Themenrelevanz des amerikanischen Euroskeptizismus dar und definiert die zentrale Forschungsfrage. Sie erläutert außerdem die Operationalisierung und den Aufbau der Arbeit.
Kapitel 2 definiert die zentralen Begriffe "Euroskeptizismus", "Anti-Europäismus" und "Anti-Amerikanismus" und setzt sie in Beziehung zueinander. Es beschreibt die Entwicklung des Euroskeptizismus in Europa und beleuchtet den Anti-Amerikanismus als Gegenphänomen.
Kapitel 3 analysiert die Ursachen und Quellen des amerikanischen Euroskeptizismus. Es untersucht verschiedene Faktoren wie historische Entzweiungen, die Wahrnehmung des europäischen Charakters, das Verhältnis von Hard- und Soft Power, sowie wirtschaftliche, kulturelle und ideologische Differenzen zwischen den USA und Europa. Darüber hinaus betrachtet es die Rolle von Frankophobie und britischer Skepsis.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen dieser Seminararbeit sind: Euroskeptizismus, Anti-Europäismus, Anti-Amerikanismus, USA, Europäische Union, Geschichte, Kultur, Wirtschaft, Ideologie, Soft Power, Hard Power, Frankophobie, britische Skepsis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist amerikanischer Euroskeptizismus?
Eine kritische oder ablehnende Haltung in den USA gegenüber der europäischen Integration und der EU als politischem und wirtschaftlichem Akteur.
Wie unterscheiden sich Euroskeptizismus und Anti-Europäismus?
Euroskeptizismus bezieht sich meist auf die Institution EU, während Anti-Europäismus eine tiefergehende Ablehnung europäischer Werte oder Kulturen beschreibt.
Welche Rolle spielt das Verhältnis von "Hard Power" zu "Soft Power"?
Die USA setzen oft auf militärische Stärke (Hard Power), während Europa eher zivile Mittel (Soft Power) betont, was in den USA oft als Schwäche wahrgenommen wird.
Warum hat sich die US-Haltung nach dem Kalten Krieg geändert?
Nach dem Verschwinden des gemeinsamen Feindes (Sowjetunion) wurde Europa zunehmend als wirtschaftlicher und politischer Konkurrent wahrgenommen.
Was ist "Frankophobie" im US-Kontext?
Eine spezifische Ablehnung französischer Politik, die oft stellvertretend für die Kritik an einer eigenständigen europäischen Außenpolitik steht.
- Quote paper
- BA Bakk.Komm. Heidi Huber (Author), 2010, Euroskeptizismus und Anti-Europäismus in den USA, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158304