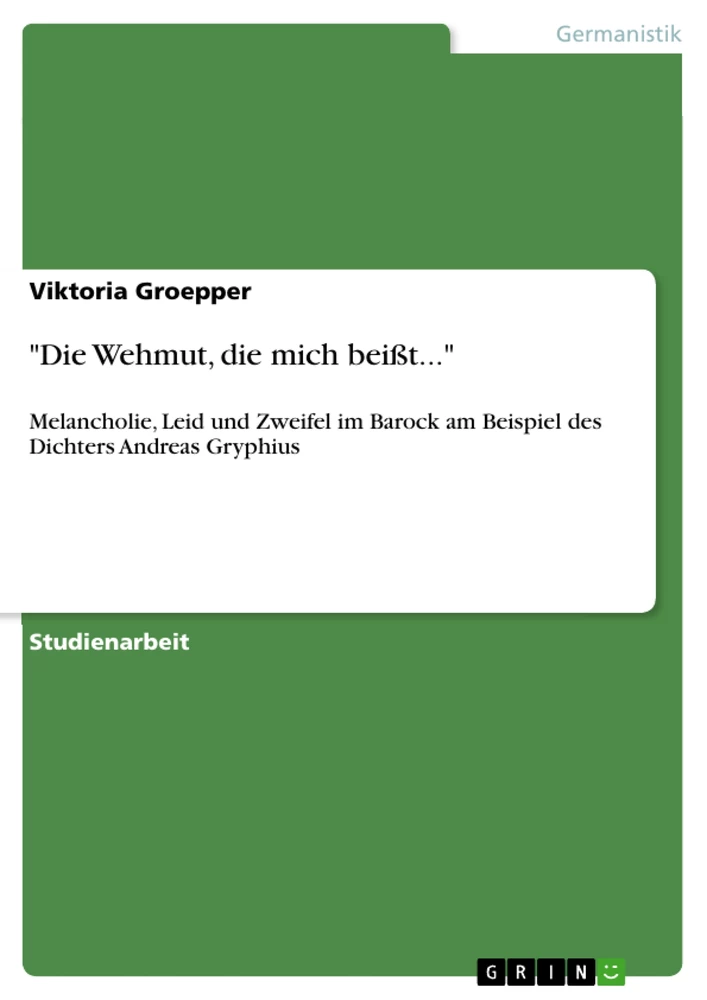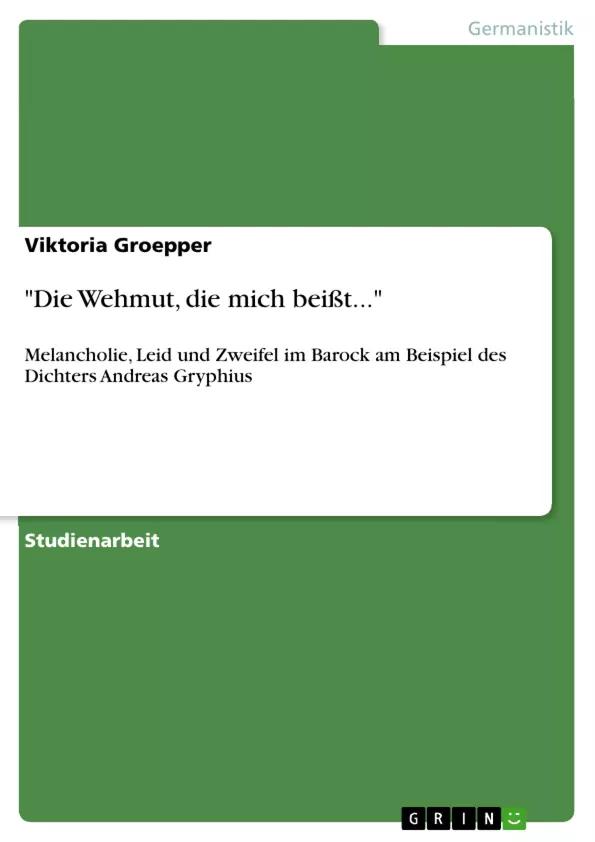„Jedoch was klag ich dir? Dir ist mein Leid erkannt./ Was will ich dir entdecken,/ Was du viel besser weißt:/ Die Schmerzen, die mich schrecken,/ Die Wehmut, die mich beißt,/ Und daß ich meinem Ziel mit Winseln zugerannt?“
Das Werk des bekannten barocken Dichters und Dramatikers Andreas Gryphius ist von Schwermut - oder auch ‚Wehmut‘ - gezeichnet. Man könnte meinen, dies sei für einen Dichter des Barock nichts Außergewöhnliches, da das alles bestimmende Motiv der Epoche und seiner Dichter die Vergänglichkeit und damit das menschliche Elend ist, welches nur durch den Glauben an Gott und ein besseres Leben nach dem Tod ertragen werden kann. Immer wird bei der Interpretation von barocken Werken die Frage offen bleiben, ob und inwiefern der Dichter selbst spricht. Der Barock war eine Epoche, in der Allgemeingültigkeit, Objektivität und die Ästhetik des Geschriebenen einen sehr viel höheren Stellenwert besaßen, als unmittelbarer Gefühlsausdruck und subjektives Empfinden, wie zum Beispiel in der Romantik. Barocke Gedichte sollten eine allgemeine Aussage und Richtschnur für die Menschen darstellen, es gab zudem sehr strenge formelle und ästhetische Regeln. Selten wurden in lyrischen Werken subjektive Empfindungen ausgedrückt, durch die der Rezipient eines Gedichts den Menschen hinter dem Dichter hätte kennenlernen können. Das beste Beispiel für diese unpersönliche, strengen Regeln gehorchende Lyrik ist vermutlich Martin Opitz, der auch der Verfasser des Buches „Von der Deutschen Poeterey“, einem Regelwerk bezüglich der Poetik in der deutschen Sprache, ist. Daher ist es problematisch, durch Aussagen in barocken Gedichten auf den Autor und sein Leben, seinen Gemütszustand, rückzuschließen. Die Melancholie – welche im 20. Jahrhundert durch den Begriff der ‘Depression‘ ersetzt wurde - war im Barock, einer stark religiös geprägten Epoche, noch „vom Ödium der Sünde und der Krankheit“ belastet. Man hatte Trost in der Aussicht auf ein besseres Jenseits zu finden. Wer dies nicht tat, wer dennoch zweifelte, dessen Glaube und Hingabe an Gott waren nicht stark genug, was in der Konsequenz sicherlich zu einem umso stärkeren Zweifeln – diesmal an sich selbst – führte. Zusätzlich herrschte im Barock noch das philosophische Ideal des Stoizismus, welches...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Zeitlosigkeit von Melancholie, Leid und Zweifel
- Leid und Zweifel in Gryphius' Leben und Gedichten
- Ausblick: Gryphius - ein Melancholiker?
- Quellenangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Rolle von Melancholie, Leid und Zweifel im Werk des barocken Dichters Andreas Gryphius. Sie befasst sich mit der Zeitlosigkeit dieser Themen und untersucht, inwiefern Gryphius' eigene Lebenserfahrungen und die gesellschaftlichen Normen seiner Zeit seine Werke geprägt haben.
- Zeitlosigkeit von Melancholie, Leid und Zweifel
- Bedeutung von Glaube und Stoizismus im Barock
- Die Rolle des Dichters und die Frage nach subjektiver Erfahrung
- Analyse von Gryphius' Werken im Kontext seiner Lebensgeschichte
- Vergleich zwischen Gryphius' Werk und der modernen Konzeption von Depression
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Melancholie in Gryphius' Werk ein und stellt die Problematik der Interpretation barocker Lyrik im Hinblick auf den Autor und seine persönlichen Erfahrungen dar.
- Die Zeitlosigkeit von Melancholie, Leid und Zweifel: Dieses Kapitel beleuchtet die Zeitlosigkeit der Motive Melancholie, Leid und Zweifel und setzt diese im Kontext der Barockzeit in Bezug zur modernen Konzeption von Depression.
- Leid und Zweifel in Gryphius' Leben und Gedichten: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den persönlichen Lebenserfahrungen von Andreas Gryphius und analysiert seine Werke im Hinblick auf die darin thematisierten Themen von Leid und Zweifel.
Schlüsselwörter
Andreas Gryphius, Barocklyrik, Melancholie, Leid, Zweifel, Depression, Zeitlosigkeit, Glaube, Stoizismus, subjektive Erfahrung, Leben und Werk, Vanitas.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist das Werk von Andreas Gryphius von Schwermut geprägt?
Das Motiv der Vergänglichkeit (Vanitas) und das menschliche Elend sind zentrale Themen der Barockepoche, die Gryphius in seinen Gedichten und Dramen intensiv verarbeitet.
Darf man barocke Lyrik als persönlichen Gefühlsausdruck deuten?
Das ist problematisch, da im Barock Objektivität und die Einhaltung strenger ästhetischer Regeln (wie bei Martin Opitz) wichtiger waren als der unmittelbare subjektive Ausdruck.
Wie wurde Melancholie im Barock bewertet?
Melancholie galt oft als Sünde oder Krankheit, da ein starker Glaube an Gott eigentlich Trost gegen das irdische Leid bieten sollte.
Welche Rolle spielt der Stoizismus in der Barocklyrik?
Der Stoizismus lieferte das philosophische Ideal der Standhaftigkeit (Constantia) gegenüber dem Schicksal, was ein wichtiges Gegengewicht zum Gefühl der Vergänglichkeit bildete.
Was ist die Kernaussage der Arbeit über Gryphius?
Die Arbeit untersucht die Zeitlosigkeit von Leid und Zweifel und fragt, ob man Gryphius aus heutiger Sicht als Melancholiker bezeichnen kann.
- Citar trabajo
- Viktoria Groepper (Autor), 2010, "Die Wehmut, die mich beißt...", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158320