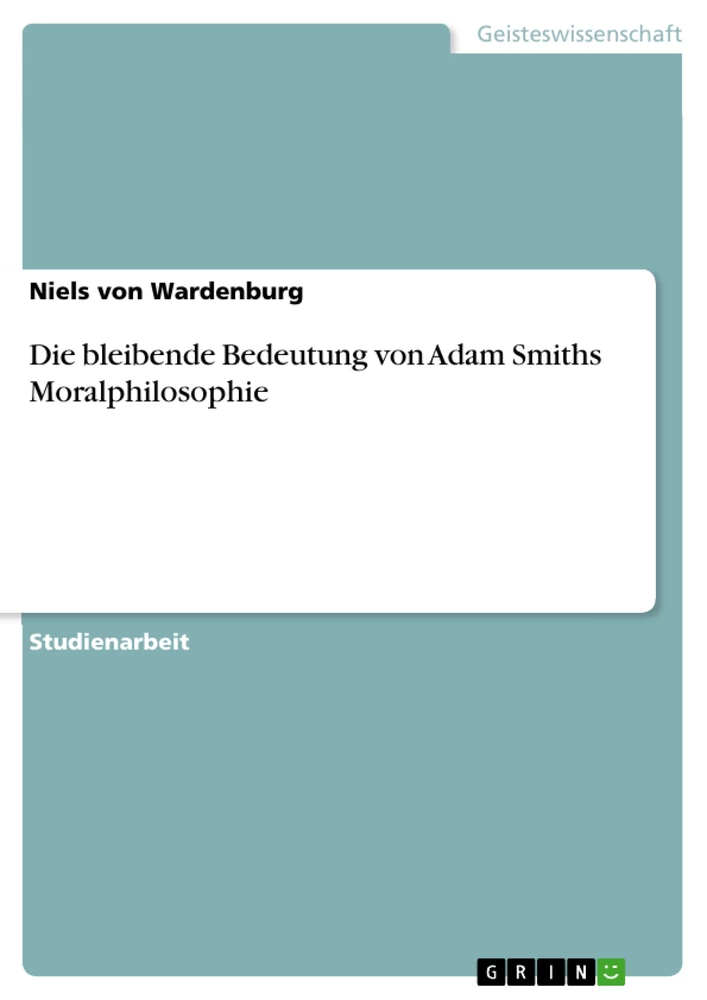Nachdem der deutsche zeitgenössische Philosoph Ernst Tugendhat, im Jahr 1993, in seinen Vorlesungen über Ethik den besonderen systematischen Stellenwert der smithschen Moralphilosophie erkannt und ausformuliert hat, erlebte die Forschung und Diskussion über die TMG eine Renaissance.
Diese Arbeit soll, orientiert an Tugendhats systematischer Einordnung, zeigen, welche Bedeutung die TMG für die Moralphilosophie hat und worin sie besteht. Plausibel ist,
dass es im Wesentlichen – mit Kant gesprochen – um eine Einbeziehung des Sinnenwesens in die universalistische Moral geht. Was für Kant eine Unmöglichkeit war, da die Moral allein der Verstandeswelt zuzuordnen ist, scheint mit Hilfe von Smith nun möglich zu sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verbindung von Universalität und Sympathie in Smiths TMG
- Erweiterung der Moralphilosophie um die Tugend der Schicklichkeit
- Die moralische Grundhaltung
- Soziale Tugenden
- Reaktive Haltungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die bleibende Bedeutung von Adam Smiths Moralphilosophie, insbesondere im Kontext seiner „Theorie der moralischen Gefühle“ (TMG). Sie zeigt auf, wie Smith die scheinbar gegensätzlichen Ansätze von Kant (Universalität der Moral) und Hume (Moral als Empfinden) verbindet und erweitert. Ein Schwerpunkt liegt auf der systematischen Einordnung der TMG in die Moralphilosophie und ihrer Bedeutung für die heutige Ethik.
- Verbindung von Universalität und Sympathie in Smiths Moralphilosophie
- Die Rolle des unparteilichen Betrachters und seine Bedeutung für moralische Urteile
- Erweiterung der Moraltheorie um die Tugend der Schicklichkeit (Propriety)
- Analyse der moralischen Grundhaltung und sozialer Tugenden
- Bedeutung affektiver Harmonie im zwischenmenschlichen Zusammenleben
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Renaissance der Forschung zu Adam Smiths „Theorie der moralischen Gefühle“ (TMG) nach Ernst Tugendhats systematischer Einordnung der smithschen Moralphilosophie. Sie benennt das zentrale Anliegen der Arbeit: die Bedeutung der TMG für die Moralphilosophie aufzuzeigen und zu erklären, wie Smith eine Einbeziehung des Sinnenwesens in die universalistische Moral ermöglicht, im Gegensatz zu Kants Ansatz.
Verbindung von Universalität und Sympathie in Smiths TMG: Dieses Kapitel vergleicht die Moralphilosophien Kants und Humes, wobei Kant den Menschen als autonomes Vernunftwesen und Hume den Menschen als soziales Wesen mit moralischem Empfinden betrachtet. Smith gelingt es, diese scheinbar gegensätzlichen Positionen zu verbinden, indem er die Relationalität der Moralpsychologie, basierend auf Sympathie, durch den unparteilichen Betrachter auf eine universalistische Ebene hebt. Smiths erweiterter Sympathiebegriff, im Gegensatz zu Humes, bildet die Grundlage moralischer Urteile und ermöglicht die Einbeziehung des Sinnenwesens in eine universalistische Moral. Moralische Beurteilung erstreckt sich somit nicht nur auf Handlungen, sondern auch auf intersubjektive Haltungen.
Erweiterung der Moralphilosophie um die Tugend der Schicklichkeit: Dieses Kapitel erläutert, wie Smiths Moralphilosophie durch das Prinzip der Sympathie zu moralischen Urteilen führt und wie daraus positive und negative Pflichten (Tugenden der Gerechtigkeit und Wohltat) abgeleitet werden. Die universelle Gültigkeit dieser Tugenden wird durch den unparteilichen Betrachter erklärt, ähnlich wie bei Kants kategorischem Imperativ. Smith erweitert jedoch die kantische Moral um die affektive Seite des Menschen, die als „Schicklichkeit“ (Propriety) bezeichnet wird. Diese umfasst die moralische Grundhaltung (affektive Harmonie), soziale Tugenden (die aus der Grundhaltung resultieren) und Tugenden der schicklichen affektiven Reaktion. Das moralische Ideal besteht darin, mehr für andere als für sich selbst zu fühlen und die eigenen Affekte zugunsten wohlwollender zurückzunehmen.
Die moralische Grundhaltung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Fähigkeit des Menschen, an den Affekten anderer teilzunehmen und das Bedürfnis nach wechselseitigem Mitgefühl. Um dieses wechselseitige Mitfühlen zu ermöglichen, bedarf es einer spezifischen Grundhaltung: Selbstbeherrschung (für den Betroffenen) und Sensibilität (für den Zuschauer). Diese affektive Offenheit, die sowohl die Perspektive des Betroffenen als auch des Teilnehmenden berücksichtigt, ist eine notwendige Voraussetzung für affektive Harmonie. Die Arbeit vergleicht diese affektive Offenheit mit Habermas' Theorie des kommunikativen Handelns, wobei der Fokus hier auf einer emotionalen Ebene der Verständigung liegt, die über den bloßen Interessenausgleich hinausgeht.
Schlüsselwörter
Adam Smith, Theorie der moralischen Gefühle (TMG), Moralphilosophie, Universalität, Sympathie, unparteilicher Betrachter, Tugend der Schicklichkeit (Propriety), moralische Grundhaltung, soziale Tugenden, affektive Harmonie, Selbstbeherrschung, Sensibilität, Kant, Hume.
Häufig gestellte Fragen zu: Adam Smiths Theorie der moralischen Gefühle
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die bleibende Bedeutung von Adam Smiths Moralphilosophie, insbesondere seiner „Theorie der moralischen Gefühle“ (TMG). Sie zeigt auf, wie Smith scheinbar gegensätzliche Ansätze von Kant (Universalität der Moral) und Hume (Moral als Empfinden) verbindet und erweitert und ordnet die TMG systematisch in die Moralphilosophie ein.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Verbindung von Universalität und Sympathie in Smiths Moralphilosophie, die Rolle des unparteilichen Betrachters, die Erweiterung der Moraltheorie um die Tugend der Schicklichkeit (Propriety), die Analyse der moralischen Grundhaltung und sozialer Tugenden sowie die Bedeutung affektiver Harmonie im zwischenmenschlichen Zusammenleben.
Wie verbindet Smith Universalität und Sympathie?
Smith verbindet die scheinbar gegensätzlichen Positionen Kants (Autonomie des Vernunftwesens) und Humes (soziales Wesen mit moralischem Empfinden), indem er die Relationalität der Moralpsychologie, basierend auf Sympathie, durch den unparteilichen Betrachter auf eine universalistische Ebene hebt. Sein erweiterter Sympathiebegriff ermöglicht die Einbeziehung des Sinnenwesens in eine universalistische Moral.
Welche Rolle spielt der unparteiliche Betrachter?
Der unparteiliche Betrachter dient als Brücke zwischen individueller Erfahrung und universaler Moral. Er ermöglicht die Objektivierung moralischer Urteile und die Beurteilung von Handlungen und intersubjektiven Haltungen aus einer neutralen Perspektive, ähnlich dem kategorischen Imperativ Kants.
Was versteht Smith unter der Tugend der Schicklichkeit (Propriety)?
Smith erweitert die kantische Moral um die affektive Seite des Menschen, die „Schicklichkeit“ (Propriety). Sie umfasst die moralische Grundhaltung (affektive Harmonie), soziale Tugenden (aus der Grundhaltung resultierend) und Tugenden der schicklichen affektiven Reaktion. Das moralische Ideal besteht darin, mehr für andere als für sich selbst zu fühlen.
Wie beschreibt die Arbeit die moralische Grundhaltung?
Die moralische Grundhaltung zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, an den Affekten anderer teilzunehmen und das Bedürfnis nach wechselseitigem Mitgefühl zu haben. Sie erfordert Selbstbeherrschung (für den Betroffenen) und Sensibilität (für den Zuschauer) und ermöglicht affektive Harmonie. Die Arbeit vergleicht dies mit Habermas' Theorie des kommunikativen Handelns.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Verbindung von Universalität und Sympathie, ein Kapitel zur Erweiterung der Moralphilosophie um die Tugend der Schicklichkeit, sowie ein Kapitel zur moralischen Grundhaltung. Die Arbeit enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Adam Smith, Theorie der moralischen Gefühle (TMG), Moralphilosophie, Universalität, Sympathie, unparteilicher Betrachter, Tugend der Schicklichkeit (Propriety), moralische Grundhaltung, soziale Tugenden, affektive Harmonie, Selbstbeherrschung, Sensibilität, Kant, Hume.
- Quote paper
- Niels von Wardenburg (Author), 2010, Die bleibende Bedeutung von Adam Smiths Moralphilosophie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158321