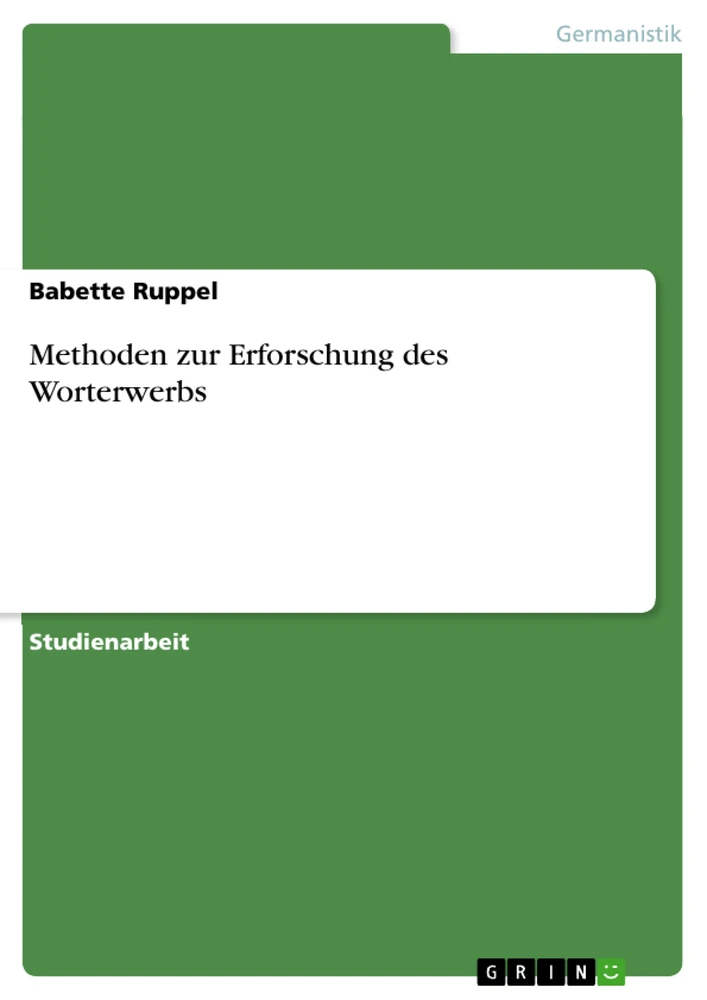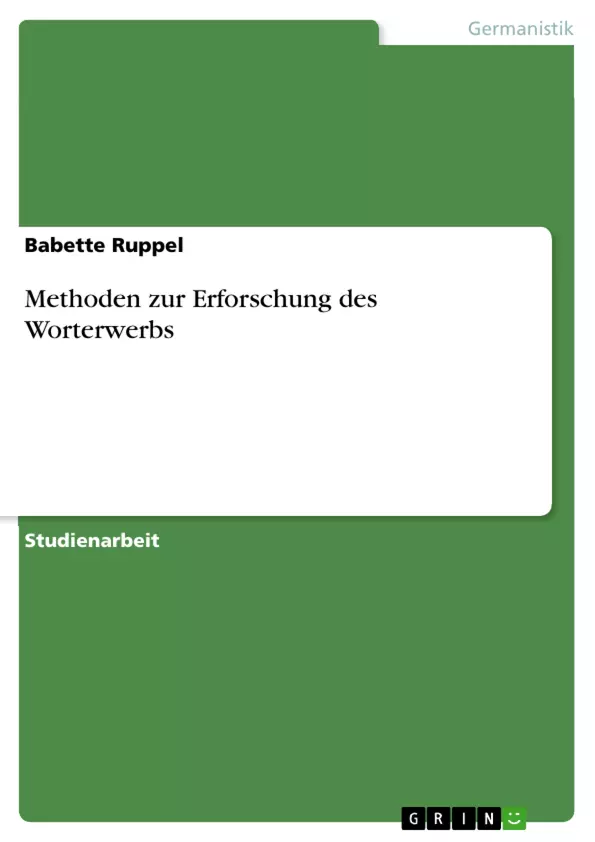Das Mentale Lexikon ist eine Art Speicher, der einen Großteil aller existierenden Wörter einer Sprache beinhaltet, auf die der Sprecher dieser Sprachgemeinschaft sowohl bei der Sprachproduktion als auch beim Sprachverstehen zurückgreifen kann. Sowohl der aktive als auch der passive Wortschatz des Sprechers sind hier verortet. Das Mentale Lexikon enthält für jedes verzeichnete Wort Informationen über Phonologie, Morphologie, Semantik, über die Wortklasse, Syntax und Orthographie. Dank des Mentalen Lexikons können wir auf gehörte Wörter zugreifen, sie verstehen und im Gegenzug eine Antwort konzeptualisieren, auf unser Lexikon zugreifen, Wörter auswählen, die Antwort formulieren und uns letztlich situativ angemessen äußern.
Benutzt unser Gesprächspartner ein unbekanntes Wort, dann werden wir es nicht verstehen, weil unser Lexikon hier eine Leerstelle aufweist. Das Mentale Lexikon ist also, grob gesagt, ein wohlstrukturiertes System, das es dem Sprecher ermöglicht, binnen Millisekunden ein bereits gespeichertes Wort zu erkennen oder aus dem Speicher abzurufen. Aber ab wann begreift ein Kind denn den Zusammenhang zwischen einem Wort und der dazugehörigen Bedeutung? Wann hat es ein Wort tatsächlich erworben?
Um dies herauszufinden, müssen wir uns der Methodik zuwenden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methoden zur Untersuchung von spontaner Sprachproduktion
- Transkription
- Methoden zur Untersuchung von fortgeschrittener Sprachproduktion
- Entlocken von Non-sense-Wörtern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Erforschung des mentalen Lexikons und des Worterwerbs bei Kindern. Sie erläutert den Begriff „mentales Lexikon“ und beleuchtet verschiedene Methoden, die zur Untersuchung des Worterwerbs eingesetzt werden.
- Die Bedeutung des mentalen Lexikons für Sprachproduktion und -verständnis
- Die verschiedenen Erklärungsansätze zum Spracherwerb, wie Behaviorismus, Kognitivismus und Nativismus
- Die Rolle des Interaktionismus und der sozialen Umwelt im Spracherwerb
- Methoden zur Untersuchung von spontaner Sprachproduktion, insbesondere die Transkription und die Verwendung von Datenbanken wie Childes
- Methoden zur Untersuchung von fortgeschrittener Sprachproduktion, insbesondere die Verwendung von Non-sense-Wörtern
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung definiert den Begriff „mentales Lexikon“ als einen Speicher für Wörter einer Sprache, auf den Sprecher sowohl bei der Sprachproduktion als auch beim Sprachverstehen zurückgreifen können. Sie diskutiert die verschiedenen Erklärungsansätze zum Spracherwerb, darunter Behaviorismus, Kognitivismus, Nativismus und Interaktionismus.
Methoden zur Untersuchung von spontaner Sprachproduktion
Dieser Abschnitt behandelt die Methode der Transkription als Werkzeug zur Untersuchung der Sprachentwicklung von Kindern. Er beschreibt die Verwendung von Tagebüchern, Kassettenaufnahmen und Videotapes sowie die Entwicklung von Datenbanken wie Childes.
Methoden zur Untersuchung von fortgeschrittener Sprachproduktion
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Verwendung von Non-sense-Wörtern zur Untersuchung der Sprachproduktion bei Kindern. Der Wug-Test von Jean Berko-Gleason wird als Beispiel für eine Methode zur Erforschung des Verständnisses grammatischer Regeln bei Kindern vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen dieser Hausarbeit sind: mentales Lexikon, Worterwerb, Spracherwerb, Behaviorismus, Kognitivismus, Nativismus, Interaktionismus, Sprachproduktion, Sprachverstehen, Transkription, Childes, Non-sense-Wörter, Wug-Test.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Mentalen Lexikon?
Das Mentale Lexikon ist ein im Gehirn verorteter Speicher, der Informationen über Wörter einer Sprache (Phonologie, Morphologie, Semantik, Syntax) enthält und sowohl beim Sprachverstehen als auch bei der Sprachproduktion genutzt wird.
Welche Rolle spielen Non-sense-Wörter in der Forschung?
Non-sense-Wörter werden verwendet, um zu untersuchen, ob Kinder grammatische Regeln (wie Pluralbildung) abstrahiert haben, da sie diese Wörter nicht auswendig gelernt haben können.
Was ist der Wug-Test?
Der Wug-Test von Jean Berko-Gleason ist eine Methode zur Erforschung des Verständnisses grammatischer Regeln bei Kindern unter Verwendung von Fantasiewörtern.
Welche Erklärungsansätze zum Spracherwerb gibt es?
Zu den zentralen Ansätzen gehören der Behaviorismus, Kognitivismus, Nativismus und der Interaktionismus.
Was ist CHILDES?
CHILDES ist eine internationale Datenbank, die Transkriptionen und Sprachdaten zur Untersuchung der kindlichen Sprachentwicklung bereitstellt.
Wie wird spontane Sprachproduktion untersucht?
Die Untersuchung erfolgt meist durch Transkriptionen von Tagebuchaufzeichnungen, Kassetten- oder Videoaufnahmen der natürlichen Kommunikation des Kindes.
- Quote paper
- Babette Ruppel (Author), 2004, Methoden zur Erforschung des Worterwerbs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158327