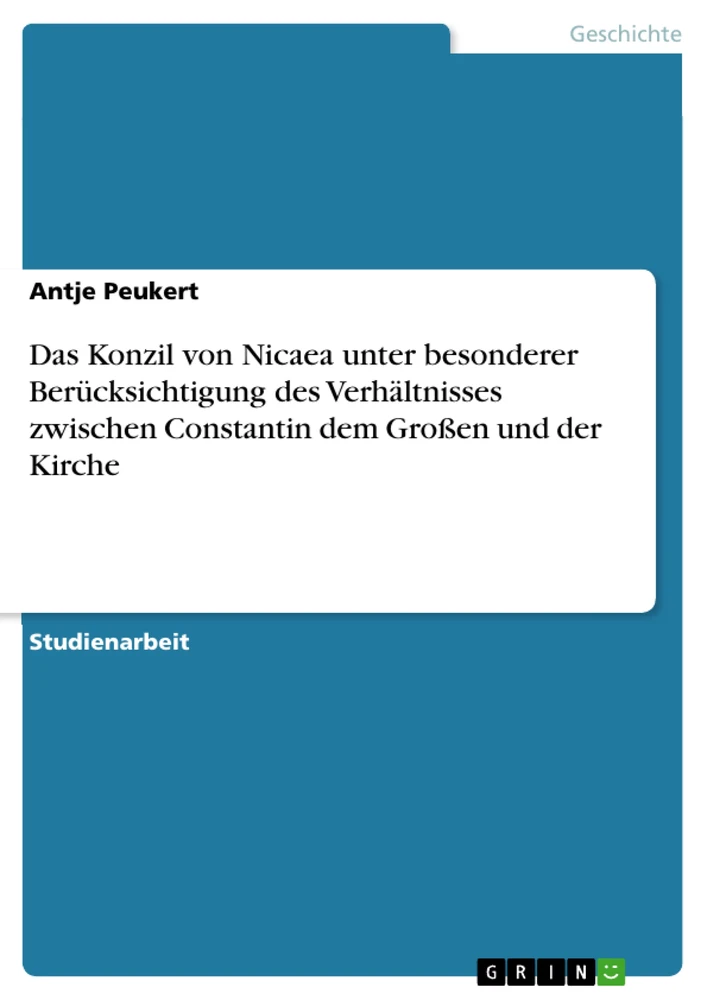325 n. Chr. rief Kaiser Constantin sämtliche Bischöfe des Römischen Reiches dazu auf, an einem allgemeinen Konzil in Nicaea teilzunehmen. Der kirchliche Zusammenhalt war von theologischen Streitigkeiten und Splittergruppen bedroht, und lokale Synoden konnten den Problemen nicht mehr gerecht werden, die eine Diskussion des gesamten Episkopats erforderten. Constantin als erster christlicher Kaiser nahm hierbei eine besondere Stellung ein. Er diente als Vermittler zwischen den streitenden Parteien und als Gastgeber und Organisator für das erste ökumenische Konzil in der Kirchengeschichte.
Für meine Arbeit stelle ich das Konzil von Nicaea in den Mittelpunkt, da es einen interessanten Hintergrund bietet, vor dem ich das Verhältnis zwischen Constantin und der christlichen Kirche beleuchte. Dies kann natürlich nur ein kleiner und aufgrund der Quellenlage auch nur ein begrenzter Ausschnitt eines dynamischen Prozesses sein, der wegen seiner Bedeutung für die Geschichte trotzdem große Beachtung verdient.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Konzil von Nicaea
- Einberufung der Bischöfe
- Eröffnung des Konzils
- Der Arianische Streit
- Der Verlauf des Konzils von Nicaea
- Die Rehabilitierung von Eusebios von Caesarea
- Die Nicaeanische Formel
- Das melitianische Schisma
- Der Ostertermin
- Die Nicaeanischen Canones
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Konzil von Nicaea im Jahr 325 n. Chr., insbesondere das Verhältnis zwischen Kaiser Konstantin dem Großen und der Kirche. Sie untersucht die Hintergründe und den Ablauf des Konzils, wobei der Fokus auf den Arianischen Streit und die Rolle Constantins als Vermittler zwischen den strittigen Parteien liegt. Die Arbeit betrachtet das Konzil als einen Wendepunkt in der Geschichte der Kirche und beleuchtet die Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Christentums.
- Die Einberufung des Konzils von Nicaea und die Rolle Constantins als Vermittler
- Der Arianische Streit und die Bedeutung des Glaubensbekenntnisses von Nicaea
- Die Rehabilitierung von Eusebios von Caesarea und die Auswirkungen auf die innerkirchliche Machtbalance
- Die Bedeutung des Konzils von Nicaea für die Entwicklung des christlichen Glaubens und die Organisation der Kirche
- Das Verhältnis zwischen Kirche und Staat im 4. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den historischen Kontext des Konzils von Nicaea dar und erklärt die Notwendigkeit eines allgemeinen Konzils im 4. Jahrhundert. Sie erläutert die Rolle Constantins als ersten christlichen Kaiser und die besondere Bedeutung des Konzils für die Geschichte des Christentums.
Das Konzil von Nicaea
Dieses Kapitel behandelt die Einberufung des Konzils, die Entscheidung für Nicaea als Tagungsort und die Gründe für die Ortswahl. Es werden auch die verschiedenen Quellen für die Rekonstruktion des Konzils und die umstrittene Zahl der teilnehmenden Bischöfe besprochen.
Der Verlauf des Konzils von Nicaea
Das Kapitel beschäftigt sich mit den zentralen Ereignissen des Konzils, darunter die Rehabilitierung von Eusebios von Caesarea, die Entwicklung der Nicaeanischen Formel und die Auseinandersetzung mit dem melitianischen Schisma. Es werden außerdem die Festlegung des Ostertermins und die Verabschiedung der Nicaeanischen Canones behandelt.
Schlüsselwörter
Das Konzil von Nicaea, Arianismus, Kaiser Konstantin, Nicaeanische Formel, Eusebios von Caesarea, Kirche und Staat, ökumenisches Konzil, Glaubensbekenntnis, melitianisches Schisma, Canones.
- Arbeit zitieren
- Antje Peukert (Autor:in), 2002, Das Konzil von Nicaea unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen Constantin dem Großen und der Kirche, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158353