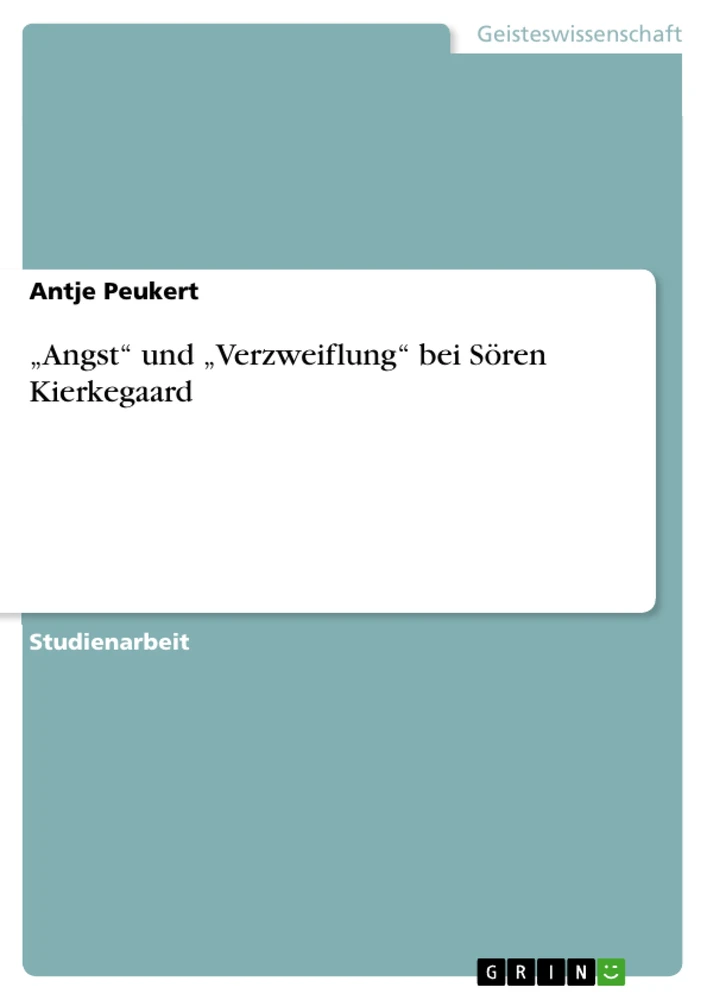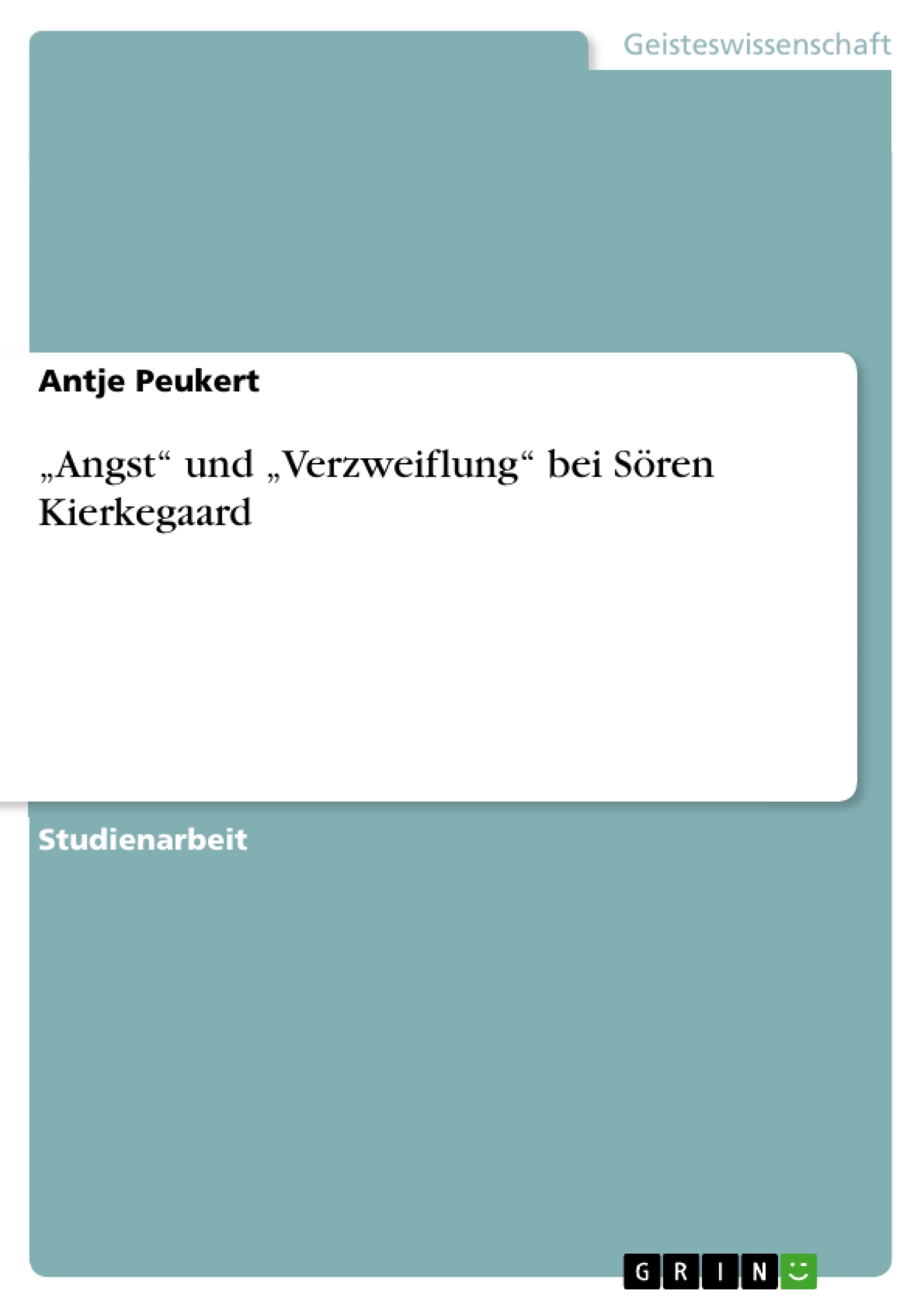Die Krankheit zum Tode ist von Sören Kierkegaard unter dem Pseudonym Anti-Climacus herausgegeben worden und beschreibt in Abgrenzung zu Climacus eine entschieden christliche Position innerhalb seiner philosophischen "Reflexion auf das Menschsein". Der Mensch ist eine Synthese von Endlichkeit und Unendlichkeit, Zeitlichem und Ewigem, von Freiheit und Notwendigkeit und das Selbst des Menschen ist das positive Dritte, das Verhältnis, das sich zu dieser Synthese bzw. zu sich selbst verhält. Ist dieses Selbst-/Verhältnis im Mißzustand, und nach Anti-Climacus betrifft dies den größten Teil der Menschheit, befindet man sich in der Verzweiflung, die die Krankheit zum Tode ist. Die Verzweiflung äußert sich in dreifacher Art und Weise: "verzweifelt sich nicht bewusst sein, ein Selbst zu haben (uneigentliche Verzweiflung); verzweifelt nicht man selbst sein wollen; verzweifelt man selbst sein wollen" (KT, 1 A). Die Überwindung der Verzweiflung, d.h. Geist zu werden, sich zu sich selbst zu verhalten und sich selbst zu akzeptieren ist die Aufgabe jedes einzelnen Menschen. Zugleich muss er die fremde Macht (Gott) anerkennen, die ihn gesetzt hat (KT, 1 A).
In der folgenden Analyse werde ich zwei Aspekte hervorheben, die mir als Eckpunkte in meiner Untersuchung dienen sollen. Der erste Aspekt beschäftigt sich mit dem Problem, wie es überhaupt zu einem Ungleichgewicht innerhalb des menschlichen Selbst kommen kann und der zweite wodurch das Gleichgewicht der Synthese wieder hergestellt werden kann.
In diesem Zusammenhang werde ich Parallelen zu Kierkegaards "Der Begriff Angst" ziehen, da Angst und Verzweiflung in seinen philosophisch-religiösen Gedanken eine enge Verbindung eingehen und beide Werke intertextuell verwendet aufschlussreich hinsichtlich der aufgeworfenen Fragestellungen sein könnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Der Ursprung der Verzweiflung
- 1.1 Selbstbewusstsein und Sündenbewusstsein
- 1.2 Der Begriff Angst
- 1.3 Die Gestalten der Verzweiflung
- 2. Die Möglichkeit der Freiheit
- 2.1 Der Weg zum Selbst
- 2.2 Verzweiflung als Bestimmung des Geistes
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Kierkegaards Konzepte von Angst und Verzweiflung, insbesondere in Bezug auf die "Krankheit zum Tode" und "Der Begriff Angst". Das Hauptziel ist es, den Ursprung der Verzweiflung und die Möglichkeiten ihrer Überwindung zu untersuchen. Dabei werden die Zusammenhänge zwischen Selbstbewusstsein, Sündenbewusstsein und dem Prozess der Selbstfindung beleuchtet.
- Der Ursprung der Verzweiflung im menschlichen Selbstverhältnis
- Die Rolle des Selbstbewusstseins und des Sündenbewusstseins
- Angst und Verzweiflung als miteinander verbundene Konzepte
- Die Möglichkeit der Freiheit und der Weg zur Selbstfindung
- Die Überwindung der Verzweiflung durch die Annahme der eigenen Endlichkeit und die Anerkennung Gottes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in Kierkegaards Werk "Die Krankheit zum Tode" ein, das eine entschieden christliche Position innerhalb seiner philosophischen Reflexionen zum Menschsein beschreibt. Der Mensch wird als Synthese von Endlichkeit und Unendlichkeit dargestellt, und Verzweiflung wird als ein Misszustand dieses Selbstverhältnisses definiert, welcher sich dreifach äußert: Nicht bewusst sein, ein Selbst zu haben; nicht man selbst sein wollen; man selbst sein wollen. Die Arbeit fokussiert auf den Ursprung dieses Ungleichgewichts und die Möglichkeiten, das Gleichgewicht wiederherzustellen, wobei Parallelen zu "Der Begriff Angst" gezogen werden.
1. Der Ursprung der Verzweiflung: Dieses Kapitel untersucht den Ursprung der Verzweiflung. Kierkegaard beschreibt den Menschen als eine Synthese aus gegensätzlichen Elementen (Unendlichkeit/Endlichkeit, Zeitlichkeit/Ewigkeit, Freiheit/Notwendigkeit). Die Verzweiflung entsteht aus dem Verhältnis dieser Synthese zu sich selbst, wobei Gott als derjenige dargestellt wird, der dieses Verhältnis ins Leben gerufen, aber auch losgelassen hat. Das Kapitel legt den Grundstein für die weitere Analyse, indem es das Konzept des "Selbst" als positives Drittes – das Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält – einführt. Es wird die Frage aufgeworfen, unter welchen Bedingungen die Setzung des Selbst erfolgt und welche Konsequenzen dies hat, wobei ein Bezug zu "Der Begriff Angst" hergestellt wird.
1.1 Selbstbewusstsein und Sündenbewusstsein: Dieser Abschnitt untersucht die Setzung des Selbst im Kontext des "qualitativen Sprungs". Dieser Sprung markiert den Übergang von Unschuld zu Schuld, von Unwissenheit zu Wissen und zum Erwachen des Selbstbewusstseins. Die Sünde wird als potentielle Möglichkeit im Menschen dargestellt, und der Sprung ist eng mit ihr verbunden. Der qualitative Sprung ist ein entscheidender Moment in der individuellen Geschichte, der den Übergang von einer unmittelbaren Einheit mit der Natürlichkeit zu einem selbstbewussten, aber auch schuldbewussten Dasein kennzeichnet.
2. Die Möglichkeit der Freiheit: Dieses Kapitel (welches, aufgrund der Kürze des vorliegenden Textes, nur fragmentarisch vorliegt) deutet auf die Möglichkeit der Freiheit und die Überwindung der Verzweiflung hin. Es wird die Frage nach dem Weg zum Selbst und der Bedeutung der Verzweiflung als Bestimmung des Geistes behandelt. Im Kontext des begrenzten Textauszugs kann der volle Umfang dieses Kapitels jedoch nicht vollständig dargestellt werden.
Schlüsselwörter
Sören Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode, Der Begriff Angst, Verzweiflung, Angst, Selbst, Selbstverhältnis, Sündenbewusstsein, Selbstbewusstsein, Freiheit, Gott, Synthese, Endlichkeit, Unendlichkeit, qualitative Sprung.
Häufig gestellte Fragen zu Kierkegaards Konzepten von Angst und Verzweiflung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Sören Kierkegaards Konzepte von Angst und Verzweiflung, insbesondere im Kontext seiner Werke "Die Krankheit zum Tode" und "Der Begriff Angst". Der Fokus liegt auf dem Ursprung der Verzweiflung und den Möglichkeiten ihrer Überwindung. Die Zusammenhänge zwischen Selbstbewusstsein, Sündenbewusstsein und dem Prozess der Selbstfindung werden beleuchtet.
Welche Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen sind der Ursprung der Verzweiflung im menschlichen Selbstverhältnis, die Rolle von Selbst- und Sündenbewusstsein, der Zusammenhang zwischen Angst und Verzweiflung, die Möglichkeit der Freiheit und der Weg zur Selbstfindung, sowie die Überwindung der Verzweiflung durch die Annahme der eigenen Endlichkeit und die Anerkennung Gottes.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, zwei Hauptkapitel ("Der Ursprung der Verzweiflung" und "Die Möglichkeit der Freiheit") und eine Schlussbetrachtung. Kapitel 1 untersucht den Ursprung der Verzweiflung anhand Kierkegaards Beschreibung des Menschen als Synthese gegensätzlicher Elemente. Kapitel 2 (fragmentarisch im vorliegenden Auszug) behandelt die Möglichkeit der Freiheit und die Überwindung der Verzweiflung. Die Einleitung führt in Kierkegaards Werk "Die Krankheit zum Tode" ein und definiert Verzweiflung als Misszustand des Selbstverhältnisses. Zusätzlich gibt es einen Abschnitt zu Selbstbewusstsein und Sündenbewusstsein.
Was ist der Ursprung der Verzweiflung laut Kierkegaard?
Laut Kierkegaard entsteht Verzweiflung aus dem Verhältnis des Menschen zu sich selbst als Synthese von Unendlichkeit und Endlichkeit, Zeitlichkeit und Ewigkeit, Freiheit und Notwendigkeit. Der Mensch ist ein Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält. Die Verzweiflung resultiert aus einem Ungleichgewicht in diesem Selbstverhältnis, wobei Gott als derjenige dargestellt wird, der dieses Verhältnis ins Leben gerufen, aber auch losgelassen hat.
Welche Rolle spielen Selbst- und Sündenbewusstsein?
Selbst- und Sündenbewusstsein sind eng miteinander verbunden. Der "qualitative Sprung" markiert den Übergang von Unschuld zu Schuld, von Unwissenheit zu Wissen und zum Erwachen des Selbstbewusstseins. Die Sünde wird als potentielle Möglichkeit im Menschen dargestellt, und der Sprung ist eng mit ihr verbunden. Dieser Sprung kennzeichnet den Übergang von einer unmittelbaren Einheit mit der Natürlichkeit zu einem selbstbewussten, aber auch schuldbewussten Dasein.
Wie kann Verzweiflung überwunden werden?
Der vorliegende Textauszug deutet darauf hin, dass die Überwindung der Verzweiflung mit der Möglichkeit der Freiheit und dem Weg zur Selbstfindung verbunden ist. Die vollständige Antwort auf diese Frage ist aufgrund der Kürze des Textes nicht vollständig enthalten. Es wird aber angedeutet, dass die Annahme der eigenen Endlichkeit und die Anerkennung Gottes eine Rolle spielen könnten.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Sören Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode, Der Begriff Angst, Verzweiflung, Angst, Selbst, Selbstverhältnis, Sündenbewusstsein, Selbstbewusstsein, Freiheit, Gott, Synthese, Endlichkeit, Unendlichkeit, qualitativer Sprung.
- Quote paper
- Antje Peukert (Author), 2003, „Angst“ und „Verzweiflung“ bei Sören Kierkegaard, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158363