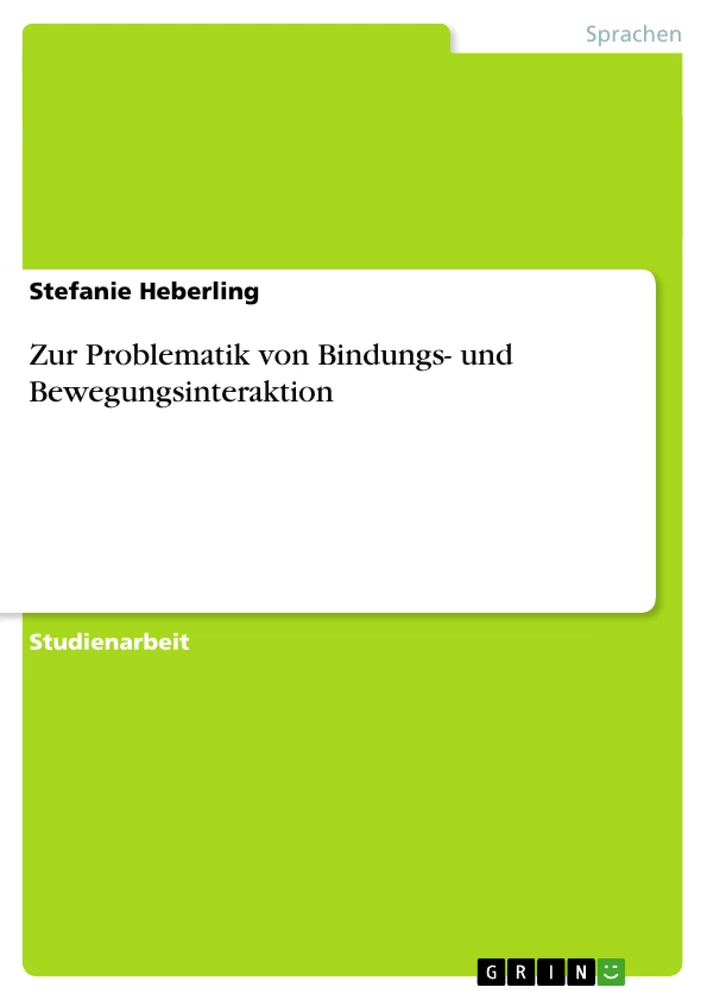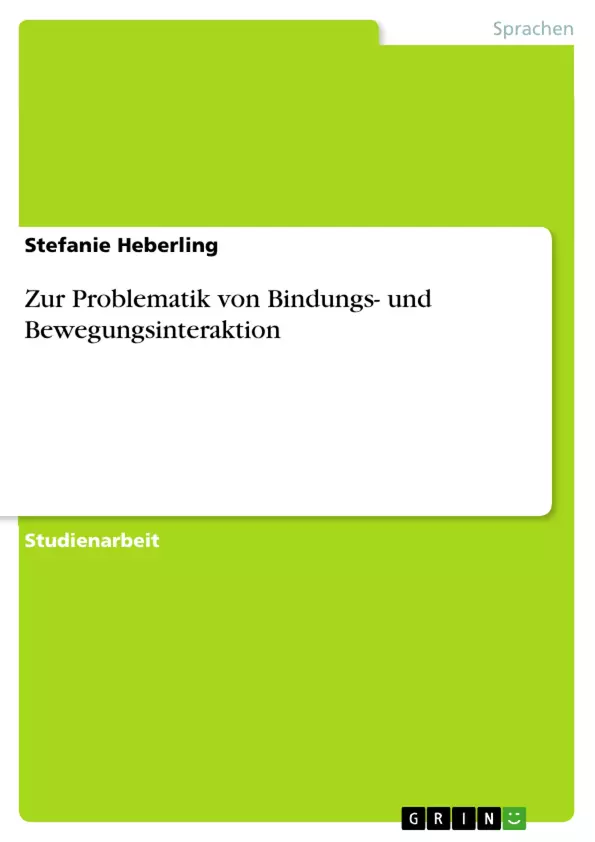Die vorliegende Arbeit behandelt ein Phänomen aus dem Bereich der Interaktion von Bindung und Bewegung. Dazu werden zunächst einige grundlegende Informationen zur Unterscheidung von A-Bewegung und A`-Bewegung geliefert. Die Unterscheidung der A-Bewegung und der A`-Bewegung wirft insofern eine interessante Frage auf, als dass sie einen Einfluss auf die in der GB angenommenen Bindungstheorie nimmt. Dabei sind besonders Fälle interessant, in denen die Bindungstheorie nicht auszureichen scheint. Es wird aufgezeigt, dass die in Kapitel 2 behandelten Phänomene über die allgemein definierte Bindungstheorie hinausgehen und somit ein Problem für die GB darstellen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Probleme, welche hinsichtlich der Bewegungs- und Bindungsinteraktion auftreten, darzustellen und aufzuzeigen, wie diese unter der HPSG erfasst werden können
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Government and Binding Theorie
- Die Bindungstheorie
- A-Bewegung und A' Bewegung
- Head-Driven Phrase Structure Grammar
- Die Bindungstheorie
- HPSG - Eine Alternative
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Interaktion von Bindung und Bewegung in der Sprachwissenschaft. Sie beleuchtet insbesondere die Unterschiede zwischen A-Bewegung und A'-Bewegung und deren Einfluss auf die Bindungstheorie im Rahmen der Government and Binding (GB) Theorie. Das Ziel ist es, die Probleme aufzuzeigen, die bei der Interaktion von Bewegung und Bindung auftreten, und zu demonstrieren, wie diese Probleme im Rahmen der Head-Driven Phrase Structure Grammar (HPSG) gelöst werden können.
- Unterscheidung von A-Bewegung und A'-Bewegung
- Die Bindungstheorie in der GB
- Probleme der Bindungstheorie im Kontext von Bewegung
- Die Bindungstheorie in der HPSG
- Lösung der Probleme der Bindungstheorie im Rahmen der HPSG
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung gibt einen Überblick über die Problematik der Interaktion von Bindung und Bewegung und die Ziele der Arbeit.
- Government and Binding Theorie (Kapitel 2): Dieses Kapitel behandelt die Bindungstheorie der GB, einschließlich der Bindungsprinzipien und des C-Kommandos. Es wird gezeigt, dass die Bindungstheorie Probleme aufwirft, wenn man sie auf Phrasenbewegungen anwendet.
- A-Bewegung und A' Bewegung (Kapitel 2.2): Dieses Kapitel erläutert die Unterscheidung zwischen A-Bewegung und A'-Bewegung und analysiert, wie diese Bewegungstypen die Bindungsverhältnisse beeinflussen.
- Head-Driven Phrase Structure Grammar (Kapitel 3): Kapitel 3 stellt die Bindungstheorie der HPSG dar und zeigt, wie diese Theorie die Probleme der Bindungs-/Bewegungsinteraktion, die in Kapitel 2 aufgezeigt wurden, lösen kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Bindungstheorie, Bewegungstypen (A-Bewegung und A'-Bewegung), Government and Binding (GB) Theorie, Head-Driven Phrase Structure Grammar (HPSG), Bindungsprinzipien, C-Kommando, Theta-Rolle, und die Interaktion von Bewegung und Bindung in der Sprachwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen A-Bewegung und A'-Bewegung?
A-Bewegung bezieht sich auf Bewegungen in Argumentpositionen (z. B. Passiv), während A'-Bewegung Bewegungen in Nicht-Argumentpositionen (z. B. W-Fragen oder Topikalisierung) beschreibt.
Welche Probleme hat die Government and Binding (GB) Theorie mit Bindung?
In der GB-Theorie führen Phrasenbewegungen oft zu Konstellationen, in denen die klassischen Bindungsprinzipien und das C-Kommando nicht ausreichen, um die grammatischen Verhältnisse korrekt zu erklären.
Was ist das C-Kommando?
C-Kommando ist eine strukturelle Beziehung in einem Syntaxbaum, die definiert, welche Knoten andere Knoten „beherrschen“. Sie ist die Grundlage für die Anwendung der Bindungsprinzipien.
Wie löst die HPSG Probleme der Bindungsinteraktion?
Die Head-Driven Phrase Structure Grammar (HPSG) nutzt eine andere Architektur (Merkmalsstrukturen), die Bindungsverhältnisse über die Argumentstruktur (SUBCAT-Listen) statt über rein geometrische Baumstrukturen definiert.
Was sind Theta-Rollen in diesem Kontext?
Theta-Rollen beschreiben die semantischen Rollen (z. B. Agens, Patiens), die Argumente in Bezug auf ein Verb einnehmen. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Verknüpfung von Bewegung und Bindung.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Heberling (Autor:in), 2007, Zur Problematik von Bindungs- und Bewegungsinteraktion, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158371