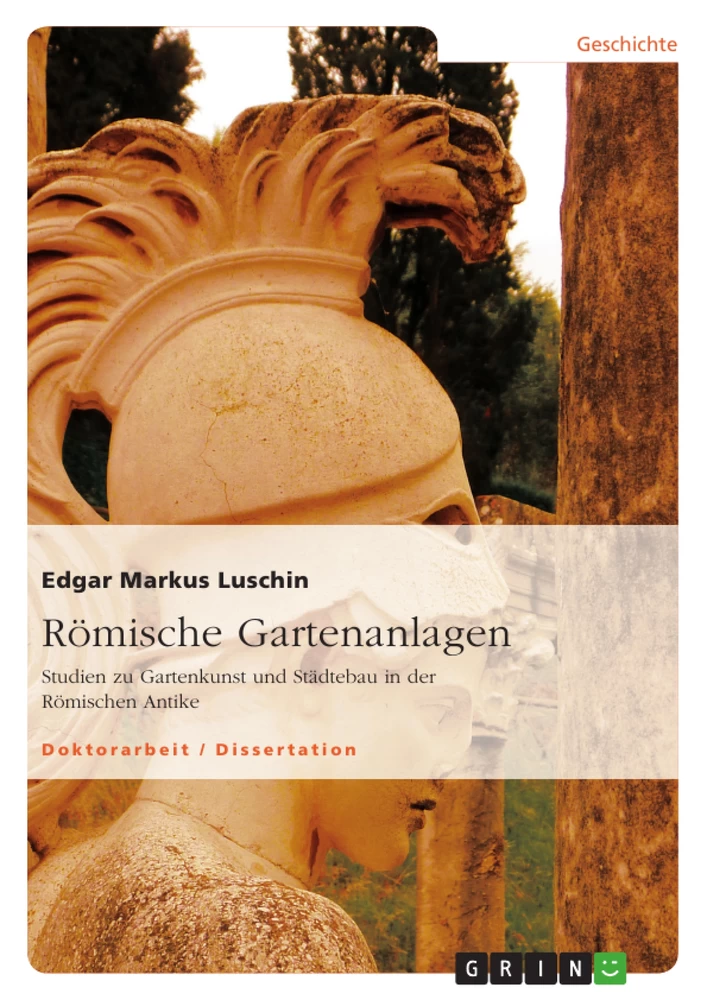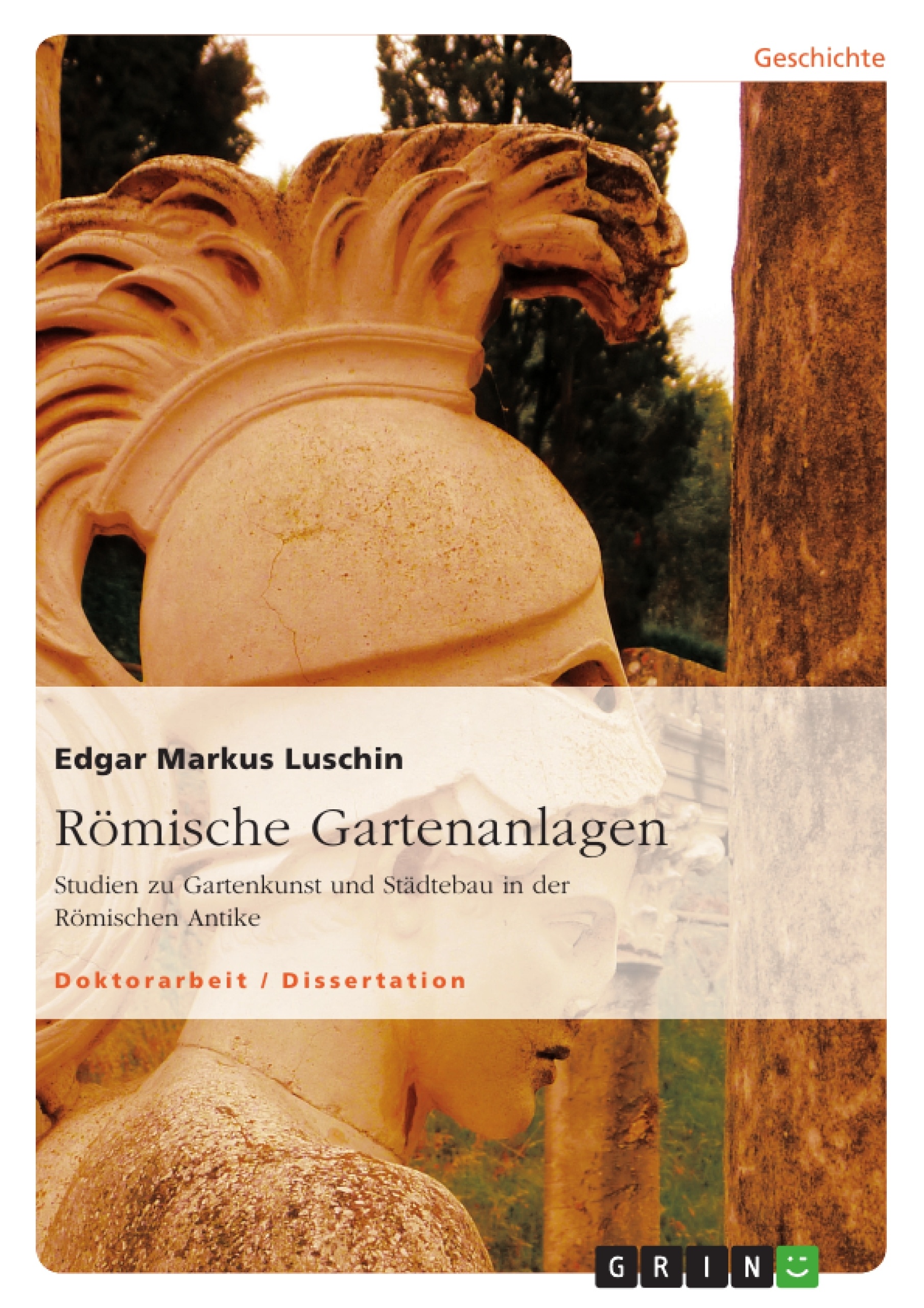Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit der Entwicklung und den Einsatzmöglichkeiten von Garten- und Parkanlagen in der römischen Urbanistik. Als geographischer Rahmen wurden Italien und die westlichen Provinzen des Römischen Reiches gewählt.
Im Gegensatz zu Gärten in Wohnhäusern und Villenanlagen stellten öffentliche Parkanlagen bislang keinen eigenen Forschungsschwerpunkt dar und ist daher kaum ins Bewusstsein gerückt, dass das Erscheinungsbild eines Großteils der römischen Städte durch prächtige Grünanlagen entscheidend geprägt war. In Heiligtümern, Theaterbauten, Thermen, Sport- und Freizeitanlagen aber auch an Grabbauten waren die Grünflächen bedeutender Bestandteil der Funktion und trugen entscheidend zur Lebensqualität des antiken Menschen bei.
Die naturgemäß schmale Basis für die Rekonstruktion von Gartenbefunden machte es erforderlich, sämtliche antike Quellengattungen (archäologische und epigraphische Befunde, Wandmalerei, Reliefs, literarische Quellen) zur Beantwortung der Fragestellung heranzuziehen. Auch waren immer wieder Vergleiche mit Gartenanlagen von Wohnbauten, welche besonders in den Vesuvstädten ungleich besser erforscht sind, angebracht, um Rückschlüsse auf die Gestaltung öffentlicher Parks und ihre Ausstattung mit Beeten, Skulpturen und Brunnenanlagen zu ziehen.
Ausgehend von einem Überblick über die Einsatzmöglichkeiten von Gärten im Orient, im klassischen Griechenland und den hellenistischen Städten wird nach möglichen Vorbildern und den Ursprung der römischen Parkanlagen gefragt. Weiters wird versucht zu klären, in wieweit Gestaltungsprinzipien die durch literarische und archäologische Quellen für Gärten in Villen überliefert sind, auch bei öffentlichen Anlagen zur Anwendung gelangten. Eine besondere Charakteristik der römischen Parkanlagen ist ihre Abhängigkeit von der sie umgebenden Architektur, eine Eigenart, welche sie vom Renaissancegarten oder dem Landschaftsgarten des 19. Jht. strikt unterscheidet.
Der zweite Teil der Untersuchung besteht in einem ausführlichen Denkmälerkatalog. Neben bibliographischen Angaben werden die Baugeschichte und die Rekonstruktion der Einzeldenkmäler diskutiert. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Untersuchungsgegenstand und Problemstellung
- Forschungsgeschichtlicher Überblick
- Entstehung von Gärten und Parks in Italien
- Die Vorläufer der griechischen Welt
- Die Zeit bis Alexander dem Großen
- Die Zeit bis Alexander dem Großen
- Gymnasia und „Philosophengärten“
- Die hellenistische Zeit
- Alexandria
- Die Zeit bis Alexander dem Großen
- Italien
- Lateinische Terminologie
- Die Anfänge
- Grünanlagen als Ausstattung von Heiligtümern
- Kultbezirke von gallo-römischem Charakter
- Die Monumentalisierung des öffentlichen Gartens
- Privatgärten in der Stadt
- Gärten in sepulkralem Kontext
- Gestaltung und Aussehen römischer Gärten
- Quellen
- Die lateinische Literatur
- Die Villenbriefe des Jüngeren Plinius
- Gartenanlagen im Werk des Vitruv
- Gartendarstellungen in der römischen Wandmalerei
- Reliefdarstellungen römischer Gärten
- Darstellungen römischer Gärten auf Marmorplänen
- Pflanzenspuren im archäologischen Befund
- Die lateinische Literatur
- Die Ausstattung öffentlicher Gärten
- Die gestalterische Bepflanzung von Gärten
- Brunnen- und Bewässerungsanlagen
- Skulpturenausstattung
- Quellen
- Gärtner
- Gartenwerkzeuge und Pflanztechnik
- Die Rezeption des römischen Gartens
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studie soll die Rolle von Garten- und Parkanlagen in der römischen Urbanistik untersuchen. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung öffentlicher Grünflächen in Italien und den westlichen Provinzen des Römischen Reiches.- Bedeutung von Garten- und Parkanlagen in der römischen Stadtkultur
- Einfluss griechischer und hellenistischer Vorbilder auf die Gestaltung römischer Gärten
- Vergleichende Analyse von Gartenanlagen in öffentlichen und privaten Kontexten
- Herausarbeiten spezifischer Gestaltungsprinzipien und -elemente römischer Gärten
- Rolle von Gärten in der Selbstdarstellung und Machtdemonstration der römischen Elite
Zusammenfassung der Kapitel
- Untersuchungsgegenstand und Problemstellung: Die Studie analysiert die Rolle des Gartens im öffentlichen Raum der römischen Antike und beleuchtet die Herausforderungen seiner Rekonstruktion aufgrund fehlender Quellenmaterial.
- Forschungsgeschichtlicher Überblick: Die Arbeit zeichnet einen Überblick über die Entwicklung der Gartenforschung in den letzten 150 Jahren und zeigt die Herausforderungen der Rekonstruktion des antiken Gartens auf.
- Entstehung von Gärten und Parks in Italien: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung von Gartenanlagen von ihren Anfängen in der griechischen Welt bis zum Aufstieg Roms als Großmacht. Es vergleicht städtebauliche Zielsetzungen und Gestaltungselemente in verschiedenen Epochen und untersucht die Rolle von Hainen, Gymnasien, Philosophengärten und Paradeisoi.
- Lateinische Terminologie: Das Kapitel analysiert die unterschiedlichen Bezeichnungen für Grünanlagen im Lateinischen, um Einblicke in die Vorstellungswelt der Römer zu gewinnen.
- Die Anfänge: Dieses Kapitel untersucht die Anfänge der gezielten Gestaltung von Grünflächen in italienischen Städten. Es analysiert die Rolle von Hainen als sakrale Orte und die Entwicklung von profanen Freiflächen.
- Grünanlagen als Ausstattung von Heiligtümern: Das Kapitel analysiert die Rolle von Hainen als Bestandteil von Heiligtümern. Es beleuchtet die Bedeutung der Natur im Kultgeschehen und untersucht verschiedene Gestaltungsprinzipien und Beispiele aus Italien und den Provinzen.
- Kultbezirke von gallo-römischem Charakter: Dieses Kapitel untersucht die Besonderheiten gallo-römischer Heiligtümer, die neben Kultbauten oft auch Theater, Amphitheater und Thermen enthielten. Die Studie analysiert die Rolle der Natur im keltischen und germanischen Kultgeschehen und untersucht die Entstehung dieser Heiligtümer.
- Die Monumentalisierung des öffentlichen Gartens: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung der Monumentalisierung öffentlicher Gärten in Rom. Es analysiert die Bedeutung von Großportiken und deren Ausstattung mit Skulpturen und Grünflächen.
- Privatgärten in der Stadt: Das Kapitel untersucht die Bedeutung von Privatgärten in der römischen Stadtkultur, vor allem in Rom. Es beleuchtet die gesellschaftliche Entwicklung dieser Gärten und die Rolle, die sie in der Selbstdarstellung und Machtlegitimation der römischen Elite spielten.
- Gärten in sepulkralem Kontext: Dieses Kapitel untersucht die Gestaltung von Grabgärten in der römischen Antike. Es analysiert die Bedeutung von Gärten als locus amoenus und untersucht die Gestaltungsprinzipien und -elemente von Grabgärten.
- Die Ausstattung öffentlicher Gärten: Das Kapitel analysiert die gestalterischen Elemente öffentlicher Gärten, darunter die Bepflanzung, Brunnen und Skulpturenausstattung. Es untersucht den Einfluss von opus topiarium und beleuchtet die Verwendung von verschiedenen Pflanzenarten.
- Gärtner: Das Kapitel untersucht den Berufsstand der Gärtner in der römischen Antike. Es analysiert die Spezialisierung der Gartenberufe und beleuchtet die soziale Stellung von Gärtnern.
- Gartenwerkzeuge und Pflanztechnik: Dieses Kapitel untersucht die Werkzeuge und Pflanztechniken im antiken Garten. Es analysiert die Funktionsweise und Verbreitung verschiedener Werkzeuge und beleuchtet die Bedeutung von Pflanzgruben und Töpfen.
- Die Rezeption des römischen Gartens: Dieses Kapitel untersucht die Rezeption des römischen Gartens in der Kunst und Architektur der Neuzeit. Es beleuchtet die Faszination für antike Gartenkunst in der Renaissance und im Barock und analysiert die Entstehung von antikisierenden Gärten in europäischen Palästen.
- Resümee: Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammen und unterstreicht die Bedeutung des römischen Gartens für die Stadtkultur. Es beleuchtet die verschiedenen Funktionen von Gärten und ihre Rolle in der Selbstdarstellung und Machtlegitimation der römischen Elite.
Schlüsselwörter
römische Gartenanlagen, öffentliche Grünflächen, Städtebau, Gartenkunst, Urbanistik, Heiligtümer, Theater, Thermen, Sport- und Freizeitanlagen, Grabgärten, Bepflanzung, Skulpturen, Brunnen, opus topiarium, Gärtner, Werkzeuge, Pflanztechniken, Rezeption, Renaissance, Barock, Antike, Roma, Italien, ProvinzenHäufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten Gärten in der römischen Stadt?
Gärten waren ein entscheidender Bestandteil der Urbanistik. Sie dienten nicht nur dem privaten Luxus, sondern prägten als öffentliche Grünanlagen in Heiligtümern, Thermen und Theatern die Lebensqualität.
Woher nahmen die Römer ihre Vorbilder für Parkanlagen?
Wichtige Einflüsse stammten aus dem Orient, dem klassischen Griechenland (Gymnasien) und den hellenistischen Städten wie Alexandria.
Was ist "opus topiarium"?
Es bezeichnet die römische Kunst des Formschnitts von Pflanzen, bei der Hecken und Sträucher in künstlerische oder geometrische Formen gebracht wurden.
Wie wurden römische Gärten ausgestattet?
Typische Elemente waren Brunnen- und Bewässerungsanlagen, Skulpturen, Portiken sowie Beete mit einer Vielfalt an Zierpflanzen.
Gab es spezielle Gärten für die Toten?
Ja, Grabgärten waren im sepulkralen Kontext weit verbreitet. Sie sollten den Ort der Bestattung in einen "locus amoenus" (lieblichen Ort) verwandeln.
- Die Vorläufer der griechischen Welt
- Citar trabajo
- Dr. MMag. Edgar Markus Luschin (Autor), 2008, Römische Gartenanlagen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158402