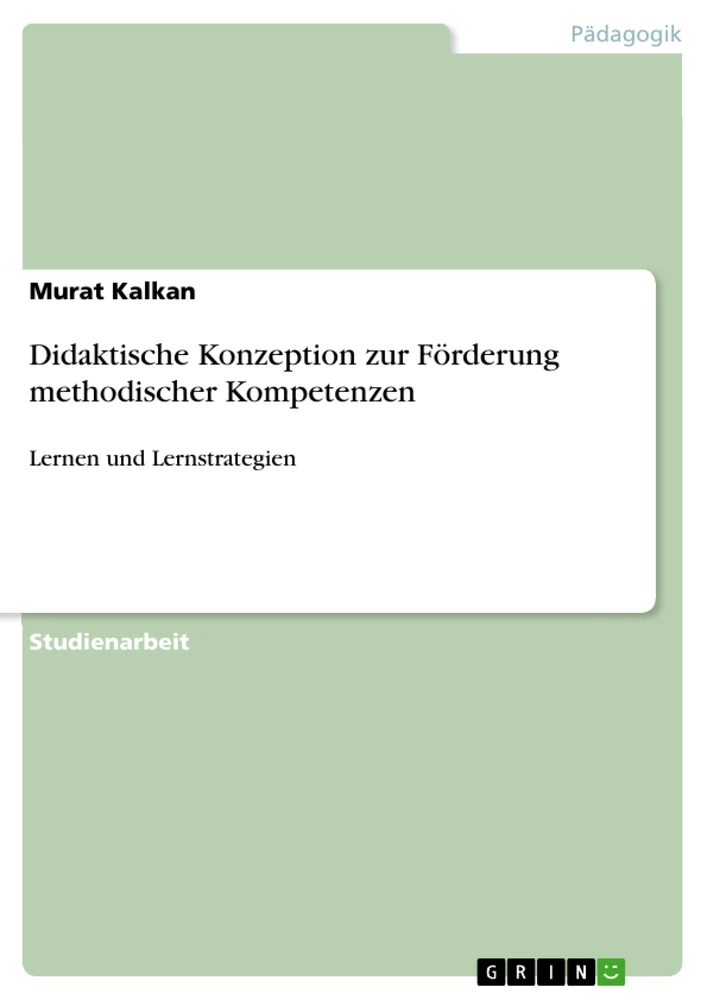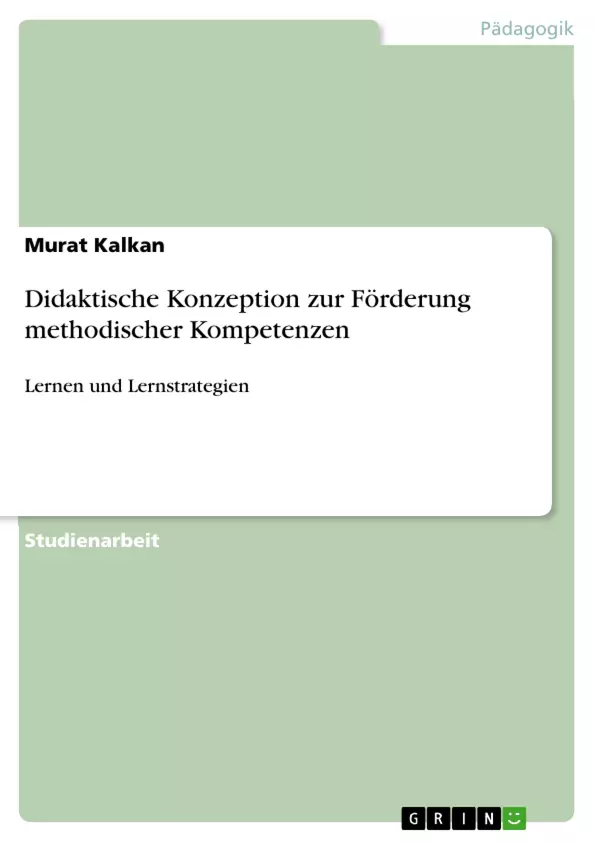1. Einleitung
Wissen aneignen, Erkenntnisse gewinnen, Bildung erhalten, Lernen … das alles sind Themen, die nicht erst in unserer Zeit durch PISA oder andere Studien an Aktualität gewonnen haben. Der Prozess des Lernens begleitet die Menschheit und jedes einzelne Individuum seit jeher. Bereits in der Antike hat Platon mit seinem Höhlengleichnis (Ebert 1974:195) den Grundstein für die Erkenntnistheorie gelegt. Im Laufe der Geschichte entwickelten sich immer wieder neue Ansätze und Interpretationen zu diesen Themen. So hat beispielsweise Comenius (Filt¬ner 1966:1) mit seinem Grundsatz „omnes omnia omnino“ im 17. Jahrhundert eine neue, frei¬ere Pädagogik in Deutschland initiiert. Und Humboldt’s Bildungsideal (Menze 1975:235) im 19. Jahrhundert favorisierte eine ganzheitliche Ausbildung. Bis dato legte man den Schwer¬punkt des Lernens auf die Inhalte, aber seit dem 20. Jahrhundert befassen sich Forscher welt¬weit explizit mit Lerntheorien, um den Lernprozess zu verstehen und zu erklären.
Wir wissen heute, dass Lernen ein Prozess ist, der die Verhaltensweise des Lerners ändert (Sloane 2003:13), jedoch sehen viele den Lerner noch als ein Objekt an, dem Wissen vermit¬telt werden muss (Kath 2004:1). Sloane (2003:15) betont, dass es Unterschiede in der Qualität des Lernens gibt, zum einen der dirigistische Unterrichtsstil, der wenig Freiräume lässt, zum anderen gibt es aber auch ausreichend Möglichkeiten, den Lerner zu einem selbständigen und eigenaktiven Lernprozess aufzufordern. De facto ist es aber der Lerner selber, der sich Wissen und Fähigkeiten aneignen muss (Kath 2004:1) und folglich bedarf er Methoden, die ihm die¬ses ermöglichen. Aus diesem Grund verlangt Kath (2004:10), dass der Unterricht von heute den Lerner dazu befähigen muss, sich selbständig und aktiv das beizubringen, was er und die Gesellschaft fordern. Dazu gehört unter anderem auch das lebenslange Lernen (BLK 2004:12 ff.), das von dem Lerner ein selbstverantwortliches und selbst gesteuertes Lernen verlangt. Diese Forderung wird im Sinne eines strategischen Ansatzes formuliert und drückt folglich implizit den Bedarf und Einsatz von Lernstrategien und Lerntechniken aus.
Gemäß diesem Postulat sieht unsere didaktische Konzeption die Motivation der Lernenden zu einer eigenständigen Anwendung von Lernstrategien und Techniken im Rahmen einer vollständigen Handlung vor.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beschreibung der Intention und der Lernziele
- Bedingungsanalyse der Zielgruppe
- Didaktische Gestaltung der Lerneinheit
- Konzeptionelle Grundlage
- Überlegungen zur methodischen Vorgehensweise
- Methodenwahl und Medieneinsatz
- Abläufe
- Von der Informationsphase zu den Ausführungsphasen
- Kontrollphase und Auswertungsphase zur Sicherung der Zielerreichung
- Aspekte zur Erreichung der formulierten Ziele und Kompetenzen
- Störung der Zielerreichung
- Alternativen bei Störungen
- Schlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
- Onlinequellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende didaktische Konzeption zielt darauf ab, Studierende in der eigenständigen Anwendung von Lernstrategien und Techniken im Rahmen einer vollständigen Handlung zu motivieren. Die Arbeit baut auf dem Implikationszusammenhang auf und berücksichtigt die Aspekte Zielgruppe, Intention, Thematik, Methodik und Medien.
- Förderung der methodischen Kompetenzen von Studierenden
- Vermittlung von Lernstrategien und Techniken
- Aktivierung der Studierenden zur selbständigen Anwendung von Lernmethoden
- Integration der SMART-Formel zur Entwicklung von Kompetenzbeschreibungen
- Einbezug unterschiedlicher Lerntypen und Lernstrategien
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Relevanz des Themas Lernen und Lernstrategien im Kontext von Bildung und gesellschaftlichen Anforderungen. Sie skizziert historische Entwicklungen in der Pädagogik und verweist auf den Wandel vom reinen Wissenserwerb hin zu einem prozessorientierten, selbstgesteuerten Lernverständnis.
- Beschreibung der Intention und der Lernziele: Dieser Abschnitt beschreibt die Intention der didaktischen Konzeption und die Lernziele, die in der Unterrichtseinheit erreicht werden sollen. Die Autoren betonen die Relevanz eigener Lernerfahrungen, den Bedarf an Kompetenzvertiefung im Bereich Lernstrategien und die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Bachelor-Studierenden.
Schlüsselwörter
Die vorliegende didaktische Konzeption konzentriert sich auf die Schlüsselthemen Lernstrategien, methodische Kompetenz, Selbstständigkeit im Lernen, SMART-Formel, Lerntypen und die Anwendung von Lerntechniken im Kontext einer vollständigen Handlung. Die Arbeit basiert auf einem umfassenden Verständnis von Lernen als aktivem Prozess, der individuelle Strategien und Techniken erfordert, um Wissen effektiv zu erwerben und anzuwenden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der didaktischen Konzeption?
Ziel ist die Förderung methodischer Kompetenzen bei Studierenden, um sie zur eigenständigen Anwendung von Lernstrategien und Techniken im Sinne des lebenslangen Lernens zu befähigen.
Warum ist selbstgesteuertes Lernen heute so wichtig?
In der modernen Wissensgesellschaft müssen Individuen in der Lage sein, sich Wissen aktiv und selbstverantwortlich anzueignen, da rein dirigistischer Unterricht den aktuellen Anforderungen nicht mehr genügt.
Wie wird die SMART-Formel in der Arbeit genutzt?
Die SMART-Formel dient zur Entwicklung präziser Kompetenzbeschreibungen und Lernziele, die spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert sind.
Was bedeutet das Prinzip der vollständigen Handlung?
Es beschreibt einen Lernprozess, der von der Information über die Planung und Ausführung bis hin zur Kontrolle und Auswertung reicht, um eine ganzheitliche Kompetenzentwicklung zu sichern.
Welche Rolle spielen unterschiedliche Lerntypen?
Die Konzeption berücksichtigt verschiedene Lerntypen und Lernstrategien, um sicherzustellen, dass die methodische Vorgehensweise die individuellen Bedürfnisse der Zielgruppe abdeckt.
- Quote paper
- Dipl. Hdl. Murat Kalkan (Author), 2007, Didaktische Konzeption zur Förderung methodischer Kompetenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158515