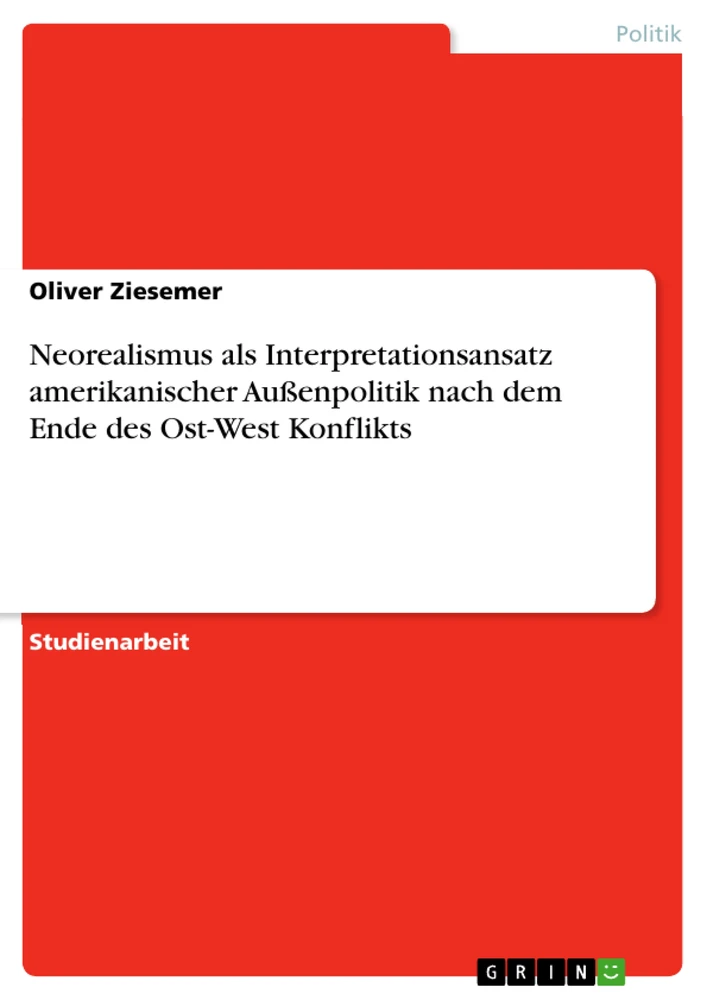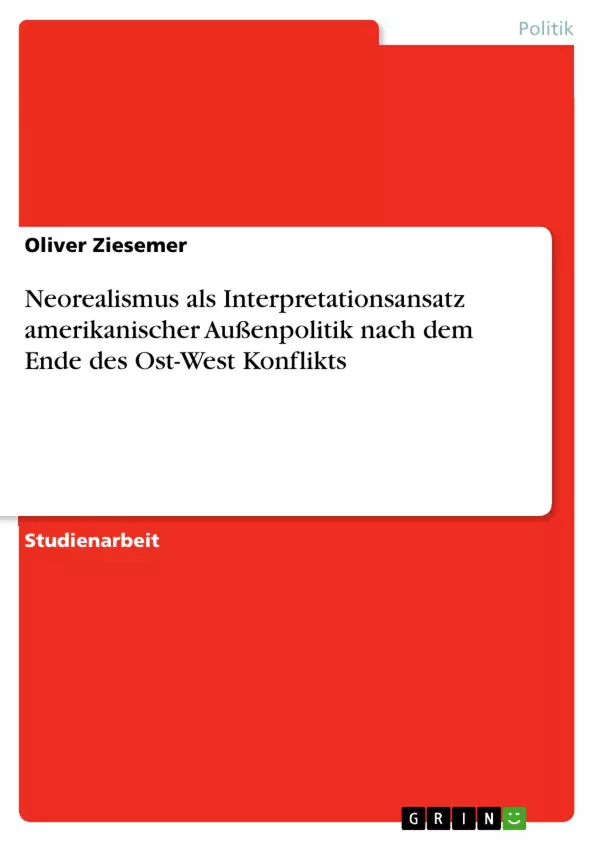Auf die politikwissenschaftliche Teildisziplin der Internationalen Beziehungen (IB) hatte die Theorie des Neorealismus prägenden Einfluss. Dieser wird auch als struktureller Realismus bezeichnet, da die Struktur des internationalen Systems die Analyseebene darstellt. In der Tradition des klassischen Realismus, mit seinen prägenden Autoren wie Hans Morgenthau und Edward H. Carr stehend, greift der Neorealismus zwar einige Grundannahmen auf, geht jedoch in Fragen der Theoriebildung über diesen hinaus. Im Rahmen dieser Hausarbeit wird darauf eingegangen welche Rolle der Neorealismus als Interpretationsansatz amerikanischer Außenpolitik einnimmt. Auf den klassischen Realismus nach Hans Morgenthau bezugnehmend, werden die Grundlagen und Modifikationen der neorealistischen Theorie von Kenneth Waltz und die Ausdifferenzierung von John Mearsheimer erläutert. Im weiteren Verlauf wird anhand vier prägender Essays eben genannter Autoren, die allesamt zwischen 1990 und 2000 erschienen sind chronologisch gezeigt, wie durch den Neorealismus die Ordnung in Europa nach dem Ende des Ost-West Konfliktes zu erklären ist, welche globalen ordnungspolitischen Möglichkeiten daraus resultieren und wie die Rolle internationaler Organisationen in diesem Zusammenhang zu bewerten ist. Auf Basis einer bissigen Fundamentalkritik am liberalen Institutionalismus widerlegen Waltz und Mearsheimer die aus ihrer Sicht haltlose Feststellung, dass der Neorealismus nach dem Ende der Blockkonfrontation seine Erklärungskraft zu den Vorgängen innerhalb der internationalen Beziehungen eingebüßt hätte. Am Ende werden die Ergebnisse zusammengefasst und dahingehend überprüft, inwiefern der Neorealismus die Entwicklung der internationalen Beziehungen nach 1990 schlüssig erklären kann und welche Interpretationsschwächen dieser aufweist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Neorealismus nach Kenneth Waltz und John Mearsheimer
- Neorealismus als Interpretationsansatz zum Verständnis der amerikanischen Außenpolitik nach dem Ende des Ost-West Konfliktes
- Back to the Future
- The Emerging Structure of International Politics
- The False Promise of International Institutions
- Structural Realism after the Cold War
- Kontroverse über den strukturellen Realismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Rolle des Neorealismus als Interpretationsansatz der amerikanischen Außenpolitik nach dem Ende des Kalten Krieges. Sie beleuchtet die Grundannahmen und Modifikationen der neorealistischen Theorie von Kenneth Waltz und John Mearsheimer, sowie die Anwendung des Ansatzes auf konkrete Entwicklungen der internationalen Beziehungen.
- Relevanz des Neorealismus für das Verständnis der internationalen Beziehungen nach dem Kalten Krieg
- Anwendung des Neorealismus zur Erklärung der neuen Weltordnung in Europa
- Analyse der Rolle internationaler Organisationen im Kontext des Neorealismus
- Kritik am liberalen Institutionalismus und dessen Schwächen
- Bewertung des Neorealismus als Interpretationsansatz für die Entwicklung der internationalen Beziehungen nach 1990
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die Bedeutung des Neorealismus als Theorie in der Internationalen Beziehungen und stellt die Zielsetzung der Hausarbeit vor.
Kapitel 2 widmet sich den Grundannahmen und Modifikationen des Neorealismus nach Kenneth Waltz und John Mearsheimer. Es beleuchtet die zentralen Elemente der Theorie, wie die anarchische Struktur des internationalen Systems und die Bedeutung von Macht im Sicherheitsstreben der Staaten.
Kapitel 3 untersucht den Neorealismus als Interpretationsansatz für die amerikanische Außenpolitik nach dem Kalten Krieg. Es werden vier Essays der genannten Autoren analysiert, die die Auswirkungen des Ost-West Konflikts auf die internationale Ordnung, die Herausforderungen der Hegemonialstellung Amerikas und die Rolle internationaler Organisationen im Kontext des Neorealismus beleuchten.
Kapitel 4 setzt sich kritisch mit den Argumenten des strukturellen Realismus auseinander und diskutiert dessen Grenzen und Schwächen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Neorealismus, struktureller Realismus, Internationale Beziehungen, amerikanische Außenpolitik, Kalter Krieg, Macht, Sicherheitsstreben, Staaten, Anarchie, Internationale Organisationen, liberaler Institutionalismus, Balance of Power, Hegemonialstellung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der neorealistischen Theorie?
Der Neorealismus, begründet durch Kenneth Waltz, sieht die anarchische Struktur des internationalen Systems als entscheidend an. Staaten agieren als rationale Akteure, deren Hauptziel das Sicherheitsstreben und der Machterhalt ist.
Wie erklärt der Neorealismus die Zeit nach dem Kalten Krieg?
Neorealisten wie Waltz und Mearsheimer argumentieren, dass trotz des Endes der Blockkonfrontation die Grundlogik der Machtbalance bestehen bleibt. Die USA nehmen dabei eine hegemoniale Stellung ein, die das Verhalten anderer Staaten prägt.
Welche Rolle spielen internationale Organisationen im Neorealismus?
Im Gegensatz zum liberalen Institutionalismus ist der Neorealismus skeptisch. Organisationen werden oft als Instrumente mächtiger Staaten gesehen und haben laut Mearsheimer nur begrenzten eigenständigen Einfluss auf den Weltfrieden.
Was unterscheidet Kenneth Waltz von John Mearsheimer?
Waltz gilt als Begründer des defensiven Realismus (Sicherung des Status Quo), während Mearsheimer den offensiven Realismus vertritt, bei dem Staaten versuchen, ihre Macht zu maximieren, um zur Hegemonialmacht zu werden.
Was sind die Schwächen des neorealistischen Ansatzes?
Kritiker bemängeln, dass der Neorealismus innerstaatliche Prozesse, Ideologien und den Einfluss wirtschaftlicher Verflechtungen vernachlässigt und den Fokus zu stark auf die rein militärische Macht legt.
- Quote paper
- Oliver Ziesemer (Author), 2010, Neorealismus als Interpretationsansatz amerikanischer Außenpolitik nach dem Ende des Ost-West Konflikts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158531