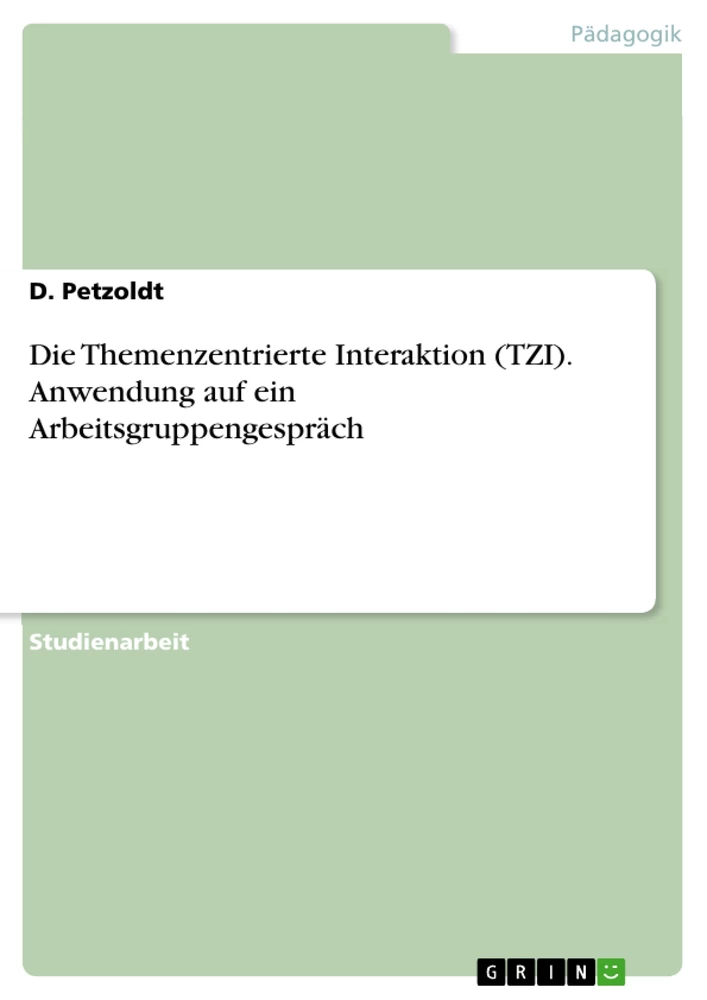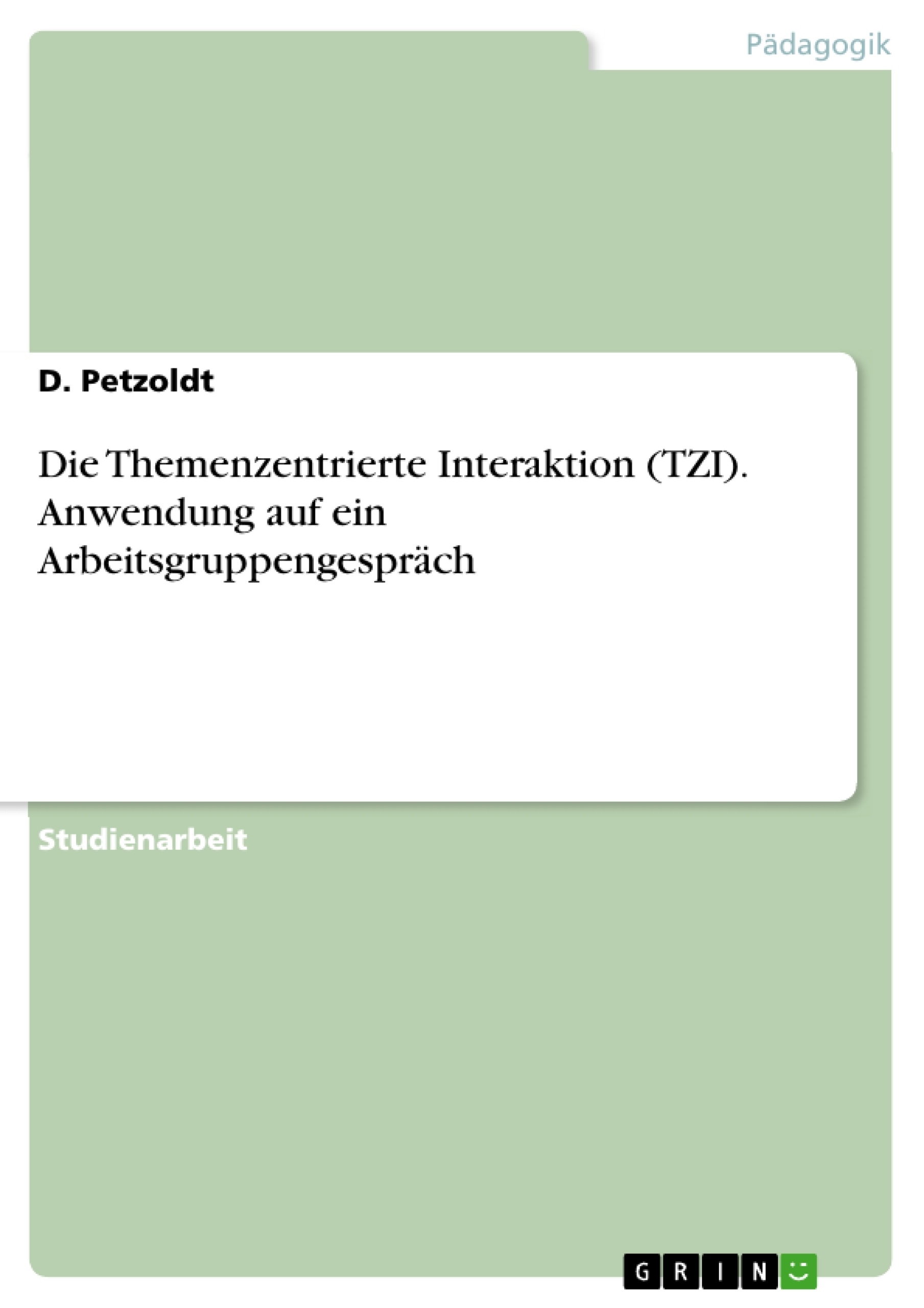Ziel der vorliegenden Arbeit soll es sein, die Grundsätze des Modells der Themenzentrierten Interaktion am Beispiel einer Arbeitsgruppensitzung zu beschreiben, als einen Teil meiner Kernaufgaben im beruflichen Arbeiten mit Führungskräften.
Ich beginne meine Ausführungen mit einer ausführlichen Beschreibung des Strukturmodells selbst. Darauf aufbauend stelle ich meine praktische Anwendung dar: also wie erlebe ich „das Dreieck in der Kugel“ im Gruppenraum? Welche Arbeitsergebnisse und Gruppenerfahrungen konnten gesammelt werden? Wichtig hierbei waren mir, meinen Erfahrungen als Gruppenleiterin zu reflektieren.
Um diesen Transfer optimal zu bearbeiten finde ich es notwendig, wichtige Begriffe in der TZI zu klären bzw. zu beschreiben. Das erwartet Sie im Folgenden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Klärung wichtiger Begriffe in der TZI
- 2.1 Beziehungsebene
- 2.2 Inhaltsebene
- 2.3 Interaktion, agere = handeln
- 2.4 soziale Interaktion
- 2.5 Gruppengröße
- 3 Das Strukturmodell der TZI: Das Dreieck in der Kugel
- 3.1 Darstellung des Konzeptes
- 3.2 Axiome gr. axioma = Grundsatz
- 3.2.1 Erstes Axiom: Existentiell-anthropologisches Axiom
- 3.2.2 Zweites Axiom: Ethisch-soziales Axiom
- 3.2.3 Drittes Axiom: Pragmatisch-politisches Axiom
- 3.3 Postulate
- 3.3.1 Erstes Postulat
- 3.3.2 Zweites Postulat
- 3.4 Hilfsregeln
- 4 Darstellung der eigenen praktischen Anwendung
- 4.1 „Das Dreieck in der Kugel“ im Gruppenraum
- 4.1.1 „Ich“ die Gruppenleiterin
- 4.1.2 „Wir“ die Arbeitsgruppe
- 4.1.3 „Thema/ Es“ das Dokumentationssystem
- 4.1.4 „Globe“ der Gruppenraum
- 4.2 konstruktive Gruppenführung
- 4.3 Arbeitsergebnis und Gruppenerfahrung
- 4.4 Interpretation und Schlussfolgerung
- 4.1 „Das Dreieck in der Kugel“ im Gruppenraum
- 5 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick
- 5.1 Zusammenfassung
- 5.2 eigenes Fazit
- 5.3 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Beschreibung der Grundsätze der Themenzentrierten Interaktion (TZI) anhand einer Arbeitsgruppensitzung. Die Arbeit analysiert die Anwendung der TZI im Kontext einer Führungskräfte-Schulung und reflektiert die dabei gewonnenen Erfahrungen der Autorin als Gruppenleiterin. Die Arbeit beleuchtet sowohl das theoretische Strukturmodell der TZI als auch dessen praktische Umsetzung.
- Klärung wichtiger Begriffe der TZI (Beziehungsebene, Inhaltsebene, Interaktion)
- Das Strukturmodell der TZI: „Das Dreieck in der Kugel“ (Ich, Wir, Es, Globe)
- Praktische Anwendung der TZI in einer Arbeitsgruppensitzung
- Reflexion der Gruppendynamik und der Arbeitsergebnisse
- Bewertung und Ausblick auf zukünftige Anwendungsmöglichkeiten der TZI
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Themenzentrierte Interaktion (TZI) nach Ruth Cohn ein und beschreibt den Kontext der Arbeit – die Anwendung der TZI in einer Führungskräfte-Schulung an einer Münchener Universitätsklinik. Das Ziel der Arbeit wird definiert: die Beschreibung der TZI-Grundsätze anhand einer konkreten Gruppensitzung und die Reflexion der eigenen Erfahrungen als Gruppenleiterin. Die Struktur der Arbeit wird skizziert, mit der Ankündigung einer detaillierten Beschreibung des Strukturmodells, gefolgt von der Darstellung der praktischen Anwendung und der Reflexion der Ergebnisse.
2. Klärung wichtiger Begriffe in der TZI: Dieses Kapitel klärt zentrale Begriffe der TZI. Es definiert die Beziehungsebene (Gefühle, Empfindungen) und die Inhaltsebene (sachliche Informationen) der Kommunikation. Der Begriff der Interaktion wird erläutert, sowohl im allgemeinen als auch im sozialen Kontext, mit Betonung der wechselseitigen Beeinflussung und Abhängigkeit der Beteiligten. Schließlich wird die Bedeutung der Gruppengröße für den TZI-Prozess diskutiert, wobei Faktoren wie Erfahrung der Gruppenleiterin und die Zusammensetzung der Gruppe eine Rolle spielen. Das Kapitel schließt mit einem Zitat von Adolf Friedemann, das den Einfluss der Gruppe auf das Individuum und umgekehrt hervorhebt.
3. Das Strukturmodell der TZI: Das Dreieck in der Kugel: Dieses Kapitel beschreibt das Kernmodell der TZI, das Dreieck in der Kugel. Es erläutert die vier zentralen Elemente: „Ich“ (das einzelne Gruppenmitglied), „Wir“ (die Gruppe als Ganzes), „Es“ (das Thema oder die Aufgabe) und der „Globe“ (die Umgebung, der Kontext). Das Prinzip der dynamischen Balance zwischen diesen vier Elementen wird hervorgehoben. Das Kapitel geht detailliert auf die Axiome und Postulate der TZI ein, um die theoretischen Grundlagen des Modells zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Themenzentrierte Interaktion (TZI), Ruth Cohn, Gruppenarbeit, Beziehungsebene, Inhaltsebene, Interaktion, Gruppendynamik, Strukturmodell, „Dreieck in der Kugel“, Gruppenführung, Kommunikation, Reflexion, Erwachsenenbildung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über Themenzentrierte Interaktion (TZI)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit beschreibt die Grundsätze der Themenzentrierten Interaktion (TZI) nach Ruth Cohn anhand einer konkreten Arbeitsgruppensitzung im Kontext einer Führungskräfte-Schulung. Sie analysiert die Anwendung der TZI, reflektiert die Erfahrungen der Autorin als Gruppenleiterin und beleuchtet sowohl das theoretische Strukturmodell als auch dessen praktische Umsetzung. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, die Klärung wichtiger TZI-Begriffe, eine detaillierte Beschreibung des Strukturmodells ("Das Dreieck in der Kugel"), die Darstellung der praktischen Anwendung in einer Gruppensitzung, eine Reflexion der Gruppendynamik und der Arbeitsergebnisse sowie eine abschließende Bewertung und einen Ausblick.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Klärung wichtiger TZI-Begriffe (Beziehungsebene, Inhaltsebene, Interaktion); das Strukturmodell der TZI ("Das Dreieck in der Kugel" mit den Elementen Ich, Wir, Es, Globe); die praktische Anwendung der TZI in einer Arbeitsgruppensitzung; die Reflexion der Gruppendynamik und der Arbeitsergebnisse; sowie eine Bewertung und einen Ausblick auf zukünftige Anwendungsmöglichkeiten der TZI.
Was sind die zentralen Begriffe der TZI, die in der Arbeit geklärt werden?
Die Arbeit klärt zentrale Begriffe wie Beziehungsebene (Gefühle, Empfindungen), Inhaltsebene (sachliche Informationen) und Interaktion (wechselseitige Beeinflussung und Abhängigkeit). Die Bedeutung der Gruppengröße für den TZI-Prozess wird ebenfalls diskutiert.
Wie wird das Strukturmodell der TZI ("Das Dreieck in der Kugel") beschrieben?
Das Kapitel zum Strukturmodell erläutert detailliert die vier Elemente: "Ich" (einzelnes Gruppenmitglied), "Wir" (die Gruppe), "Es" (Thema/Aufgabe) und "Globe" (Umgebung/Kontext). Es hebt die dynamische Balance zwischen diesen Elementen hervor und beschreibt die Axiome und Postulate der TZI, die die theoretischen Grundlagen des Modells bilden.
Wie wird die praktische Anwendung der TZI dargestellt?
Die praktische Anwendung wird anhand einer konkreten Arbeitsgruppensitzung beschrieben. Die Autorin reflektiert ihre Rolle als Gruppenleiterin und analysiert die Gruppendynamik, die Arbeitsergebnisse und die Interaktion zwischen den Teilnehmern im Kontext des "Dreiecks in der Kugel".
Welche Schlussfolgerungen und Ausblicke werden in der Arbeit gezogen?
Die Arbeit schließt mit einer zusammenfassenden Bewertung der Anwendung der TZI in der Gruppensitzung. Die Autorin zieht ein persönliches Fazit und gibt einen Ausblick auf zukünftige Anwendungsmöglichkeiten der TZI.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Themenzentrierte Interaktion (TZI), Ruth Cohn, Gruppenarbeit, Beziehungsebene, Inhaltsebene, Interaktion, Gruppendynamik, Strukturmodell, "Dreieck in der Kugel", Gruppenführung, Kommunikation, Reflexion, Erwachsenenbildung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Personen, die sich für Gruppenarbeit, Gruppendynamik, Führungsmethoden und die Anwendung der Themenzentrierten Interaktion (TZI) in der Praxis interessieren. Sie eignet sich insbesondere für Studierende, Trainer und Führungskräfte im Bereich der Erwachsenenbildung.
- Quote paper
- D. Petzoldt (Author), 2008, Die Themenzentrierte Interaktion (TZI). Anwendung auf ein Arbeitsgruppengespräch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158558