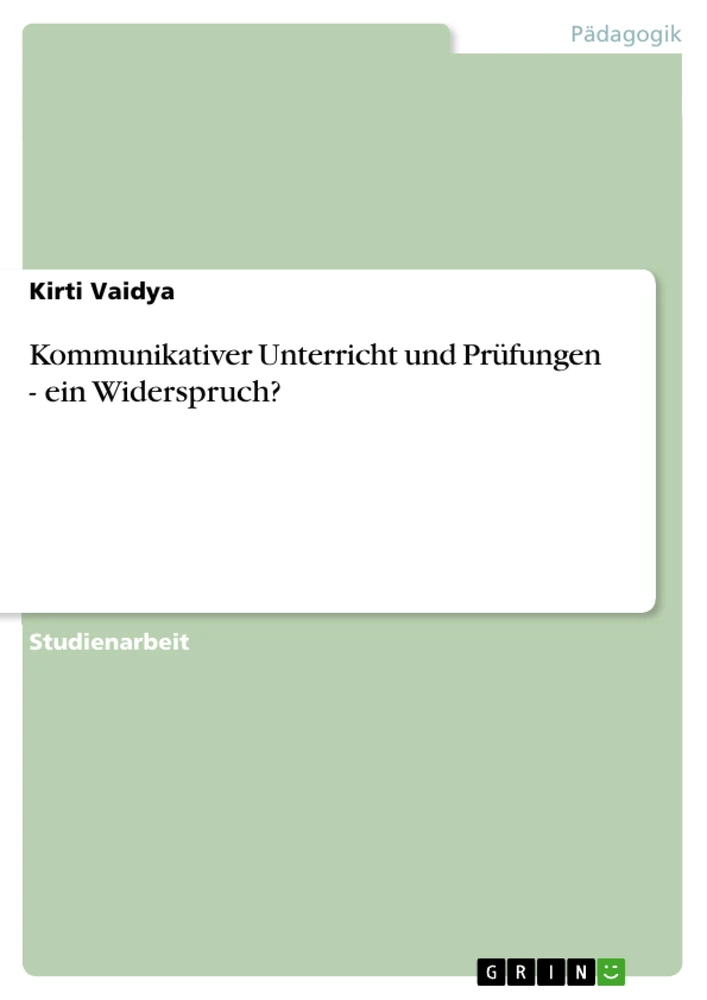Der Titel meines Themas lautet „Kommunikativer Deutschunterricht und Prüfungen – Ein Widerspruch?“ und weist selbsterklärend auf zwei wichtige Aspekte eines Fremdsprachenunterrichts hin – die Gestaltung des kommunikativen Unterrichts und der Prüfungen als ein Werkzeug zur Ausmessung der Leistung. Aber jetzt entsteht die Frage, ob diese zwei Aspekte widersprüchliche Bestandteile des Fremdsprachenunterrichts sind oder ob sie gemeinsam den guten Spracherwerb anstreben. Die Forschungsfrage lautet: „Wie kann man einen kommunikativen Unterricht vermitteln, sodass die Unterrichtsziele zu den Prüfungszielen führen?“ Die Hypothese lautet: „Die Lehrenden können einen möglichst kommunikativen Unterricht vermitteln, ohne dass die Prüfung zum Störfaktor wird.“
In diesem Projekt werden zwei Aspekte gründlich untersucht- Erstens: wie soll ein kommunikativer Unterricht sein? Zweitens: in wie weit sollen die Gütekriterien nämlich Validität, Reliabilität und Objektivität bei der Erstellung der Prüfungen berücksichtigt werden. Es entsteht der Bedarf nach dem Erstellen von passenden Prüfungen, die statt nur der Korrektheit der Sprache die Fähigkeit der angemessenen Behandlung der Situation überprüfen. Dieses Thema betrifft hauptsächlich die lokalen Prüfungen, die den GER Leitlinien nicht folgen, die mehr geschlossene Aufgaben als offene Aufgaben enthalten, die mehr auf die Richtigkeit der Sprache fokussieren und die die Kreativität der Lernenden außer Acht lassen.
Diese Analyse wird anhand aktueller Beispiele durchgeführt. Einige Vorschläge werden unterbreitet, wie man einen FSU möglichst kommunikativer gestalten kann. Darüber hinaus werden manche ausgewählten Prüfungsaufgaben präsentiert und die möglichen Änderungen vorgeschlagen.
Kommunikativer Unterricht und Prüfungen - ein Widerspruch?
Kirti Vaidya
Der Titel umfasst zwei wichtige Aspekte des Fremdsprachenunterrichts: die Gestaltung des kommunikativen Unterrichts und die Gestaltung von Prüfungen als Instrument der Leistungsmessung. Ein wichtiger Hinweis: Dieses Thema bezieht sich hauptsächlich auf lokale Prüfungen in Indien, und zwar in Pune, die nicht den Richtlinien des GER folgen.
Die Forschungsfrage lautet ,,Wie kann ein kommunikativer Unterricht vermittelt werden, so dass die Unterrichtsziele zu den Prüfungszielen führen?“ Die Hypothese lautet: ”Können die Lehrenden einen möglichst kommunikativen Unterricht gestalten, ohne dass die Prüfung zum Störfaktor wird?
Der Beitrag basiert sich auf einige Schlüsselkonzepte aus der Sprachendidaktik, die den kommunikativen Unterricht und die Prüfungsgestaltung betreffen. Folgende Ansätze dienen als Stutzrahemn für diesen Beitrag.
1. Konstruktivistische Lerntheorien: Betrachtungen, wie Lernende Sprache durch Interaktion und Kommunikation erwerben. Diese Theorien unterstützen den kommunikativen Unterrichtsansatz, da sie den Fokus auf die aktive Nutzung der Sprache legen, um Wissen zu konstruieren.
2. Authentische Kommunikation: Diskussionen, wie Aufgaben und Aktivitäten im Unterricht so gestaltet werden können, dass sie echte Kommunikationssituationen widerspiegeln. Dies führte dazu, eine Brücke zur Prüfung zu schlagen, indem authentische Aufgabenstellungen entwickelt werden.
3. Kompetenzorientierte Prüfungen: Untersuchungen, wie Prüfungen so konzipiert werden können, dass sie die kommunikativen Kompetenzen der Lernenden angemessen messen. Die Voraussetzung dafür war, die Integration von mündlichen Prüfungen, Aufgaben zur Interaktion oder Simulationen einzuschließen.
4. Feedback und Lernfortschritt: Berücksichtigungen, wie kontinuierliches Feedback im Unterricht und in den Prüfungen den Lernenden helfen kann, ihre kommunikativen Fähigkeiten zu verbessern, anstatt sie nur zu bewerten.
Der Beitrag wird einige Beispiele aus den aktuellen Prüfungen aus dem Pune-Prüfungskontext nutzen, um die Schwierigkeiten oder Herausforderungen zu illustrieren, die beim Versuch entstehen, einen kommunikativen Unterricht mit den Anforderungen der Prüfung zu vereinen.
Die Recherche erfolgt anhand von drei Impulsen bzw. Fragen und deren ausführlichen Antworten mit Beispielen. Die Beispiele stammen aus den aktuellen Prüfungen, d.h. die Aufgaben kommen in den lokalen Prüfungen häufig vor.
Frage 1: -
Wie kann sichergestellt werden, dass kommunikativer Deutschunterricht und Prüfungen nicht in Widerspruch stehen?
Laut den Prinzipien des kommunikativen Fremdsprachenunterrichts ist Kommunikation ein grundlegender Zweck des Deutschunterrichts. Alltagskommunikation, Authentizität, Situationsgemäße Einbettung, angemessene Entwicklung der 4 Fertigkeiten sind die Stichwörter, die die Grundlage dieser Methode erklären lassen. (Neuner und Hunfeld, 1993)1
Prüfungen sind ein unentbehrlicher Teil des Lernprozesses und hat die Funktion der Erbringung des Sprachnachweises. Sie bringen die Informationen über das sprachliche Können und Wissen der Lernenden hervor.
Um sicherzustellen, dass kommunikativer Deutschunterricht und Prüfungen nicht in Widerspruch stehen, können folgende didaktische Methoden hilfreich sein:
A. Task-Based Learning (aufgabenorientiertes bzw. handlungsorientiertes Lernen):
Diese Methode betont die Ausführung von Aufgaben als zentrales Element des Lernprozesses. Im kommunikativen Deutschunterricht können Aufgaben so gestaltet werden, dass sie authentische Kommunikationssituationen simulieren, die sowohl im Unterricht als auch in Prüfungen relevant sind. Hier sind einige Schritte, wie Task-Based Learning helfen kann, diesen Widerspruch zu überwinden:
1. Authentische Aufgaben: Die Aufgaben, die im Unterricht verwendet werden, realistische Sprachanwendungen fördern. Diese Aufgaben sollten kommunikative Ziele verfolgen, die die Schüler motivieren, in der Zielsprache zu interagieren. (Funk, Kuhn. Skiba und Wicke, 2024)2
2. Integration von Prüfungselementen: Die Aufgaben bauen Prüfungselemente ein, die den Anforderungen der Prüfung entsprechen. Dies könnte das Format von schriftlichen oder mündlichen Prüfungen widerspiegeln, jedoch ohne den Schwerpunkt auf reine Reproduktion von Wissen zu legen, sondern auf die Anwendung von Sprachkenntnissen in kontextuellen Situationen. (Albers und Bolton, 1999)3
3. Feedback und Reflexion: Regelmäßiges Feedback ist wichtig, das nicht nur auf die Leistung in der Prüfung vorbereitet, sondern auch die kommunikativen Fähigkeiten der Schüler stärkt. Durch Reflexion über die durchgeführten Aufgaben können Lernende ihre Sprachkompetenzen verbessern und für die Prüfungssituationen besser vorbereitet sein.
4. Progressive Aufgaben: Progressive Gestaltung der Aufgaben folgt auf eine Weise, dass sie sich schrittweise aufbauen und die Komplexität der Sprachverwendung erhöhen. Dies unterstützt die Lernenden dabei, ihre kommunikativen Fähigkeiten kontinuierlich zu entwickeln, was letztlich die Übertragbarkeit auf Prüfungssituationen erleichtert.
Durch die Anwendung von Task-Based Learning im kommunikativen Deutschunterricht können Lehrende sicherstellen, dass die Lernziele des Unterrichts nahtlos mit den Zielen der Prüfungen verbunden sind, ohne dass ein direkter Widerspruch entsteht.
Um die Funktionen dieser zwei Aspekte in Einklang zu bringen, kann die LK einige Strategien anwenden wie z.B.: -
b. Angemessener Einsatz aller Aufgaben:
Um sicherzustellen, dass kommunikativer Deutschunterricht und Prüfungen nicht in Widerspruch stehen, ist der zweckmäßige Einsatz von verschiedenen Aufgaben sowohl im Unterricht als auch in Prüfungen erforderlich.
Die Lehrkraft bietet eine sinnvolle Reihenfolge von Aufgaben im Unterricht an, um sprachliche Kompetenz schrittweise aufzubauen. Diese Aufgaben hängen von dem Lernstoff ab und können dementsprechen steuert oder ungeseterut, inhalstorientiert oder formfokkusieret, reproduktiv oder produktiv sein. Auf die gleiche Weise soll der Einsatz von Aufgaben in Prüfungen einschlägig sein. Die Prüfungen sollen idealerweise nicht nur Teilfertigkeiten wie Grammatik oder Wortsachtz überprüfen, sondern alle Fertigkeiten: Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. (Brinitzer, Hantschel, Krömer , Möller-Frorath und Ros, 2016)4 Folgende sind einige Beispiele
Das Thema ist Kasualsätze mit weil.
Beispiel 1: Die KTN sollen die folgende Aufgabe lösen:
1. Ich will Deutsch lernen, ________________________ .
a. weil ich will in Deutschland studieren.
b. weil ich in Deutschland studieren will.
c. weil ich in Deutschland will studieren.
Diese Aufgabe ist eine geschlossene Aufgabe d.h es gibt nur eine korrekte Antwort. Im Vergleich zu der offenen und halboffenen Aufgabe gibt es bei der gechlossenen Aufgabe keine Möglichkeit, eigene Äußerungen zur Sprache zu bringen und deshalb selbstverständlich keinen Raum für Kreativität. In Bezug auf die Prüfungen sind die geschlossenen Aufgaben keine gute Möglichkeit, die produktiven Fertigkeiten zu bewerten. Jedoch passen die geschlossenen Aufgaben zu Prüfungsaufgaben, die bei der Bearbeitung des Leseverstehens und Hörverstehens bzw, bei den rezeptiven Fertigkeiten unterstützen.
Anstatt anstatt einer halbgeschlossenen Aufgabe eine offene Aufgabe anbieten, wobei die kommunukative Kompetenz samt des formelhaften Strukturen getest werden können. Hier können gezielte Fragen gestellt werden, deren Antworten die erwünschten Konnektoren und Konjunktionen beinhalten.
Vorschlag: Beantworten Sie die folgenden Fragen mit passenden Konnektoren!
1. Warum weint das Kind?
Mögliche Lösung: Das Kind weint, weil es hungrig ist.
Oder
Das Kind ist hungrig, deshalb weint es.
2. Was machst du, wenn es stark regnet?
Mögliche Lösung: Ich fahre mit dem Bus, wenn es stark regnet.
Oder
Wenn es stark regnet, bleibe ich zu Hause.
Auf diese Weise kann eine offene Aufgabe die Kreativität der Lernenden fördern und gleichzeitig den angemessenen Gebrauch der Grammatik überprüfen. Als Lehrperson muss man dabei im Kopf behalten, dass Grammatik kein Selbstzweck ist, sondern sie ist nur eine Teilfertigkeit und das eigentliche Ziel ist die Kommunikation. (Brinitzer, Hantschel, Krömer, Möller-Frorath und Ros, 2016)5
Beispiel 2: Hauptsazt- Satz vervollständigen
Aufgabe: Ergänzen Sie die Sätze!
1. Ich lerne Deutsch, weil_______________________________.
2. Ich kann zur Party nicht kommen, weil _______________________________.
Das ist eine halboffene Aufgabe. Halboffene Aufgaben eignen sich am besten zur Überprüfung der Beherrschung von Grammatik und Wortschatz, deshlab sollten deren Einsatz in Prüfungen nicht sehr hoch sein.
Beispiel 3:
Vorschlag: Die Prüfungsaufgabe könnten so aussehen:-
i) Bei einem mündlichen Test kann die Lehrkraft einige allgemeine Fragen stellen- wie ,Warum lernst du Deutsch?’. Mit weil bilden
ii) Bei einem schriftlichen Test sollen die Lernenden in einem informellen E-Mail begründen, warum er/sie die Einladung zur Einweihungsparty ablehnen muss.
Offene Aufgaben sind zur Überprüfung der produktiven Sprachleistungen nämlich Schreiben und Sprechen geeignet. Die offenen Aufgaben sollen einen besonderen Sitz in den Prüfungen haben. Je mehr offene Aufgaben in der Prüfung eingebaut werden, desto kommunikativer wird die Prüfung. (Albers und Bolton, 1999)6
c. Der regelmäßige Einsatz von Prüfungsteilen im Unterricht:
Es ist emphlenswert, dass die LK schon während des Kurses die Prüfungsteile in regelmäßigen Abständen einüben lässt. Anstatt eine exklusive Prüfungsvorbereitung einzuplanen, können die Prüfungsgegenstände schon in den Unterricht miteinbezogen werden. In der Fachdidaktik gilt die kommunikative Methode mit dem interkulturellen Ansatz als die aktuelle Lehrmethode und deren Ziel ist, den Lehrstoff in Alltagsgesprächen einzubetten und alles im Kontext bzw. situativ einzuüben. Sowohl im Unterricht als auch in Prüfungen sollen die Lernaktivitäten auf eine gelungene Kommunikation abzielen. (Neuner und Hunfeld, 1993)7
Frage 2: -
Wie können wir Prüfungen einsetzen, damit sie den kommunikativen Unterricht ergänzen und unterstützen? Die Frage wird mithilfe von einigen Beispielen und Vorschlägen beantwortet.
Beispiel 1: Einige lokale Prüfungen haben direkte Übersetzung als Prüfungsgegenstand. Gemäß der kommunikativen Methode sind solche Aufgaben veraltet, weil sie auf die Grammatik fokussieren und keine kommunikative Kompetenz überprüfen.
Als Vorschlag kann man stattdessen den Prüfungsteilnehmern ein Thema anbieten und zu diesem Thema eigene Gedanken und Meinungen äußern lassen. Um es noch kommunikativer zu machen, können die Textsorten auch bestimmt werden.
Vorschlag: Eine mögliche schriftliche Aufgabe wäre;
i. Sie haben eine Einkaufsliste und Sie wollen einkaufen. Sprechen Sie mit dem Verkäufer und erledigen Sie den Einkauf. Schreiben Sie einen kurzen Dialog!
ii. Sie Schreiben regelmäßig ein Tagebuch. Tragen Sie in das Tagebuch ein, was sie gestern gemacht haben.
Beispiel 2:
Es wäre empfehlenswert, mehr offene Aufgaben in Prüfungen anzubieten. Zwar könnten die Aufgaben auf der Wort Ebene sein, aber die Fragestellung soll die Offenheit fördern. Ein passendes Beispiel wäre wie dieses.
i. Sofia möchte eine _______________ als Friseurin machen.
In dieser Prüfungsaufgabe sollen die Prüfungsteilnehmer die Lücken mit einem passenden Wort ergänzen.
Analyse: Die erwartete Antwort wäre, Ausbildung’. Die Antwort wie ,Umschulung’ ist hier auch nicht falsch. Auf diese Weise können mehrere Sätze mit Lücken angeboten werden, zu denen mehr als eine Antwort passen kann.
Beispiel 3: Neben der Phonetik wird noch ein wichtiges Element wegen der Zeitbindung vernachlässigt, nämlich, Landeskunde’. Zwar sind die landeskundlichen Faktenvermittlung von einer großen Bedeutung, aber aus der Perspektive der Lernenden werden sie nicht ernst genommen, weil Landeskunde kein Prüfungsgegenstand ist.
Um die landeskundliche Sensibilisierung voranzubringen, könnten einige passende Aufgaben in die Prüfung integriert werden.
Vorschlag: KreuzenSie die richtigeAntwort an!
1. In Deutschland wünscht man einander ,Guten Appetit’ vor dem Essen. R F
2. Die Hauptstadt von Deutschland ist München. R F
3. Am Bahnhof benutzt man inoffizielle Uhrzeiten. R F
4. Am 1. Mai feiert man, Tag der Arbeit’ in vielen europäischen Ländern. R F
Frage 3:-
Welche Art des kommunikativen Unterrichts profitiert von Prüfungen und welche Prüfungen vom kommunikativen Unterricht?
Allegemeine Herangehensweise die Frage zu beantworten, kann man wie folgt beantworten.
a. Kommunikativer Unterricht, der von Prüfungen profitiert:
- Task-Based Learning (Aufgabenorientiertes Lernen): Ein kommunikativer Unterricht, der auf authentischen Aufgaben basiert, kann von Prüfungen profitieren, indem er sicherstellt, dass die Lernenden in der Lage sind, die erlernten Sprachkenntnisse in realen Kommunikationssituationen anzuwenden. Prüfungen können hier als Maßstab dienen, um zu überprüfen, wie gut die Lernenden ihre kommunikativen Fähigkeiten unter Beweis stellen können.
- Mündliche Prüfungen oder Simulationen: Kommunikativer Unterricht kann durch mündliche Prüfungen oder Simulationen profitieren, die echte Konversationen oder Interaktionen nachstellen. Diese Art von Prüfungen ermöglicht es den Lernenden, ihre Sprachfertigkeiten in einem natürlichen Kontext zu demonstrieren, was die Ziele des kommunikativen Unterrichts unterstützt.
- Feedback-orientierte Prüfungen: Prüfungen, die konstruktives Feedback bieten und die Kommunikationsfähigkeiten der Lernenden fördern, sind für den kommunikativen Unterricht besonders wertvoll. Solche Prüfungen unterstützen die Lernenden dabei, ihre Schwächen zu erkennen und ihre Fähigkeiten weiter zu entwickeln.
- b. Prüfungen, die vom kommunikativen Unterricht profitieren:
- Kompetenzorientierte Prüfungen: Prüfungen, die die tatsächliche Fähigkeit der Lernenden zur Kommunikation in der Zielsprache messen, profitieren stark von einem kommunikativen Unterrichtsansatz. Dies liegt daran, dass diese Prüfungen darauf ausgelegt sind, die Sprachkompetenz und nicht nur das Wissen über die Sprache zu bewerten.
- Interaktive Aufgabenstellungen: Prüfungen, die interaktive Aufgaben wie Rollenspiele oder Diskussionen enthalten, können vom kommunikativen Unterricht profitieren, indem sie sicherstellen, dass die Prüfungsszenarien realitätsnah sind und die Lernenden zur aktiven Verwendung der Sprache motivieren.
- Integrierte Fertigkeiten: Prüfungen, die verschiedene Sprachfertigkeiten wie Lesen, Hören, Sprechen und Schreiben integrieren, profitieren vom kommunikativen Unterricht, der alle diese Fertigkeiten umfasst und die Lernenden auf ganzheitliche Weise auf die Prüfung vorbereitet.
Konkrete Vorschläge, die sich auf die Unterrichtserfahrung im DaF Unterricht an der Universität Pune beruhen, bringen die Merkmale der kommunikativen Methode und die Funktion der Prüfungen in Übereinstimmungen.
Vorschlag 1: Tests als eine Ausgleichung schlagende Brücke
Tests beinhalten die Funktionen sowohl von einem kommunikativen Unterricht, als auch die Zwecke von den Prüfungen und folglich bauen eine Brücke zwischen den beiden Abläufen. Infolgedessen ist es empfehlenswert Tests in regelmäßigen Abständen durchzuführen, um sowohl den erforlgreichen Unterrichtsverlauf als auch die Lernfortschritte der Lernenden zu versichern.
Vorschlag 2: Alternative für traditionelle Tests
Das Wort ,Test’ bereitet einem bestimmt Stress und Angst und daher können alternative Methoden statt eines richtigen Tests eingesetzt werden. Spielerische Tests sorgen für ein angenehmes Lernklima und haben auch positive Wirkungen auf der psychischen Ebene. Ein Brettspiel oder ein Quiz können auch die Funktion von Tests ausüben. Es wäre empfehlenswert, mal alternative Evaluationsmöglichkeiten und mal typische standardisierte Tests im Unterricht einzusetzen. (Sander , Haarmann und Kühmichel,2008)8
Vorschlag 3: Erfoglreiches Lernen mithilfe der Neurodidaktik:
Um das Konzept von Neurodiaktik regelrecht im Unterricht anzuwenden, sollen die grundsätzlichen Faktoren vom ,Gehirngerechten Lernen’ eingesetzt werden: nämlich Systematische Wiederholung des gelernten Stoffes, eigene Leistungen testen, Lernerorientiertes und Handlungorientiertes Lernen, Berücksichtigung der Lerntypen sind einige Faktoren unter den anderen.In gewissem Sinne berücksichtigt Neurodidaktik den psychischen Bestand der Lernenden. Wenn es auf das Sprachkönnen und nicht auf das Sprachwissen abgezielt wird, hat es einen positiven Einfluss auf die Lernenden. Sie haben Spaß am Lernen, was auch in der Prüfung reflektiert wird. (Draghun ,2011/2012)9
Vorschlag 4: Noch eine passende Möglichkeit wäre die Gestaltung des ,,Sprachenportfolios”, der als ,Evaluation des Lernfortschritts’ konnotiert wird.
Das Folio wird von den Lernenden selbst mit Hilfe von Lehrenden angelegt und wird allmählich im Laufe des Kurses aufgebaut. Am Ende des Kurses haben die Lernenden eine Vorlage, die den Nachweis erbringt, was alles sie können und ob sie ein bestimmtes Sprachniveau erreicht haben. Ein Sprachenportfolio kann sehr zur Eigenmotivation der Lernenden beitragen und stärkt die Lernerautonomie insgesamt. (Brinitzer, Hantschel, Krömer, Möller-Frorath und Ros, 2016)10
Vorschlag 5: Projekt im Unterricht
Projekt ist eine handlungsorientierte Aufgabe, bei der die Lernenden autonom und in Gruppen arbeiten und die Form ihres Arbeitens selbst bestimmten. Projekte haben ein konkretes Ziel nämlich; Sprache in kommunikativer Funktion zu verwenden. Sie werden gemeinsam mit Lehrenden und Lernenden geplant, aber die Bearbeitung des Projekts wird von den Lernenden selbständig durchgeführt. (Brinitzer, Hantschel, Krömer, Möller-Frorath und Ros, 2016)11 Hier wird ein aktuelles Beispiel dargestellt. Jedes Mal biete ich die folgende Aufgabe als Miniprojekt im Kurs an. Wenn das Thema Urlaub im Unterricht behandelt wird, schreiben die TN als Anwendung eine Postkarte und schicken tatsächlich an einander per Post.
Schließlich sind nach dieser ausführlichen Analyse zwei Schlüsse zu ziehen; erstens ist eine gewisse Umgestaltung der Prüfungen nötig und zweitens sollte der Fokus im DaF- Unterricht auf das Sprachtraining und nicht auf Prüfungstraining sein. Der klassische Konflikt zwischen authentische Sprachkompetenz vs. Testkompetenz führt nur zu unerfreulichen Ergebnissen.Studien zeigen, dass traditionelle Prüfungen oft nur die Fähigkeit der Lernenden messen, Tests zu bestehen, anstatt ihre tatsächliche Fähigkeit zur Kommunikation in realen Situationen zu bewerten (Bachman & Palmer, 2010)12 Durch eine Umgestaltung der Prüfungen hin zu authentischeren Formaten wie mündlichen Prüfungen oder Aufgaben, die reale Kommunikation simulieren, können Prüfungen die tatsächliche Sprachkompetenz besser widerspiegeln (Luoma, 2004)13 die Lehrkraft soll zusätzlich versuchen die Lernmotivation und Zielausrichtung paralell zu führen. Forschung hat gezeigt, dass Lernende, die sich ausschließlich auf Prüfungstrainings konzentrieren, häufig weniger intrinsisch motiviert sind und eher auf kurzfristige Erfolge als auf langfristige Sprachentwicklung abzielen (Tremblay & Gardner, 1995)14 Ein Fokus auf das Sprachtraining im DaF-Unterricht, der kommunikative Fähigkeiten fördert, kann langfristige Motivation fördern und zu einer nachhaltigeren Sprachkompetenz führen (Dörnyei, 2001)15.
Im Rahmen eines Fremdsprachenunterrichts besteht das Erfolgserlebnis der Lerneneden sowie der Lehrenden darin, dass die Produktivität der gelunegne Leistung in die kompetenzorientierte Bildungspolitik sich widerspiegelt. Eine zunehmende Anzahl von Bildungssystemen und Sprachprüfungen weltweit bewegt sich hin zu kompetenzorientierten Ansätzen, die die Fähigkeit zur effektiven Kommunikation und Interaktion betonen (Council of Europe, 2001 und 2020)16
Diese Entwicklung erfordert eine Neubewertung der Prüfungsinhalte und -formate, um sicherzustellen, dass sie die tatsächlichen kommunikativen Fähigkeiten der Lernenden adäquat messen und nicht wegen der unzureichenden Prüfungstechniken für den Lernerfolg in die Quere kommen.
Schlussfolgerungen:
Im Licht der Tendenzen in der gegenwärtigen DaF-Didaktik , der Theorien der Lehrmethoden und der konkreten Vorschläge anhand einiger Beispiele aus den aktuellen Prüfungen wurde der Inhalt dieser Masterarbeit geschaffen. Es wird davon ausgegangen, dass die Lehrenden ihre Unterrichtsstunden gemäß der kommunikativen Methode gestalten, aber die Prüfungen bereiten Hindernisse bei der Durchführung dieser Unterrichtsstunden. Infolgedessen entsteht ein Bedarf nach der Anpassung der Prüfungen an das Unterrichtsgeschehen. Wenn die Prüfungen aus mehreren geschlossenen Aufgaben bestehen, dann wird die kommunikative Kompetenz der Lernenden nicht exakt gemessen. Laut des Prinzips der kommunikativen Methode sollen die Unterrichtsstunden aufgabenorientiert sein, d.h. der Lernstoff wird anhand unterschiedlicher Typen von Aufgaben geübt und verinnerlicht. Auf die gleiche Weise sollen die Prüfungen aus ähnlichen Aufgaben bestehen, die die im Unterricht vorbrachten, Lernziele messen können.
In den Zertifikatkursen ist die Belastung wegen der Prüfungen spürbar. Um den Spracherwerb genießbar zu machen, sind einige Änderungen in den lokalen Prüfungen empfehlenswert.
Schließlich sind nach dieser ausführlichen Analyse zwei Schlüsse zu ziehen; erstens ist eine gewisse Umgestaltung der Prüfungen nötig und zweitens sollte der Fokus im DaF- Unterricht auf das Sprachtraining und nicht auf Prüfungstraining sein.
Bibliografie:
Bücher:
- Albers, Hans-Georg/ Bolton, Sibylle: Testen und Prüfen in der Grundstufe, Verfahren der Leistungsmessung, Langenscheidt, 1999.
- Brinitzer, Michaela / Hantschel , Hans-Jürgen / Krömer, Sandra / Möller-Frorath, Monika / Ros, Lourdes: DaF Unterrichten – Bassiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Ernst Klett Sprachen GmbH ,2. Auflage , Stuttgart, 2016.
- Funk, Hermann / Kuhn, Christina / Skiba, Dirk / Spaniel-Weise, Dorothea / Rainer / E.Wi>- Neuner Gerhard/ Hunfeld Hans: Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts – Eine Einführung, Universität Kassel, Langenscheidt, 1993.
Internetquellen:
- Beth, Clark-Gareca (2010): Language Assessment in Practice. Working Papers in Applied Linguistics and TESOL. 10. 10.7916/D8CV4HB8.
- Dörnyei Z. Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge University Press; 2001.
- Draghun, Andreas: Neurodidaktik: Chancen und Grenzen einer Naturalisierung des Lernens, Auszug aus dem Jahresbericht ,,Marsilius-Kolleg 2011/2012”, Universität Heidelberg, Unter Url: https://www.marsilius-kolleg.uni-heidelberg.de/md/einrichtungen/mk/publikationen/mk_jb_14_neurodidaktik.pdf .(Zugriffsdatum: 18.04.2025)
- https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages (Zugriffsdatum: 7.5.25)
- Luoma, S. (2004). Assessing speaking. Cambridge: Cambridge University Press. 212 pp.
- Tremblay, Paul F., and Robert C. Gardner. “Expanding the Motivation Construct in Language Learning.” The Modern Language Journal, vol. 79, no. 4, 1995, pp. 505–18. JSTOR, https://doi.org/10.2307/330002. (Zugriffsdatum: 7.5.25)
- Wolfgang, Sander/ Haarmann, Julia / Kühmichel, Sabine: Sachanlyse, Das Klassenklima ist kein “Ding”, sondern eine soziale Realität, am 1.10.2008, Unter URL:https://www.bpb.de/lernen/grafstat/klassencheckup/46278/sachanalyse?p=6 (Zugriffsdatum: 18.04.2025)
[...]
1 Vgl. Gerhard Neuner/Hans Hunfeld : Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts – Eine Einführung. Universität Kassel. Langenscheidt. 1993. S.172.
2 Vgl. Hermann Funk/Christina Kuhn/Dirk Skiba/Dorothea Spaniel-Weise-Rainer/ E.Wi>
3 Vgl. Hans-Georg Albers und Sibylle Bolton: Testen und Prüfen in der Grundstufe, Verfahren der Leistungsmessung, Langenscheidt, 1999, S.27.
4 Vgl. Michaela Brinitzer/ Hans-Jürgen Hantschel/ Sandra Krömer/Monika Möller-Frorath/Lourdes Ros: DaF Unterrichten – Bassiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ernst Klett Sprachen GmbH .2. Auflage . Stuttgart . 2016 . S.165.
5 Vgl. Michaela Brinitzer/ Hans-Jürgen Hantschel/ Sandra Krömer/Monika Möller-Frorath/Lourdes Ros: DaF Unterrichten – Bassiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ernst Klett Sprachen GmbH .2. Auflage . Stuttgart . 2016 . S.79.
6 Hans-Georg Albers und Sibylle Bolton: Testen und Prüfen in der Grundstufe, Verfahren der Leistungsmessung, Langenscheidt, 1999, S.27.
7 Vgl. Gerhard Neuner/Hans Hunfeld : Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts – Eine Einführung. Universität Kassel. Langenscheidt. 1993. S.84.
8 Der Begriff des Klassenklimas kann weiter ausdifferenziert werden, indem auf die zentralen Dimensionen eingegangen wird. Gemeint ist zum einen die emotionale Qualität der sozialen Beziehungen zwischen Lehrkräften und Schülerinnen sowie Schülern untereinder. Das Gefühl und die Stimmung in der Gruppe ist hier prägend. In: Wolfgang Sander/ Julia Haarmann/ Sabine Kühmichel: Sachanlyse, Das Klassenklima ist kein “Ding”, sondern eine soziale Realität, am 1.10.2008, Unter URL:https://www.bpb.de/lernen/grafstat/klassencheckup/46278/sachanalyse?p=6 (Zugriffsdatum: 18.04.2025)
9 Vgl. Andreas Draghun: Neurodidaktik: Chancen und Grenzen einer Naturalisierung des Lernens, Auszug aus dem Jahresbericht ,,Marsilius-Kolleg 2011/2012”, Universität Heidelberg, Unter Url: https://www.marsilius-kolleg.uni-heidelberg.de/md/einrichtungen/mk/publikationen/mk_jb_14_neurodidaktik.pdf (Zugriffsdatum: 18.04.2025)
10 Vgl. Michaela Brinitzer/ Hans-Jürgen Hantschel/ Sandra Krömer/Monika Möller-Frorath/Lourdes Ros: DaF Unterrichten – Bassiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ernst Klett Sprachen GmbH .2. Auflage . Stuttgart . 2016 . S.171.
11 Vgl. Brinitzer/ Hantschel/ Krömer/ Möller-Frorath/ Ros: DaF Unterrichten,a.a.O.,S.126.
12 Clark-Gareca, Beth. (2010). Language Assessment in Practice. Working Papers in Applied Linguistics and TESOL. 10. 10.7916/D8CV4HB8.
13 Luoma, S. (2004). Assessing speaking. Cambridge: Cambridge University Press. 212 pp.
14 Tremblay, Paul F., and Robert C. Gardner. “Expanding the Motivation Construct in Language Learning.” The Modern Language Journal, vol. 79, no. 4, 1995, pp. 505–18. JSTOR, https://doi.org/10.2307/330002. (Zugriffsdatum am 7.5.2025)
15 Dörnyei Z. Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge University Press; 2001.
16 https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages (Zugriffsdatum am 7.5.2025)
- Citation du texte
- Kirti Vaidya (Auteur), 2022, Kommunikativer Unterricht und Prüfungen - ein Widerspruch?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1585895