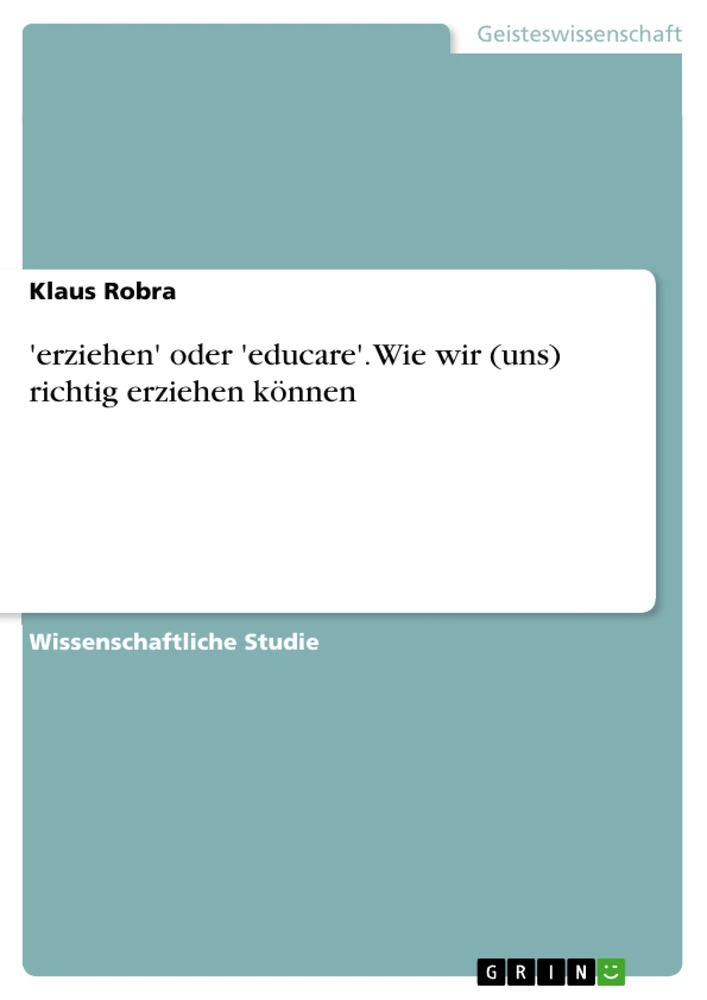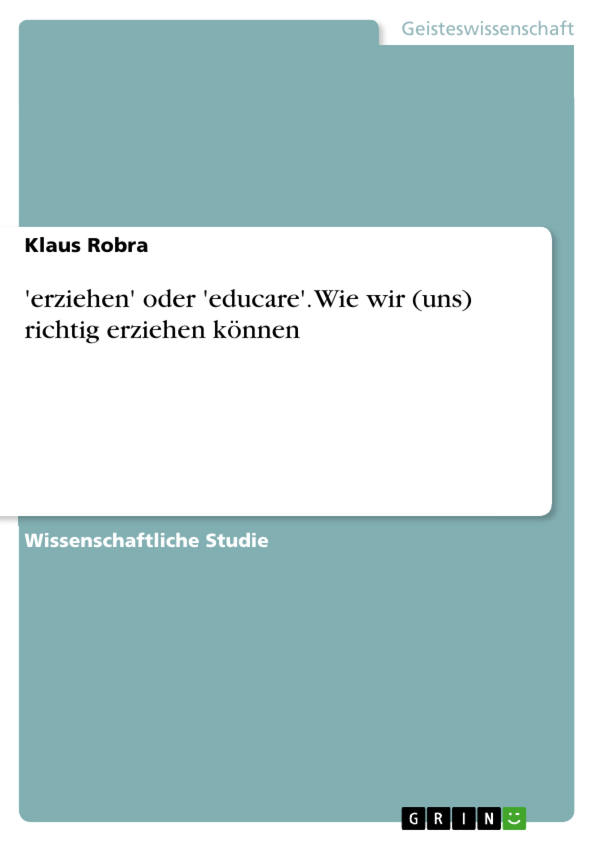Die vorliegenden Erziehungstheorien zu referieren, scheint wenig erfolgversprechend zu sein. In historischer Sicht könnte man vereinfachen: Bis 1968 gab es vorwiegend den autoritären Erziehungsstil, danach vor allem den anti-autoritären bzw. nicht-autoritären. Der autoritäre Stil gleicht in vielem dem militärischen Schema von „Befehl und Gehorsam“: Erzieherinnen und Erzieher befehlen, ordnen an, die „Zöglinge“ haben zu folgen.
Nachweislich entspricht der autoritäre Stil nicht dem gegenwärtigen Forschungsstand der Entwicklungspsychologie; so dass sich die Frage stellt, wie eine Theorie der nicht-autoritären Erziehung konzipiert werden kann. Weiterhelfen kann hier zunächst ein philologisch-philosophischer Vergleich der Grundbegriffe ‚educare‘ und ‚erziehen‘.
Inhaltsverzeichnis
Einführung
I. Die aufklärende Grundlage: Rousseau (1712-1778)
a)‚ Emil oder Über die Erziehung‘ (1762)
b) Rousseaus Einfluss auf die Entwicklung der Erziehungs-Theorien
II. Zum Forschungsstand von Entwicklungs-Psychologie und - Neurologie
Zur Entwicklung des Selbst
Willensfreiheit und Moral im Kindes- und Jugendalter
III. Erziehung und Lernen in der Krise
IV. KI in Unterricht und lebenslanger Bildung – das Allheilmittel?
V. Lebenslange Bildung
Anthropologie und Ethik
Zur Relevanz von Geschichtsphilosophie und Anthropologie für eine Ethik der
Verhaltenssteuerung
Zur Ethik des „Digitalen Humanismus“
Anthropologie – die „Ressource Mensch“
Vom Selbst zur Demokratie
„Mehr Emotionen wagen“?
Hilljes Gegenvorschläge
Kritische Anmerkungen
VI. Zusammenfassung
Literaturhinweise
Einführung
Stefan T. Siegel stellt (2023) fest: »Der Aussage von Nieke, dass es keinen „Konsens über die fundamentalen Begriffe und Methoden der Erziehungswissenschaft und erst recht nicht über einen fundamentalen Kanon an Theorien und ein daraus resultierendes Kernstudium“ (Nieke 2006, S.525) gibt, kann auch heute noch Gültigkeit attestiert werden.«1 – Die vorliegenden Erziehungstheorien zu referieren, scheint also wenig erfolgversprechend zu sein. In histori-scher Sicht könnte man vereinfachen: Bis 1968 gab es vorwiegend den autoritären Erzie-hungsstil, danach vor allem den anti-autoritären bzw. nicht-autoritären. Der autoritäre Stil gleicht in vielem dem militärischen Schema von „Befehl und Gehorsam“: Erzieherinnen und Erzieher befehlen, ordnen an, die „Zöglinge“ haben zu folgen. (Übrigens behauptete Hegel noch: „Ein Hauptmoment der Erziehung ist die Zucht, welche den Sinn hat, den Eigenwillen des Kindes zu brechen, damit das bloß Sinnliche und Natürliche ausgereutet werde.“2 )
Nachweislich entspricht der autoritäre Stil nicht dem gegenwärtigen Forschungsstand der Ent-wicklungspsychologie (s.u.); so dass sich die Frage stellt, wie eine Theorie der nicht-autoritä-ren Erziehung konzipiert werden kann. Weiterhelfen kann hier zunächst ein philologisch-philosophischer Vergleich der Grundbegriffe ‚educare‘ und ‚erziehen‘. In dem deutschen ‚Er-ziehen‘ (mit der Ableitung „Zögling“!) steckt das pointiert autoritäre „Ziehen“, mit dem die „Zöglinge“ zu einem bestimmten Verhalten gezwungen werden sollen. Einseitig wird damit ein Aspekt hervorgehoben, der in der Tat schon in dem zu Grunde liegende lateinischen ‚edu-care‘ enthalten ist. In diesem steckt bekanntlich ‚ducere‘ mit den Bedeutungen ‚führen, ziehen‘.3 Dem entsprechen im lateinischen ‚educare‘ die Bedeutungen ‚aufziehen, großziehen, erziehen‘; wohingegen die ursprünglichen Grundbedeutungen ‚heraus-, heranführen, empor-führen‘ anscheinend in Vergessenheit geraten sind, jedenfalls für die romanischen und germa-nischen bzw. angelsächsischen Fortführungen wie italienisch ‚educare‘, französisch ‚édu-quer‘, spanisch ‚eduquar‘, portugiesisch ‚educar‘ und englisch ‚to educate‘ nicht mehr als gängige Bedeutungen angegeben werden. Das ist bedauerlich, weil sich schon an Hand der lateinischen Grundbedeutung ‚educare‘: heraus-, heranführen sogar eine Möglichkeit ergibt, den Begriff Erziehung neu zu konzipieren: Zunächst völlig hilflose Säuglinge befinden sich in einem Dilemma, aus dem sie aber herausgeführt werden können. Ausweglos erscheint näm-lich einerseits das Laissez-faire, laissez-aller, der Verzicht auf jegliche Erziehung, anderer-seits der unzulässige Rückgriff auf autoritäre Methoden (s.o.). Den völligen Verzicht auf Er-ziehung empfahl schon Ellen Key (1902) in ihrem Buch Das Jahrhundert des Kindes, worin ihr einige Autoren der Gegenwart folgten – auch dies entgegen aktuellem Forschungsstand (s.u.).
Wohingegen vor allem in den romanischen Weiterführungen die Bedeutung ‚bilden‘ eine überragende Rolle spielt. (Im Portugiesischen unterscheidet man bei ‚educar‘ übrigens strikt zwischen dem Erziehen von Personen und dem Dressieren von Tieren.) – Wohl nicht zufällig wies schon Karl Marx darauf hin, dass „auch die Erzieher erzogen werden müssen“. Wonach Erziehung, zumal in Form von Bildung, ein lebenslanger Prozess ist. Wie alle anderen Perso-nen sind auch Erzieherinnen und Erzieher ständiger Beeinflussung durch die herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse und Ideologien ausgesetzt. Umso dringender bedürfen sie der Orientierung. Erziehung und Bildung sind keineswegs auf das Kindes- und Jugendalter be-schränkt, sondern – neben Faktoren wie Ökonomie, Politik, Wissenschaft, Philosophie, Kultur und Religion – als Haupt-Antriebskräfte der gesellschaftlichen Entwicklung anzusehen. Es ist ein Gesamtrahmen, dessen vielfältige Implikationen natürlich auf engem Raum großenteils nur andeutungsweise dargestellt werden können.
I. Die aufklärende Grundlage: Rousseau (1712-1778)
a)‚ Emil oder Über die Erziehung‘ (1762)
Zu Rousseaus Erziehungs-Konzept heißt es in dem Wikipedia-Artikel Rousseau: Emil:
„Es gibt nach Rousseau dreierlei Lehrer: die Natur, die Menschen und die Dinge. Erstere entwickelt unsere Fähigkeiten und Kräfte, die Mitmenschen lehren uns deren Gebrauch und die Dinge erziehen uns durch die Erfahrung, die wir mit ihnen machen, und durch die Anschauung. Die Aufgabe des Erziehers ist, dafür zu sorgen, dass die drei Erzieher im Gleichgewicht sind, da der Schüler ansonsten schlecht erzogen und immer uneins mit sich wäre. Das Ziel der Erziehung ist dabei das der Natur selbst; denn die Dinge und die Menschen können zumindest zum Teil, die Natur aber gar nicht beeinflusst werden, weshalb die zwei anderen nach ihr ausgerichtet werden müssen. Elementar für Rousseau ist dabei der Verzicht auf Macht gegenüber dem Zögling: „Befehlt ihm nie und nichts, was es auch sein mag. (…) Er braucht nur zu wissen, dass er schwach ist und ihr stark seid, dass er also notwendigerweise von euch abhängig ist“.[…] Dies führe zu einer gesunden Beziehung zwischen ihm und dem Erzieher und vermeide das übliche Machtverhältnis mit Unterwerfung des Schülers. Aller Zwang soll ersetzt werden durch Notwendigkeit, welche dem Kinde einsichtiger ist: „Mit dem Band der Notwendigkeit bindet, treibt oder hält man es zurück, ohne dass es murrt. Die bloße Macht der Dinge macht es gefügig und folgsam“.[…] Rousseau kritisiert die Lehrpläne der damaligen Zeit, die die Lernenden mit Inhalten konfrontieren, die für sie keine erkennbare unmittelbare Bedeutung haben. Dieser Bezug zur eigenen Lebenswirklichkeit müsse aber gegeben sein, wenn Inhalte gelernt werden sollen. Dieser Vorgang des Lernens entspreche gleichsam einem natürlichen Lernen.
»Wenn man, nach dem Grundriss den ich zu entwerfen angefangen Regeln folgt, die den üblichen gerade entgegengesetzt sind, wenn man den Geist seines Zöglings nicht unaufhörlich in die Ferne führt, wenn man ihn nicht an andere Orte, in andere Him-melsgegenden, in andere Jahrhunderte, an die äußersten Enden der Erde, ja bis in den Himmel schweifen lässt, sondern sich vielmehr befleißigt, ihn stets in sich selbst und auf dasjenige aufmerksam zu erhalten, was ihn unmittelbar angeht, alsdann wird man ihn zum Empfinden, zum Behalten und sogar zum Urteilen fähig finden. Dies ist die Ordnung der Natur.« […]
Erziehung
Die Einteilung von Kindheit und Jugendalter leitet sich von Rousseaus Beobachtungen her und beschreibt vier Phasen: die Kindheit (Alter der Natur, Geburt bis zum dritten Lebensjahr), das Knabenalter (Alter der Stärke, bis zum zwölften Lebensjahr), die Vorpubertät (Alter der Vernunft, zwölf bis fünfzehn) und die Pubertät, auch Jünglingsalter – adolescence – genannt (Alter der Einsicht, bis zum zwanzigsten Lebensjahr). Nach ihrem Abschluss ist Emile der Begleitung seines Erziehers nicht mehr bedürftig, dieser kann ihm aber noch als Freund erhalten bleiben.
Rousseaus Maßnahmen:
1. Der Erzieher wird zum Freund, dessen der Zögling bedarf.
2. Die Leidenschaften werden ihrer Heftigkeit dadurch beraubt, dass man sie Anlässen wie Sport, Jagd und Wandern aussetzt.
3. Neben der Selbstliebe ist Mitleid die zweite der ursprünglichen Regungen; sie soll im Jugendlichen erweckt und gefördert werden.
4. Das Studium der Literatur und Geschichte sollen den Zögling in der Rolle des Beobachters die Menschen sehen lernen lassen, wie sie sind.
5. Dem Zögling werden Begriffe, Ideen und eine Vorstellung vom Ganzen gegeben, also Religion nahegebracht.
6. Der Erzieher sucht die Gefährtin des Zöglings mit großem Bedacht selbst aus. Er lässt ihn sich eine Vorstellung von ihr machen, und dieses gedachte Ideal wird nun der Vergleich für jede wirkliche Frau.
Die Erziehung zum Bürger
„Emile ist nicht dazu geschaffen, um immer einsam zu bleiben. Als Glied einer Gemeinschaft muss er ihre Pflichten erfüllen.“ … Der Zögling, bislang in der Einsam-keit zur Unabhängigkeit erzogen, sollte zuletzt in der Lage sein, den Gesellschafts-vertrag zu schließen und in der Gemeinschaft zu bestehen. In ihm selbst erwacht die Sehnsucht nach einer Gefährtin, woraufhin sein Erzieher ihn anhand einer für ihn bestimmten Frau die Kostbarkeit und die Probleme von Bindung unter Menschen überhaupt erfahren und bewältigen lässt, was als Vorbereitung für die große Vertragsgemeinschaft, die Gesellschaft, welche der Zögling später eingehen soll, dient. Dazu gehört Menschenkenntnis, und es genügt nicht mehr nur die durch Lektüre erworbene, sondern sie muss erprobt und angewendet werden. Daher wird der junge Mensch eine längere Reise durch Europa antreten, binnen welcher er sich prüft, seine Wünsche und Vorstellungen von der Zukunft konkretisiert. Er vergleicht die Fremde mit dem Heimatland, um dann eine freie Wahl treffen zu können. Mit welchem Volk, in welchem Land möchte er seine Existenz aufbauen und als Glied der Gemeinschaft den Gesellschaftsvertrag schließen?“
Festzuhalten bleibt, dass Rousseau als „Autoritäten“ nur die Natur, die Dinge selbst und die ihnen innewohnenden Notwendigkeiten anerkennt. Erzieher/innen dürfen keinerlei persön-lichen Zwang auf die „Zöglinge“ ausüben. „Aller Zwang soll ersetzt werden durch Not-wendigkeit, welche dem Kinde einsichtiger ist: »Mit dem Band der Notwendigkeit bindet, treibt oder hält man es zurück, ohne dass es murrt. Die bloße Macht der Dinge macht es gefügig und folgsam.«“
b) Rousseaus Einfluss auf die Entwicklung der Erziehungs-Theorien
Hierzu heißt es in dem Wikipedia-Artikel Émile oder Über die Erziehung:
„Rezeption und Publikationsgeschichte
Rousseaus gesellschaftskritische Schriften waren von Anfang an heftiger Kritik ausgesetzt. Wie sein Contrat social wurde sein im Mai erschienener Émile Anfang Juni 1762 beschlagnahmt. Die Sorbonne verurteilte das Buch Anfang Juni, das Parlement von Paris verbot es wenige Tage danach und erließ einen Haftbefehl gegen Rousseau. Stein des Anstoßes war vor allem die im Émile im 4. Buch als Einschub enthaltene Profession de foi du vicaire savoyard („Glaubensbekenntnis des savoy-ischen Vikars“). In diesem Text trägt Rousseau eine Philosophie von Erkenntnis und Moral vor, in der das eigene Herz bzw. Gewissen die Entscheidungen trifft. Im folgenden Entwurf einer „natürlichen Religion“ übt der Autor scharfe Kritik an jeglicher Religion, die sich auf eine Offenbarung gründet. Dies stieß auf Widerstand bei französischen und Genfer Autoritäten, darunter der Erzbischof von Paris Christophe de Beaumont und Vertreter des Calvinismus. In Genf und Paris wurden Exemplare des Émile, in Genf auch der Gesellschaftsvertrag, verbrannt. …
27 Jahre später wurde Rousseau zu einer mythischen Figur der Französischen Revolution und seine Rezeption änderte sich schlagartig. Bei einem der dringlichsten Anliegen der neuen Regierung, der Reform des Bildungswesens und der Schaffung eines Systems öffentlicher Schulen, zitierte man eifrig aus seinem Émile[A 8] und berief sich allerorten auf ihn.[A 9]
Wie die Bibliografie […] zeigt, sind zwischen der ersten Veröffentlichung des Werkes 1762 bei Jean Néaulme in Den Haag[21] bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 59 unterschiedliche Editionen in Französisch und 21 Veröffentlichungen in einer Fremd-sprache erfolgt. Wenn man jedoch die unterschiedlichen Druckauflagen und Aus-lieferungen hinzunimmt, erhöht sich die Zahl allein in französischer Sprache auf 73.[…] Nach Rousseaus Tod bildeten seine Freunde die Société typographique de Genève, um eine endgültige Herausgabe seiner vollständigen Werke zu ermöglichen, die nach dem Willen Rousseaus auch seine handschriftlichen Anmerkungen enthielt. Der Edition dieser Gesellschaft folgten zwischen 1780 und 1782 zehn weitere Editio-nen, darunter drei allein des Émile. Einen markanten Einschnitt innerhalb der Publikationsgeschichte bildet die Französische Revolution. Danach nahm nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa in allen Bevölkerungsschichten (davon zeugen die unterschiedlichen Ausstattungsqualitäten der erschienenen Bücher) das Interesse am Émile zu. Einzige Ausnahme von diesem Trend bildet England, das sich schon vor der Revolution von Rousseau abgewandt hatte. […]
Rousseaus Thesen leiteten eine Revolution in der Pädagogik ein und beeinflussten alle berühmten Erzieher des 19. Jhs. wie Pestalozzi, Herbart und Fröbel.[…] Heute gilt Rousseau als Vordenker im Detail unterschiedlicher Reformbewegungen wie der Reformpädagogik, der Erlebnispädagogik, der Anschauungspädagogik sowie der Antiautoritären Erziehung.“
Zum gleichen Thema schreibt Christa Uhlig (2013):
„Rousseaus „Émile“ symbolisiert wie kaum ein anderes pädagogisches Werk die Epoche der Aufklärung und den Beginn einer neuzeitlichen, aus theologischer und politischer Umklammerung ausbrechenden Pädagogik, wie sie sich seit Jan Amos Comenius, Wolfgang Ratke und John Locke angebahnt hatte.
Aus der Reflexion der politischen, sozialen und lebensweltlichen Probleme des Übergangs vom Feudalismus zum bürgerlichen Zeitalter und in Abkehr von spät-feudalen Welt- und Menschenbildern richtet Rousseau sein Erkenntnisinteresse auf den Menschen, seine Möglichkeiten, Widersprüche und Begrenzungen. Natürlichkeit, Vernunft und Selbstbestimmtheit werden zu Leitgedanken einer Idee von Menschen-bildung, die von der Entwicklungsfähigkeit und Bildsamkeit eines jeden ausgeht, daran Zukunftserwartungen bindet, aber im Unterschied zu anderen zeitgenössischen pädagogischen Denkern den Menschen weder als Tabula rasa noch als Objekt all-mächtiger Erziehung versteht. Blinder Fortschrittsoptimismus ist ihm ebenso wenig zu
unterstellen wie Naturalismus. Seine Erziehungsideen zielen auf Identität und Souve-ränität, auf Vereinbarkeit von natürlicher und gesellschaftlicher Existenz, von Mensch und Bürger und beinhalten zugleich ein Gespür für die Ambivalenzen, Widersprüche und Grenzen einer solchen Erziehung. Wohl auch daraus erklärt sich Rousseaus Anregungs- und Wirkungsmacht, die sich in einer breiten, bis heute uneinheitlichen und polarisierten Rezeptionsgeschichte zeigt, die bereits zu seinen Lebzeiten begann (vgl. Formeys Anti-Émile 2012).
Den stärksten Einfluss übte Rousseau auf den Philanthropismus in Deutschland aus. Seine Vertreter gaben Rousseaus pädagogischen Ideen eine „pragmatische Wende“, indem sie „Brauchbarkeit“ und „Vervollkommnung“ als Möglichkeit der Heran-bildung des bürgerlichen Menschen ausdeuteten (Backes-Haase 1996, 233f.; Pulmer 2012). Basedow in Dessau, Rochow in Reckahn, Salzmann in Schnepfenthal, um nur einige prominente Beispiele zu nennen, gründeten und gestalteten ihre Lehranstalten im Geiste von Rousseaus Erziehungsprinzipien (vgl. Schmitt 2007). Verbreitung fanden seine Ideen nicht nur durch die in den vielbesuchten Philanthropinen anschau-lich vorgeführte neue Erziehungsart, sondern vor allem durch die von Joachim Heinrich Campe 1789 bis 1791 veröffentliche deutsche Übersetzung des„Émile“ in der ab 1785 herausgegebenen sechszehnbändigen „Allgemeinen Revision des gesamten Schul- und Erziehungswesens von einer Gesellschaft praktischer Erzieher“ ( vgl. hier-zu besonders Kersting 1992). Mit einer ausführlichen Kommentierung der Rous-seauschen Erziehungsauffassungen wurde hier zugleich „eine bis heute relevante Traditionslinie“ (ebd., 85) gestiftet. … Auch Wilhelm von Humboldt, Johann Heinrich Pestalozzi, Adolph Diesterweg und Friedrich Fröbel suchten im Anschluss an Rousseau nach Bedeutung und Möglichkeiten zeitgemäßer Pädagogik. …
Bereits hier sollte sich auch zeigen, dass die naiv anmutende Übertragung der „Ordnung der Natur“ auf die „gesellschaftliche Ordnung als das ‚moralische Gesetz-buch‘ des Individuums“ (Ahrbeck 1978, 100f.) nicht die von Rousseau erträumte Harmonie zwischen Mensch und Bürger erbrachte. …
Vieles, was Rousseau im „Émile“ thematisiert hatte, ging in den Grundbestand moderner Pädagogik ein – Selbsttätigkeit, Anschaulichkeit, Erfahrungslernen, alters-gemäße, subjektorientierte und individualitätsgerechte Erziehung oder auch die Pro-blematisierung von Zwang, Strafe und autoritären Führungsstilen. Anderes, was ihm mittels Erziehung lösbar schien, erwies sich als permanente Herausforderung an pädagogische Reflexion. Aber auch Formen des „Rousseauismus“ (Böhm/Soëtard 2012, 130ff.), selektive Interpretationen, Überhöhungen, anti-aufklärerische Tenden-zen und Funktionalisierungen verschiedener Schattierungen sind in der Rezeptions-geschichte zu finden. Am Beginn des 20. Jahrhunderts war es besonders die reform-pädagogische Bewegung, die vor dem Hintergrund von Kulturpessimismus und Kulturkritik und einer eher autoritär-lernorientierten Schulentwicklung im 19. Jahr-hundert Begriffe wie Natur, Individualität, Entwicklung, Selbsttätigkeit oder Wach-senlassen wieder in das pädagogische Denken zurückzuholen suchte und sich dabei mehr oder weniger, meist ohne tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Original, auf Rousseau bezog (vgl. Hansmann 1996b, 245-279; Grell 1996; Hentig 2010, 88f.). Zwar lassen sich manche der reformpädagogischen Neuerungen, wie z.B. die Land-erziehungsheime, die Pädagogik vom Kinde aus oder auch die Arbeitsschule, womög-lich mit Rousseau begründen, ihre Funktion und Bedeutung indessen bezogen sie primär aus den anders gearteten gesellschaftlichen Verhältnissen des 20. Jahrhunderts.
Ein spezifischer Bezug zu Rousseau lässt sich auch in der im 19. Jahrhundert gewach-senen und sich zunehmend Erziehungsfragen zuwendenden Arbeiterbewegung fest-stellen – ein Bereich, der in der pädagogischen Rousseauforschung bisher kaum beachtet wurde. Vor allem zwei Rezeptionsstränge fallen auf. Zum einen wird Rousseau in eine Traditionslinie bürgerlicher Pädagogik (Comenius, Rousseau, Pestalozzi) gestellt, die für das pädagogische Denken der Arbeiterbewegung in vielen Fragen anschlussfähig schien (vgl. z.B. Woltmann 1900/01; Vorländer 1902/03). Zum anderen finden sich im Zusammenhang mit Überlegungen zur Arbeitserziehung bzw. zur Arbeitsschule – meist allgemein gehaltene – Rückgriffe auf Rousseaus Begrün-dung einer handwerklichen Ausbildung des Émile (vgl. z.B. Braun 1886). … Hier wie da war für das Interesse an Rousseau dessen gesellschaftstheoretische Einbindung des Erziehungsdenkens maßgebend. …
Es sei vor allem die „demokratische Richtung der Aufklärung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts“ gewesen, die statt „sklavischer Unterthanen“ die „Heranziehung denkender, karaktervoller Bürger“ „auf ihr Banner“ geschrieben hätte (Kautsky 1887/2006, 246). Diese Richtung fand in der Arbeiterbewegung insgesamt eine nicht unbedeutende Rezeption, und speziell Rousseau hatte hier eine Verteidigerin gegen das konservativ-bürgerliche Lager (vgl. z.B. Roland-Holst 1921). Daran lässt Edwin Hoernle in einer kritischen Rezension einer Neuausgabe der „Bekenntnisse“ aus Anlass des 200. Geburtstags Rousseaus keinen Zweifel: „Während die proletarischen Zeitungen mehr oder weniger Wert darauf legten, der großen historischen und sozial-politischen Bedeutung Rousseaus gerecht zu werden und den Menschen sowohl als sein Wirken aus den sozialen, politischen und kulturellen Verhältnissen der Zeit zu erklären, hat die große Mehrzahl bürgerlicher Blätter ihr Augenmerk fast ganz auf die individuelle Persönlichkeit, den Charakter und das Seelenleben Rousseaus konzen-triert.“ (Hoernle 1912/13/2006, 515f.) Diese unterschiedliche Sichtweise entspränge „dem Gegensatz zwischen materialistischer Geschichtsauffassung und individualisti-schen Ideologien oder, was dahinter steckt, dem Interessengegensatz zwischen einer materiell-gesättigten und einer noch hungernden und kämpfenden Klasse“… „Die Interessen seiner Klasse und die Ideologien seiner Klasse haben auf Rousseaus Ent-wicklung bestimmend eingewirkt, und nur weil sie in seinen Gedanken und Werken lebendig waren, haben diese eine ungeheure Wirkung auf ihre Zeit ausgeübt, sie sind zu einem Faktor der Geschichte geworden.“ (Ebd., 516)
Ich belasse es bei diesen knappen rezeptionsgeschichtlichen Anmerkungen mit einem Verweis auf Lion Feuchtwangers Roman „Narrenweisheit oder Tod und Verklärung des Jean Jacques Rousseau“ (1953), in dem die Ambivalenz der Rousseau-Rezeption treffend benannt ist. …“4
Offensichtlich konnten die Experten auch über die Rezeptions- und Wirkungsgeschichte von Rousseaus Erziehungs-Theorie keine Einigkeit erzielen. Umso mehr wird es im Folgenden darauf ankommen, neuere Forschungsergebnisse heranzuziehen, um evtl. ein neues Erzie-hungs-Konzept zu begründen.
II. Zum Forschungsstand von Entwicklungs-Psychologie und - Neurologie
Wie aus den Erkenntnissen von Ernst Habermann (1996), Benjamin Libet (2005) und Markus Kiefer (2015) hervorgeht, verfügen Säuglinge bereits über angeborene Fähigkeiten wie dieje-nigen zur Willensfreiheit und zur Unterscheidung von Gut und Böse. Der einstige Ethik-Kommissar Ernst Habermann erklärt hierzu (1996):
„Die Evolution hat zwei feine Sensoren der Solidarität erfunden, nämlich Gewissen und Mitleid, und mit der Befindlichkeit gekoppelt. Die biologisch vorgegebene, späte-stens beim Menschenaffen … gesicherte Einfühlung ist eine wichtige Grundlage unseres Ethos.“5
Wobei Habermann neben dem Streben nach guter Befindlichkeit zwei weitere, evolutionär entstandene Grundfaktoren der Ethik nennt: die Gegenseitigkeit und die Überwindung des puren Egoismus durch Altruismus und Zusammenarbeit. Es sind Faktoren, die Habermann problemlos mit Kants Kategorischem Imperativ verbindet:
„Der Einzelne soll sein spezielles Verhalten so einrichten, daß es sich als Maxime aller Partner eigne.“ (ebd.)
Dies sei ein Satz, mit dem Kant „zutiefst recht“ hatte.
Feststeht allerdings auch, dass Säuglinge noch nicht in der Lage sind, Willensfreiheit und Morals bewusst anzuwenden bzw. zu erproben. Der Hauptgrund hierfür liegt in der Tatsache, dass die für solche Aktivitäten erforderlichen Gehirn-Areale bei Säuglingen noch nicht heran-gereift sind. Hierzu heißt es bei Microsoft-Copilot (28.04.2025):
„Der Ansatz, dass die Fähigkeit zur Unterscheidung von Gut und Böse – und damit die Grundlage einer kontrollierten Willensfreiheit – evolutionär aus dem Tierreich stammt, ist ein spannendes Konzept. Diese Theorie legt nahe, dass bestimmte Verhal-tensdispositionen, die für das Überleben und das soziale Miteinander wichtig sind, schon in grundlegenden, instinktiven Formen existieren. Dabei ist es durchaus denkbar, dass auch Säuglinge – wenn auch in einem sehr rudimentären, unreflektierten Modus – erste Bausteine dieser Fähigkeit besitzen.
Allerdings muss man hier zwischen instinktiven Reaktionen und dem, was wir als freie, bewusste Entscheidung bezeichnen, unterscheiden. Säuglinge handeln primär aufgrund von Reflexen und grundlegenden Bedürfnissen, ohne die kognitive Reife, um zwischen komplexen moralischen Kategorien wie „gut“ und „böse“ zu unterscheiden. Während einige Studien der Entwicklungspsychologie zeigen, dass Kleinkinder bereits eine Präferenz für prosociales Verhalten haben, handelt es sich hierbei eher um erste, evolutionär geprägte Sensitivitäten – ein fundamentaler Antrieb, der später in einen reflektierteren Moral- und Willensbildungsprozess übergeht.“
Und zur Hirn-Reifung im Kindes- und Jugendalter (a.a.O.):
„Die Hirn-Reifung im Kindes- und Jugendalter ist ein faszinierender, dynamischer Prozess, der sich über viele Jahre erstreckt und zahlreiche komplexe Veränderungen umfasst.
Frühe Kindheit – rasante Synapsenbildung und erste Spezialisierung: Bereits vor und kurz nach der Geburt beginnt das Gehirn, ein massives Netzwerk aus Nervenzellen (Neuronen) und deren Verbindungen (Synapsen) zu bilden. In den ersten Lebensjahren entstehen in einem regelrechten „Synapsen-Boom“ extrem viele Verbindungen – oft weit mehr, als im späteren Leben tatsächlich benötigt werden. Diese übermäßige Bildung schafft die Grundlage für eine hohe neuronale Plastizität, die es Kindern ermöglicht, sich rasch Sprachen, motorische Fähigkeiten und soziale Interaktionen anzueignen. Danach folgt ein Prozess des synaptischen „Prunings“ – das selektive Abbau von ungenutzten Verbindungen – wodurch die effizienteren und häufig gebrauchten Bahnen gestärkt werden und das Netzwerk insgesamt effektiver und spezialisierter arbeitet.
Jugendalter – Feinabstimmung und frontale Reifung: Mit dem Eintritt in die Jugend verändert sich das Bild: Nicht nur werden die grundlegenden Verbindungen verfeinert, sondern auch wichtige Strukturen wie der Frontallappen machen einen langen, wohl über die Adoleszenz hinausreichenden Reifungsprozess durch. Dieser Bereich ist verantwortlich für komplexe Funktionen wie Planung, Impulskontrolle, Problem-lösung sowie abstraktes Denken und bleibt bis in das junge Erwachsenenalter relativ „unreif“. Gleichzeitig schreitet die Myelinisierung voran – also die Isolierung von Nervenzellfasern durch Myelin – was die Geschwindigkeit und Präzision der elek-trischen Signale zwischen den Gehirnregionen verbessert. Dadurch werden Denk-prozesse zunehmend schneller und koordinierter.
Netzwerkumstrukturierungen und Umweltfaktoren: Im Laufe der Kindheit und Jugend entwickelt sich das Zusammenspiel verschiedener Hirnregionen weiter. Während sensorische und motorische Areale früher recht schnell ihre Stabilität erreichen, reifen Netzwerke, die komplexe kognitive und emotionale Prozesse steuern – etwa solche, die für Aufmerksamkeit, soziale Kognition oder das Verarbeiten von Emotionen zuständig sind – erst allmählich. Dabei spielen neben genetischen Faktoren auch Um-weltbedingungen, Lernerfahrungen und soziale Interaktionen eine entscheidende Rolle. Diese Einflüsse formen, verstärken oder schwächen bestimmte neuronale Verbindungen, sodass das Gehirn optimal auf die Herausforderungen des Lebens vorbereitet wird.
Zusammenfassung und Ausblick: Der gesamte Verlauf der Hirn-Reifung lässt sich in mehrere zentrale Phasen gliedern: einen anfänglichen Quantensprung in der Synapsen-bildung, gefolgt von einem selektiven Abbau nicht notwendiger Verbindungen, einer fortschreitenden Myelinisierung und einer Spezialisierung komplexer Netzwerke, besonders im Frontallappen. Dieser Prozess ist nicht linear, sondern verläuft als dyna-misches Zusammenspiel von biologischen Vorgaben und Umwelteinflüssen, das zu einer ausgeprägten individuellen Ausprägung der kognitiven, emotionalen und sozia-len Fähigkeiten führt.“
Demgemäß lässt sich für die Situation im Säuglingsalter festhalten:
1. Obwohl die Fähigkeiten zu Willensfreiheit und Moral angeboren sind, spielen sie im Säuglingsalter noch fast gar keine Rolle, weil die erforderlichen Gehirn-Areale noch nicht herangereift sind.
2. Allerdings beginnt schon kurz nach der Geburt der Aufbau eines umfangreichen Netz-werks aus Neronenzellen (Neuronen) und deren Verbindungen (Synapsen).
3. Dadurch entsteht hohe neuronale Plastizität.
4. Das Zusammenspiel verschiedener Hirnregionen beginnt.
5. „Säuglinge handeln primär aufgrund von Reflexen und grundlegenden Bedürfnissen, ohne die kognitive Reife, um zwischen komplexen moralischen Kategorien wie „gut“ und „böse“ zu unterscheiden.“
Zur Entwicklung des Selbst
Für die Entwicklung vom Säuglingsalter zum Kindes- und Jugendalter spielt das Selbst eine entscheidende Rolle. Erst das Selbst schafft Bewusstsein auf der Grundlage u.a. von Wahr-nehmung, Gedächtnis, Verstand und Selbstbewusstsein und damit den Zugang zu allen Ressourcen der Vernunft und des Geistes. Nietzsche hatte dieses Selbst irrtümlich noch mit dem Leib gleichgesetzt. Warum er sich damit im Irrtum befand, geht vor allem aus den For-schungsergebnissen hervor, die der Neurowissenschaftler Joachim Bauer u.a. in seinem Buch Wie wir werden, wer wir sind (2019) vorgetragen hat. Darin weist er auf, dass das Selbst – anders als Nietzsche es vermeinte – nicht mit dem Leib identisch, d.h. nicht angeboren ist, sondern erst durch zwischenmenschliche Beziehungen im Säuglingsalter zu entstehen beginnt:
„Der menschliche Säugling, obwohl ein fühlendes, mit der Würde des Menschen aus-gestattetes Wesen, verfügt über kein Selbst. Die neuronalen Netzwerke, in denen sich Letzteres einnisten wird, sind zum Zeitpunkt der Geburt noch unreif und funktions-untüchtig. Seine Entstehung und Grundstruktur verdankt das menschliche Selbst jenen Bezugspersonen, die uns – vor allem in den ersten Lebensjahren – als »Extended Mind«, das heißt, als eine Art externe Leitstelle gedient haben. An der Komposition des Selbst sind Resonanzvorgänge beteiligt, wie sie sich zum Beispiel zwischen zwei Gitarren beobachten lassen: So, wie der Klang der einen Gitarre die Saiten einer zwei-ten Gitarre zum Klingen bringen kann, so können Bezugspersonen ihre inneren Melo-dien – ihre Art zu fühlen, die Welt zu deuten und in ihr zu handeln – via Resonanz auf den Säugling übertragen. Da dieser Transfer sich – in reduzierter Form – lebenslang fortsetzt, ist unser Selbst eine Komposition aus entsprechend vielen Themen und Melodien.“ (a.a.O. S. 7)
Das Selbst ist also nicht einfach der Leib, sondern ein Gemisch, ein mixtum compositum, aus dem personalen Individuum – als Einheit aus Leib, Seele und Geist –, seinen Bezugspersonen, seiner Umwelt und der Gesamtheit seiner Erfahrungen. J. Bauer präzisiert:
„In Säuglingen und Kleinkindern komponiert sich ein Selbst, dessen Themen von ihren Bezugspersonen über Resonanzvorgänge in sie hineingelegt wurden. Je weiter wir heranwachsen und persönlich reifen, desto mehr wird das Selbst zu einem Akteur, der mitspricht und beeinflusst, was mit ihm geschieht. Wir entwickeln ein Gefühl, das uns spüren lässt, welche an uns herangetragenen Angebote zu uns passen und zu einem stimmigen Teil unseres Selbst werden könnten, und welche unserer Identität Gewalt antun würden. Der Mensch ist das einzige Wesen, das sich an der Konstruk-tion seiner selbst – und seines Selbst – beteiligen kann, ein Hinweis, der in dieser ex-pliziten Form erstmals durch den Renaissance-Philosophen Pico de la Mirandola gege-ben wurde.“ (a.a.O. S. 8, Hervorhebungen K.R.)
Näheres und Weiteres hierzu führt J. Bauer auf 255 Seiten in 15 Kapiteln aus, darunter spe-ziell zum Selbst-System in den Kap. 1-6, 10, 11, 13 und 14, daneben und zusammen mit Themen wie Resonanz (darunter dem „Resonanzraum der Gesellschaft“, wenn auch nur auf gut 6 Seiten), Pädagogik, Arbeit, Partnerschaft, Psyche und Neurobiologie.
Zur Entstehung des Selbst:
Der Säugling wirkt und ist zunächst einerseits völlig hilflos und unreif, zeigt aber andererseits schon frühzeitig Fähigkeiten zu Anteilnahme und Kommunikation mit seinen/ihren Bezugs-personen, und zwar u.a. dadurch, dass Säuglinge schon früh beginnen, z.B. die Mimik einer Bezugsperson nachzuahmen. Echte Spiegelung und Resonanz wird daraus allmählich auf Grund der sogenannten Spiegelneuronen oder auch: Spiegelnervenzellen. (Wobei sogleich daran zu erinnern ist, dass diese speziellen Nervenzellen für die Empathie zuständig sind.) Hier liegen nicht Echo-Effekte, sondern echte Resonanz-Funktionen vor, und zwar u.a. in Form von Signalen der Körpersprache bzw. des Gefühlsausdrucks sowohl beim Säugling als auch bei der Bezugsperson. Hierdurch werde sogar das Gehirn des Säuglings geformt (a.a.O. S. 24). Wobei sich das Selbst nach und nach u.a. als Ich-Du-Sinn herausbilde:
„ Der Mensch entwickelt seinen Ich-Sinn in einer absolut einzigartigen Art und Weise: Das Selbst des Menschen als »Ich-Du-Sinn«. Das Resonanzprinzip lässt die Ge-stimmtheiten, Haltungen und Handlungsweisen der primären Beziugsperson(en) zu den Gefühlen und inneren Einstellungen des Kindes werden.“ (J. Bauer a.a.O. S. 31, Hervorhebungen K.R.) Daher fordert der Autor auch für die Kleinsten „ein sozial in-telligentes Umfeld, also Eltern oder gut qualifizierte Bezugspersonen, die ihnen ein verlässliches, liebevolles, dabei aber nicht einengendes, sondern förderndes Du sind.“ (a.a.O. S. 57)
Im Zusammenhang damit beschreibt J. Bauer auch den frühkindlichen Spracherwerb, wobei er hervorhebt, dass von der Sprache auch psycho-physische Top-down-Bewegungen ausge-hen, und zwar mittels neurobiologischer Rezeptoren im Gehirn, wobei nicht nur die Sprach-zentren des Gehirns, sondern auch die Spiegelneuronen und das neuronale Selbst-System aktiv werden. Zwischen beiden Systemen gebe es eine Arbeitsteilung. Das Selbst-System ar-beitet vor allem mit kognitiven Geistesinhalten (Gedanken, Ideen, Begriffe, Theorien, Wer-tungen usw.), während Spiegelneuronen nach speziellen neurobiologischen Regeln funktio-nieren, und zwar auf Grund von „Informationen, die sich mit dem Körper ausdrücken oder am Körper ablesen lassen“ (S. 85). (Was natürlich ebenfalls eine Form von Resonanz ist.) Das Erstaunliche daran: Die durch das neurobiologische Resonanzsystem „übertragene Informa-tion ist nichtstofflicher Natur“ (S. 86)! Die Körpersprache wird dabei sozusagen „ausgelesen“, indem der Beobachter die beobachtete Handlung „sozusagen »heimlich, still und leise« simu-liert, das beobachtete Geschehen also intern als Kopie mitlaufen lässt“ (ebd.), was mit dem Phänomen der „emotionalen Ansteckung“ verbunden sein kann: Gemütszustände wirken dann wechselseitig:
„Das Lesen der Körpersprache kann durch Erfahrung und Übung optimiert werden. Menschen mit Autismus können die Körpersprache anderer nicht »lesen«. Besonders geübt im Entschlüsseln der Körpersprache sollten Menschen sein, die viel mit anderen zu tun habe: Pflegekräfte, Sozialarbeiterinnen uns Sozialarbeiter, Servicepersonal, Ärztinnen und Ärzte, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte, Anwältinnen und An-wälte, Richterinnen und Richter, Eltern und Großeltern.“ (S. 89)
Die Kehrseite: Es gibt auch das Leiden am Selbst, so in Phänomenen wie Narzissmus, Abhängigkeit, Depressionen, bis hin zu ‚Gaslighting‘ (Psychoterror durch Einschüchterung u.a.m.) und zur „Auflösung des Selbst“, z.B. in Erkrankungen wie Traumatisierung und Demenz. – Wogegen das Selbst sich jedoch zu wehren vermag:
„Das Selbst ist jedoch nicht machtlos. Es spürt nicht nur, welche Menschen und welche Ansagen ihm guttun oder nicht behagen, welche seine Kräfte vermehren oder schwächen. Es hat den Selbst-Beobachter an seiner Seite, der es ihm ermöglicht, sich über sich, über die eigenen Motive und über die Motive anderer Gedanken zu machen. Sein Sensorium und seine Analyseinstrumente befähigen das Selbst, Einfluss darauf zu nehmen, mit welchen Menschen es sich umgibt, welchen Menschen es sich anschließt und was mit den Botschaften passiert, die von Mitmenschen im eigenen Selbst landen.“ (S. 161)
Insgesamt gesehen hält J. Bauer den Besitz des Selbst-Systems für ein Erkennungs- und Alleinstellungsmerkmal der menschlichen Spezies. Es befähigt sowohl zur Selbst-Fürsorge als auch zur Fürsorge für andere Menschen. Es verhilft zur Ich-Findung, zur inneren Ruhe und Gelassenheit, so auch in der Meditation, in Yoga und – falls erforderlich – durch Psycho-therapie. Worin J. Bauer auch Möglichkeiten und zugleich Verpflichtungen des ärztlichen Tuns erkennt, die weit über Diagnostik und Therapie hinausgehen:
„Wen adressieren Ärzte, wenn sie eine Diagnose mitteilen oder die Behandlung erklä-ren? Sie adressieren das Selbst-System ihrer Patienten, welches – parallel zu dem, was der Arzt tut – seinerseits, sozusagen als »innerer Arzt«, in den eigenen Körper hinein-wirkt. Optimale Heilerfolge erzielen nur solche Ärzte, die in der Kommunikation mit ihrem Patienten dessen Selbst-Kräfte und seine Zuversicht stärken und ihm erklären, dass es sich lohnt, den Lebensstil gesundheitsdienlich zu verändern, und die ihm Mut machen, der Krankheit die körpereigenen Heilkräfte entgegenzusetzen. Zu den Aufga-ben jedes guten Arztes gehört es, den »inneren Arzt« seiner Patienten anzusprechen und zu stärken.“ (S. 200 f.)
Und Bauers Schlusswort lautet:
„Der Umgang mit unserem Selbst – und mit dem unserer Mitmenschen – erfordert Sensibilität, Geduld, Bewahrung, manchmal aber auch einen mutigen Schritt hinein in Möglichkeits- und Entwicklungsräume. Mehr als alles andere aber braucht unser Selbst – und das unsere Mitmenschen – dieses eine: Liebe.“ (S. 209)
Dies ganz im Sinne meiner eigenen Darlegungen zum Thema „Liebe als Weltknoten“.6 Wobei allerdings zu bedenken ist, dass mit Liebe allein leider nicht alle Welt-Probleme zu lösen sind. (Vgl. Robra 2024 ebd.)
Willensfreiheit und Moral im Kindes- und Jugendalter
Erst unter den Aspekten des Selbst lässt sich verstehen, wie Kinder und Jugendliche Willens-freiheit und Moral zu aktivieren vermögen. Hierzu bemerkt Microsoft Copilot (a.a.O.):
„Kinder besitzen in gewissem Maße sowohl Ansätze von Willensfreiheit als auch einen angeborenen moralischen Kompass, doch beide Eigenschaften befinden sich in einem fortwährenden Entwicklungsprozess.
Schon im frühen Kindesalter treffen Kinder erste Entscheidungen – sie zeigen Eigen-initiative und reagieren impulsiv auf ihre unmittelbaren Bedürfnisse. Dieses frühe Entscheidungsverhalten kann als rudimentäre Form von Willensfreiheit betrachtet werden, auch wenn es noch stark von Emotionen, unmittelbaren Belohnungen und der eingeschränkten Fähigkeit zur Perspektivübernahme geprägt ist. Mit zunehmendem Alter und wachsender kognitiver Reife entwickeln sie zunehmend die Fähigkeit, bewusste und reflektierte Entscheidungen zu treffen, auch wenn externe Einflüsse wie Erziehung und kulturelle Normen weiterhin ihre Entscheidungsfreiheit mitbestimmen.
Parallel dazu beginnt sich schon früh ein moralisches Empfinden zu entwickeln. Bereits Kleinkinder reagieren auf ungerechte Situationen oder unfaire Behandlung mit Empörung – sie zeigen ein intuitives Verständnis von Gerechtigkeit und können zwischen „richtig“ und „falsch“ unterscheiden, wenn auch zunächst auf einer emotionalen und erfahrungsbasierten Ebene. Im Laufe der Zeit und unter dem Einfluss von Eltern, Erziehern und Gleichaltrigen lernen Kinder, moralische Normen zu verinnerlichen und diese in ihrem Verhalten zu berücksichtigen. Dabei spielt auch die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten wie Empathie und Perspektivenübernahme eine zentrale Rolle, da sie es den Kindern ermöglicht, die Auswirkungen ihres Handelns auf andere Menschen besser einzuschätzen.
Die Weiterentwicklung von Willensfreiheit und moralischem Urteilsvermögen hängt eng mit der Reifung des Gehirns zusammen – insbesondere mit der Entwicklung des präfrontalen Kortex, der für Impulskontrolle, Planung und die Bewertung langfristiger Konsequenzen verantwortlich ist. Dieses neurologische Wachstum erklärt, warum ältere Kinder und Jugendliche in der Regel eine größere Unabhängigkeit bei Ent-scheidungsfindungen und ein differenzierteres moralisches Verständnis aufweisen als jüngere Kinder. Gleichzeitig bleibt die Frage, inwieweit Entscheidungen und morali-sche Urteile wirklich frei sind oder vielmehr von biologischen, sozialen und kulturellen Faktoren mitbestimmt werden – eine Diskussion, die Philosophen, Psychologen und Neurowissenschaftler bis heute beschäftigt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kinder erste Formen von Willensfreiheit und moralischem Empfinden besitzen, die aber im Laufe der Entwicklung durch kognitive Reifung, soziale Interaktionen und den Einfluss von Erziehung kontinuierlich verfei-nert und erweitert werden. Diese dynamische Entwicklung bildet die Grundlage für die spätere moralische Selbstbestimmung und die Fähigkeit, komplexe, ethisch fundierte Entscheidungen zu treffen.“
III. Erziehung und Lernen in der Krise
Die Aktivierung von Willensfreiheit und Moral im Selbst der Kinder und Jugendlichen (s.o.) ist anscheinend Grundlage und Voraussetzung für jegliche Form von Erziehung und Lernen. Von diesem Selbst her wird der Rahmen erahnbar, in dem Erziehung stattfindet. Es ist dies stets ein gesamtgesellschaftlicher, letztlich unüberschaubarer Rahmen. Dennoch kann man versuchen, hier mehr Klarheit zu gewinnen, und zwar dadurch, dass man die speziellen gesellschaftlichen Bedingungen berücksichtigt, unter denen Kinder aus ihren Erfahrungen lernen. Denn Lernen geschieht natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern stets unter dem Einfluss bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse; die hierzulande inzwischen zu massiven Beeinträchtigungen der Grundvoraussetzungen jeglichen Lernens geführt haben, darunter vor allem von Aufnahmefähigkeit und -bereitschaft, Sachbezogenheit und Sachlichkeit, Konzentration, Disziplin, Leistungsfähigkeit und -bereitschaft. So dass immer wieder nicht nur von „Bildungsnotstand“, sondern auch von Erziehungskrise und Erziehungskatastrophe die Rede ist. Weshalb anzunehmen ist, dass ‚Selbst-Erziehung nur durch Lernen‘ in unserer Gesellschaft nicht wirklich funktioniert, nicht funktionieren kann.
Fragt man nun nach den Ursachen der Fehlentwicklung, stößt man unvermeidlich auf ein Phänomen, das seit ca. drei Jahrzehnten immer weiter um sich greift: die Spaßgesellschaft. Gründliche Untersuchungen hierzu hat Albert Wunsch (2004) in seiner Arbeit Abschied von der Spaßpädagogik vorgenommen, somit also im Kontext des Erziehungsproblems. Aus einer repräsentativen Expertise eines Sozialforschungsinstituts zitiert Wunsch, dass „im Frühjahr 2001 64 % der Bundesbürger Spaß als Sinn des Lebens“7 angaben. Dies in auffälligem Kontrast zu der Situation vor 1990, als noch „für die meisten Menschen der Lebenssinn in einer zufriedenstellenden Existenzabsicherung“ lag (ebd.). Wie erklärt sich diese schwer-wiegende Veränderung? Wunsch verweist auf die Verwöhn- und Verführungs-Mechanismen, die in der Konsum- und Spaßgesellschaft immer mehr die Oberhand gewonnen haben; wobei er allerdings den Begriff ‚Spaß‘ in problematischer, wenn nicht unzulässiger Weise definiert, nämlich zunächst korrekt als „Mix aus Witz, Scherz, Posse, Jux und Narretei“, dann aber – unverständlicherweise – daraus schließend: „kurz: verdichteter Unsinn“ (ebd.). Somit also Unsinn als Sinn für zwei Drittel der Bevölkerung? Das halte ich für kurzschlüssig. Denn Witze, Scherze, Jux usw. sind nicht per se unsinnig, im Gegenteil, seit jeher dienen sie dazu, Menschen zu unterhalten, aufzuheitern, ihnen das Dasein wenigstens zeitweise zu erleichtern. Kaiser, Könige und Fürsten hielten sich Hofnarren als sinnreiche Kritiker, die Späße machten, dabei manchen „Unsinn“ erzählten – aber durchweg mit raffiniertem Hintersinn.
All diese Sinngebungen sind aber in der heutigen Spaßgesellschaft anscheinend verflacht. Entstanden ist jedoch nicht „verdichteter Unsinn“, sondern Schlimmeres, nämlich u.a. die aktuelle Bildungs- und Erziehungs-Krise. Für die Albert Wunsch folgende Symptome nennt: 1. „Das Lebenskonzept von Spaß-Fixierten orientiert sich demnach an Herumhängen, viel Essen und Trinken, reichlich Fernsehen, im Internet surfen, Shopping, Sex und Super-Action. Giga-Geil muss es sein. Manchen Zeitgenossen macht selbst Mobbing, Diffamierung, Gewalt und Horror Spaß. Und weil derselbe Spaß auf Dauer keinen Spaß mehr macht, muss bald ein Mega-Plus-Programm her. Das Volk will mehr, bis hin zur Unerträglichkeit, wie manche TV-Formate offenkundig werden lassen.“ (ebd.). Wobei sich die Medien-Sucht in den letzten Jahren durch die rasante Entwicklung von Smartphones mit Internet-Zugang weiter verschärft hat. 2. In Misskredit geraten dagegen „Selbst- und Mitverantwortung, Anstrengung, Nutzbringendes, Leistung, soziale Werte und Zukunftstiftendes“ (ebd.). 3. In Mitleidenschaft gezogen werden nicht nur die Eltern, sondern in hohem Maße auch Kinder und Jugendliche. Was sich bei Kindern in Abwehrhaltungen gegenüber fundamentalen Aufgaben wie Sprechen-Lernen, Regeln einhalten, Zimmer-Aufräumen, Hausaufgaben erledigen usw. äußert; bei Jugendlichen z.B. in Leistungsverweigerung und verantwortungslosem Umgang mit Drogen und Alkohol; bei Eltern u.a. in Scheu vor schwierigen Auseinandersetzungen und Problem-lösungen, mangelnder Verlässlichkeit, zu wenig Einsatz für das Gemeinwohl oder auch nur für die eigene Partnerschaft, sobald lästiges Problemlösen gefordert wird. 4. Folgen: fehlende Konflikt-Fähigkeit, Verwöhnung, Antriebslosigkeit, Gleichgültigkeit, Erziehungs-notstand.
Worauf aber ist all dies zurückzuführen? Welche konkreten Ursachen gibt es für solche Fehl-entwicklungen, für das „Schwinden zwischenmenschlicher Werte und Sinnstiftungs-System“, für das Propagieren von „Freiheit ohne die Pflicht zur Eigenverantwortung“ (a.O. S. 4)? Albert Wunsch führt überraschenderweise nur Folgendes an: „Es ist die zu große Sattheit und Versorgtheit vieler Menschen! Denn wenn die Existenzabsicherung als Herausforderung entfällt, konzentriert sich die Sinn-Suche allzu leicht auf eine ständige Glücks-Maximierung des eigenen Seins“ (ebd.).
Darin aber sehe ich einen Erklärungsversuch, der entschieden zu kurz greift. Für die Tatsache, dass sich die Spaß- und Vergnügungssucht seit ca. 30 Jahren immer mehr ausgebreitet hat, muss es tiefere Gründe geben. Ich sehe sie in dem ungehemmten, rücksichtslosen Vormarsch des neoliberalen Turbo-Kapitalismus, der den Konsumismus zum einzig maßgeblichen Sinn- und Glücksvermittler emporstilisiert hat und jegliche Alternative dazu für abwegig und hirnverbrannt erklärt.
Die Tatsache, dass A. Wunsch dies überhaupt nicht berücksichtigt, relativiert in hohem Maße die Relevanz der von ihm vorgeschlagenen Gegenmaßnahmen, darunter die bloßen Hinweise auf die überragende Bedeutung der Erziehung, von „funktionsfähigen Schulen“, der zu jedem Lernen (auch dem spielerischen!) erforderlichen Aufmerksamkeit und Anstrengung und von Werten wie „Sozialkompetenz, Selbstverantwortung, Mut, Stärke, Motivation, Kreativität und Konfliktfähigkeit zur Bewältigung zukünftiger Herausforderungen in Partnerschaft, Familie, Beruf und Gesellschaft“ (a.O. S. 5).
Diese Forderungen sind zweifellos zu bejahen; doch es stellt sich die Frage, wie solche Werte Kindern und Jugendlichen in einer turbo-kapitalistischen Spaßgesellschaft vermittelt werden können. Nur durch deren eigene (Lern-) Erfahrungen? Sicherlich nicht (s.o.)! Und selbst die bestgemeinte qualifizierte Erziehung stößt an die Grenzen, die das Wirtschafts- und Gesell-schafts-System mit den genannten Symptomen ständig produziert. Ein System, das offensichtlich Menschen heranzüchtet, die nicht einmal in der Lage sind, sich ihrer eigenen Situation totaler Entfremdung bewusst zu werden, geschweige denn jemals den Versuch zu unternehmen, sich aus dieser Lage zu befreien. Umso mehr sehe ich mich in meiner Auffassung bestätigt, dass eine Erziehung vonnöten ist, die Werte vermittelt und Grenzen setzt.
Werte vermitteln und Grenzen setzen. Eine „wasserdichte“ Lern- und Erziehungstheorie kann ich an dieser Stelle natürlich nicht vorlegen. Und auch in Bezug auf die Werte-Vermittlung und das Grenzen-Setzen muss ich mich auf einige grundsätzliche Überlegungen beschränken. In welchen Grenzen Werte vermittelt werden können, habe ich bereits angedeutet. Zu beachten sind aber nicht nur die System-Einflüsse (Konsum- und Spaßgesellschaft usw.), sondern auch – und zwar vorrangig – diejenigen Grenzen und Faktoren, die aus den unterschiedlich gearteten personalen Strukturen und Besonderheiten der jeweils Betroffenen entstehen; Besonderheiten, die in solchem Maße divergieren, dass sie weder theoretisch noch praktisch überschaubar sind. Bei den „Zöglingen“ ist stets deren Alter zu beachten. Kleinkinder müssen soziale Werte wie Mitgefühl und Respekt erst erlernen, d.h. größtenteils durch Erziehung vermittelt bekommen.8
Wohingegen dies – wie auch jede andere Form von Erziehung – bei Pubertierenden anschei-nend gar nicht mehr möglich ist. – Innerhalb dieser Grenzen muss über die Erziehungsziele Klarheit bestehen. Antje Bostelmann gibt hierzu an: „Kinder sollen stark werden, zur Verantwortung fähig sein und mutige, selbst-aktive Mitglieder einer Gesellschaft werden, die in der Lage ist, jeden zu integrieren, zu respektieren und in seinen Grundrechten abzu-sichern.“9 – Schon dies sind freilich sehr ehrgeizige Ziele (zumal im Turbo-Kapitalismus, s.o.), übertreffbar durch den durchaus legitimen Anspruch, den Heranwachsenden Argumente an die Hand zu geben, die dazu dienen können, vorhandene Missstände zu beheben und eine bessere Zukunft vorzubereiten. Wozu sicherlich viel informierende und aufklärende Erzie-hungsarbeit zu leisten ist; wobei umstritten scheint, wie diese Arbeit vonstatten gehen soll: eher durch die Schaffung von Freiheitsräumen („gewähren lassen“) oder eher durch bewusste Grenzziehung? Entschieden werden kann hierüber nicht rein situativ und ad hoc, sondern stets wertorientiert, wobei die Rolle des Unterbewussten nicht zu unterschätzen ist. Wird dies missachtet, bleiben die Heranwachsenden ungeschützt den negativen Einflüssen der kapita-listischen Konsum- und Spaß-Ideologie ausgesetzt.
Welche Erziehungs-Werte anzustreben sind, haben Experten untersucht. Der Psychologe Wayne Dosick führt an: „Respekt, Wahrhaftigkeit, Fairness, Verantwortungsbewusstsein, Reife, die Fähigkeit, an etwas zu glauben“10, ergänzbar z.B. durch „richtiges Handeln, Liebe und Gewaltlosigkeit“.11 Wobei die Werte der „Fähigkeit, etwas zu glauben“ und des „richtigen Handelns“ leicht in gefährliches Terrain führen können. Fanatische, hass- und gewaltbereite Glaubens-Attitüden sind entschieden abzulehnen und zu bekämpfen, und zwar mit Aussicht auf Erfolg wohl erst dann, wenn – wie auch gegenüber den anderen Erziehungswerten – als oberster Grundsatz die Kantische Forderung nach unbedingtem Respekt vor der Menschenwürde (s.o.) beachtet und befolgt wird. Gleiches gilt für den Anspruch auf „richtiges Handeln“; auch hier kann der Zweck nicht die Mittel heiligen.
Es ist eine Forderung, die sich erfahrungsgemäß nicht durch bloßes Gewährenlassen erfüllen lässt. Wie aber sollen stattdessen Grenzen gezogen werden? A. Bostelmann schlägt den Erziehenden im Wesentlichen vor: 1. Rituale, d.h. geregelte Abläufe, 2. altersgemäßes Einfordern der Regeln, 3. Vorbild sein, 4. keine falschen Versprechungen machen, 5. auf Belohnungssysteme („Mohrrüben-Pädagogik“) möglichst verzichten, 6. Konsequenzen erklären und situationsgemäß umsetzen, ohne Angst einzuflößen (Urheberprinzip: „Wer etwas kaputt macht, muss dies reparieren oder ersetzen.“ A.a.O. S. 5), 7. Respekt und Gerechtigkeit im Umgang. Heranwachsende haben Anspruch auf Fairness und Gleichbehandlung. Frieden und Gewaltlosigkeit im Elternhaus und in der Schule hängen davon ab.
Ein besonders schwieriges Problem sehe ich darin, dass Erziehende und erst recht die ihnen anvertrauten Heranwachsenden teilweise auf Grund unbewusster Vorgaben und Prägungen handeln, ohne sich über das eigene Unbewusste wirklich im Klaren zu sein. Zumal ein Zugang zum Unbewussten oft erst im Traum, nach längerer Selbst-Beobachtung und -Reflexion oder durch hilfreiche Gespräche, z.B. mit Angehörigen, Psychotherapeuten, Seelsorgern oder anderen Vertrauens-Personen überhaupt möglich ist. Heranwachsende sind hierzu von sich aus kaum in der Lage. Ob überhaupt, sollte zumindest ansatzweise in vertraulichen Einzel- oder Gruppen-Gesprächen herauszufinden sein. Darüber hinaus gebe ich zu bedenken, dass Werte der Erziehung nicht isoliert, sondern in weiverzweigten, individuell unterschiedlichen Werte-Synthesen existieren; wozu ich Näheres und Weiteres in meiner 2020 erschienenen Arbeit Ethik der Verhaltenssteuerung – eine Neubegründung dargelegt habe, und zwar in dem Kapitel über ‚Werte-Synthesen, die das Verhalten steuern (können)‘, S. 212 ff., auch unter: https://www.grin.com/document/923015.[12 ]
IV. KI in Unterricht und lebenslanger Bildung – das Allheilmittel?
Microsoft-Copilot habe ich am 11.05.2025 die Frage gestellt: Was leistet KI im Unterricht? Hier die Antwort:
„Künstliche Intelligenz (KI) verändert den Unterricht und bereichert Lehr- und Lern-prozesse auf vielfältige Weise. Sie eröffnet moderne, datenbasierte Ansätze, die den Unterricht individueller, effizienter und interaktiver gestalten. Hier einige zentrale Aspekte:
Individualisiertes Lernen und adaptive Systeme
KI-gestützte Lernplattformen analysieren kontinuierlich das Lerntempo, Vorwissen und die Interessen der Schülerinnen und Schüler. Anhand dieser Daten wird ein maßgeschneiderter Lernpfad erstellt, der es den Lernenden ermöglicht, in ihrem individuellen Tempo voranzukommen. Dadurch können Schwächen frühzeitig erkannt und gezielt angegangen werden. Adaptive Systeme passen den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben dynamisch an und bieten so eine individuelle Förderung, die traditionell im Klassenverbund oft nur schwer zu realisieren ist.
Automatisierung von Routineaufgaben und Bewertungsprozessen
Ein großer Vorteil von KI im Bildungsbereich ist die Entlastung der Lehrkräfte von zeitaufwändigen Routineaufgaben. Automatisierte Systeme übernehmen das Korri-gieren von Tests, das Erfassen von Noten und das Erstellen von Berichten. Das entstehende Zeitbudget ermöglicht es den Lehrpersonen, sich verstärkt auf individuelle Förderung, kreative Unterrichtsplanung und persönliche Betreuung der Lernenden zu konzentrieren. Dabei bleibt zu betonen, dass die automatisierten Bewertungen als Unterstützung dienen und die pädagogische Einschätzung durch erfahrene Lehrkräfte nicht vollständig ersetzen können.
Interaktive Unterstützung und digitale Kommunikation
Moderne KI-Anwendungen integrieren Chatbots und virtuelle Assistenten, die rund um die Uhr als Lernpartner agieren können. Sie beantworten Fragen, geben Hilfe-stellungen zu komplexen Themen und unterstützen beim Verfassen von Texten oder bei der Suche nach weiterführenden Informationen. Diese interaktive Kommunikation trägt nicht nur zu einer Steigerung der digitalen Kompetenzen bei, sondern fördert auch die Motivation und das selbstständige Lernen der Schüler.
Analyse von Lernfortschritten
KI-Systeme können große Mengen an Lerndaten in Echtzeit auswerten. Dies ermög-licht es, Lernmuster, -fortschritte und etwaige Schwierigkeiten präzise zu identifi-zieren. Durch solche Analysen können Lehrkräfte proaktiv intervenieren – etwa wenn ein Thema wiederholt Probleme bereitet –, was zu einer nachhaltigeren und ziel-gerichteteren Unterstützung führt. Gleichzeitig liefern diese Daten wertvolle Einsichten, die zur Weiterentwicklung von Lehrmethoden und curricularen Inhalten genutzt werden können.
Ethik, Datenschutz und pädagogische Verantwortung
Trotz all der Potenziale birgt der Einsatz von KI im Unterricht auch Heraus-forderungen. Besonders im Hinblick auf Datenschutz, Datensicherheit und ethische Fragestellungen ist ein sorgfältiger, verantwortungsvoller Umgang unumgänglich. Schulen und Bildungseinrichtungen sollten daher klare Richtlinien und Rahmenbedingungen schaffen, um die Privatsphäre der Lernenden zu schützen und sicherzustellen, dass KI-Anwendungen transparent und nachvollziehbar sind.
Fazit
KI leistet im Unterricht einen wesentlichen Beitrag zur Modernisierung der Bildung:
Individualisierung und adaptive Lernprozesse schaffen passgenaue Bildungsangebote.
Automatisierte Bewertungs- und Verwaltungsprozesse entlasten Lehrkräfte.
Interaktive Unterstützung fördert digitales Lernen und die Selbstständigkeit der Schüler.
Datenbasierte Analysen ermöglichen gezielte Förderung und Unterrichtsoptimierung.
Diese Potenziale bieten enorme Chancen, den Bildungsprozess zu verbessern, erfordern jedoch einen bewussten, ethisch fundierten Umgang, um die bestmöglichen Lernergebnisse zu erzielen.“
In Ergänzung hierzu habe ich Microsoft-Copilot am 11.5.2025 die Frage gestellt: Was leistet KI in der lebenslangen Bildung? Die Antwort hierauf:
„KI revolutioniert die lebenslange Bildung, indem sie den Zugang zu Wissen und Kompetenzen grundlegend neu gestaltet – weit über starre Bildungsangebote hinaus. Sie ermöglicht individuelle, flexible und fortlaufende Lernprozesse, die sich exakt an die Bedürfnisse und Lebenssituationen der Lernenden anpassen.
Individuelle Lernpfade und adaptive Systeme
KI-gestützte Plattformen analysieren kontinuierlich das Lernverhalten, Wissen und die Präferenzen einzelner Lernender. Auf dieser Grundlage können sie personalisierte Lernpfade entwickeln, die sich dynamisch an Fortschritte oder Schwierigkeiten anpassen. Egal, ob es um berufliche Weiterbildung, Umschulung oder persönliche Interessen geht – durch adaptive Algorithmen wird sichergestellt, dass Lernende genau das erhalten, was sie in ihrer aktuellen Lebensphase benötigen.
Flexibilität und ständiger Zugang zu Bildung
Die digitale Transformation ermöglicht es, Bildung jederzeit und überall zugänglich zu machen. KI-basierte Tools und Apps unterstützen ein flexibles Lernen, bei dem zeitliche und örtliche Beschränkungen nahezu aufgehoben werden. Lernende können so in ihrem eigenen Tempo und gemäß ihrem individuellen Zeitplan lernen – sei es nebenberuflich oder in persönlichen Freiräumen.
Interaktive und immersive Lernumgebungen
Moderne Anwendungen setzen auf interaktive Formate, die Theorie und Praxis verknüpfen. Mit Hilfe von Chatbots, virtuellen Mentoren und Simulationen können Lernende komplexe Sachverhalte in realitätsnahen Szenarien erproben. Diese immersive Herangehensweise fördert nicht nur das Verständnis, sondern motiviert auch, da Feedback und Hilfestellungen rund um die Uhr verfügbar sind.
Effiziente Datenanalyse und Lernfortschritt
Die Auswertung großer Datenmengen ermöglicht es, individuelle Fortschritte genau zu analysieren und Muster im Lernverhalten zu erkennen. Lehrende und Weiterbildner profitieren von automatisierten Analysen, die gezielte Interventionen und eine kontinuierliche Optimierung der Lerninhalte erlauben. So wird der gesamte Bildungsprozess transparent und nachvollziehbar, was zu nachhaltig besseren Lernergebnissen führt.
Fortlaufende berufliche Weiterbildung und Anpassung an den Arbeitsmarkt
In einer schnelllebigen Arbeitswelt ist es essenziell, dass Fachkräfte regelmäßig ihre Kompetenzen aktualisieren können. KI identifiziert Trends und zukünftige Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt und unterstützt so die Entwicklung maß-geschneiderter Weiterbildungsangebote. Dies sichert nicht nur die berufliche Wett-bewerbsfähigkeit, sondern fördert auch lebenslanges Lernen als integralen Bestandteil moderner Karrierepfade.
Inklusion und Barrierefreiheit
Ein weiterer Vorteil liegt in der verbesserten Zugänglichkeit von Bildungsinhalten. KI-basierte Tools, wie Spracherkennungs- und Übersetzungsprogramme, senken Barrieren für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Durch diese Techno-logien werden auch bisher unterversorgte Gruppen in die Lage versetzt, sich unkompliziert weiterzubilden.
Ethik und Datenschutz in der lebenslangen Bildung
Neben den zahlreichen Chancen müssen auch ethische Fragen und der Schutz personenbezogener Daten kritisch betrachtet werden. Es ist wichtig, klare Rahmenbedingungen zu schaffen, die den verantwortungsvollen Umgang mit den gesammelten Daten sicherstellen. So bleibt der Bildungsfortschritt stets im Einklang mit den individuellen Rechten der Lernenden.
Zusammengefasst eröffnet KI in der lebenslangen Bildung immense Möglichkeiten: Sie sorgt für ein maßgeschneidertes, flexibles und interaktives Lernen, das den ständig wandelnden Anforderungen der modernen Gesellschaft gerecht wird. Gleichzeitig legt sie den Grundstein für eine inklusivere Bildungslandschaft, in der kontinuierliche Lernprozesse zur Normalität werden.“
Im Gegenzug hierzu verweisen Experten auf bestimmte Risiken, die mit dem Einsatz von KI in Unterricht, Lernen und Bildung verbunden sind. So z.B. in der folgenden Expertise:
„Trotz der zahlreichen Potenziale von KI im Unterricht gibt es auch erhebliche Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
Täuschung und Betrug
Wie kann sichergestellt werden, dass Schüler:innen ihre Hausarbeiten wirklich selbst geschrieben haben? KI kann Texte auf hohem Niveau generieren, sodass es für Lehrkräfte schwer wird, echte Eigenleistung zu erkennen.
Fehlinformationen und fehlende Quellenangaben
KI-Modelle basieren auf riesigen Datenmengen, die sie nicht immer auf Korrektheit überprüfen lassen. Falschinformationen oder fehlerhafte Zusammenhänge können von Schüler:innen übernommen werden, wenn sie Inhalte nicht kritisch hinterfragen.
Verlust eigenständiger Denkleistung
Wenn KI immer die “richtige” Antwort liefert, besteht die Gefahr, dass Schüler:innen grundlegende Recherche- und Analysefähigkeiten verlernen. Der Einsatz von KI darf daher nicht dazu führen, dass die Entwicklung kritischen Denkens vernachlässigt wird.
Datenschutzprobleme
Viele KI-gestützte Tools speichern Daten auf Servern außerhalb der EU, wodurch Datenschutzprobleme entstehen. Schulen müssen sicherstellen, dass der Einsatz von KI nicht die Privatsphäre von Schüler:innen gefährdet.
Soziale Ungleichheit
Nicht alle Schüler:innen haben zu Hause die gleiche technische Ausstattung oder den gleichen Zugang zu digitalen Lernmitteln. KI im Unterricht könnte daher bestehende Bildungsungleichheiten verstärken, wenn nicht sichergestellt wird, dass alle Lernen-den gleichermaßen von den Vorteilen profitieren.
Besonders im Prüfungsbereich stellt sich die Frage, wie echte Leistungen noch fair bewertet werden können. Wenn Hausarbeiten mit KI erstellt werden, verlieren sie an Aussagekraft. Dies stellt Schulen vor die Herausforderung, neue Prüfungsformate zu entwickeln.
Verbote sind keine Lösung – aber Regeln sind nötig
Ein generelles Verbot von KI im Unterricht wäre kaum umsetzbar. Die Technologie ist längst Teil des Alltags vieler Schüler:innen. Ein Verbot würde zudem dazu führen, dass Schüler:innen KI außerhalb der Schule unkontrolliert nutzen, ohne zu lernen, wie sie sinnvoll damit umgehen können.
Stattdessen braucht es klare Regeln und Richtlinien, um den Umgang mit KI bewusst zu steuern:
Transparenz über die Nutzung:?
Schüler:innen sollten offenlegen, ob sie KI bei ihren Aufgaben genutzt haben und in welchem Umfang.
Kritische Reflexion der KI-generierten Inhalte:?
Lehrkräfte sollten Schüler:innen dazu anleiten, KI-Texte auf Plausibilität zu prüfen und mit vertrauenswürdigen Quellen abzugleichen.
Prüfungsformate anpassen:?
Bewertet werden sollte nicht nur das Endprodukt, sondern auch der Denkprozess dahinter. Reflexionsaufgaben oder mündliche Prüfungen könnten klassische Klausuren ergänzen.
Fortbildung der Lehrkräfte:?
Lehrer:innen müssen sich mit den Möglichkeiten und Grenzen von KI im Unterricht auseinandersetzen, um Schüler:innen kompetent begleiten zu können.
Diese Maßnahmen könnten dazu beitragen, dass KI im Unterricht nicht zu einem Problem wird, sondern zu einer sinnvollen Ergänzung.“[13 ]
Nicht weniger differenziert äußert sich Prof. Dr. Ute Schmid. Ihr wurde die Frage gestellt:
„Wie können die KI-Anwendungen Schüler*innen und Lehrkräfte im Schulalltag unterstützen?“
Schmid:
„Intelligente Dashboards können Lehrkräfte beim Unterrichtsmanagement unter-stützen. Die dort zur Verfügung gestellten Daten können zum Beispiel für sogenannte predictive analytics genutzt werden. Diese Anwendungen sind meiner Meinung nach aber mit Vorsicht zu betrachten. Hier werden aus möglichst vielen Daten von Schüle-rinnen und Schülern mit maschinellem Lernen Modelle gelernt, die schulischen Erfolg in einzelnen Fächern vorhersagen sollen. Erhoben werden können Abgabezeiten sowie Korrekturen für Hausaufgaben, Beteiligung an Diskussionsforen, Verweildauern auf digitalen Texten sowie bei entsprechender technischer Ausstattung auch Blick-bewegungen und im Extremfall sogar Videoaufnahmen. Probleme, die ich hierbei sehe, sind:
1. Es besteht die Gefahr der Verletzung von Privatsphäre und Datenschutz, insbesondere bei Videoaufnahmen, was aber wohl zumindest in Deutschland ohnehin nicht erlaubt wird.
2. Es besteht die Gefahr, dass das Primat der Didaktik zugunsten einer unreflektierten Bevorzugung digitaler Medien aufgegeben wird, da Training und Anwendung von Modellen darauf angewiesen sind, dass möglichst viel Information über die Lernenden digital vorliegt.
3. Mit maschinellem Lernen aus Daten trainierte Modelle sind nicht für Vorhersagen auf individueller Ebene vorgesehen und können entsprechend falsche Vorhersagen machen. So ist es etwa möglich, in einem Krankenhaus vorherzusagen, ob auf einer Station erhöhte Gefahr für einen Krankenhauskeim besteht. Die Vorhersage, ob ein bestimmter Patient infiziert wird, ist dagegen nicht zuverlässig möglich.
4. Selbst wenn es möglich wäre, mit hoher Genauigkeit vorherzusagen, welche Note ein bestimmter Schüler oder eine bestimmte Schülerin in einem Fach erhalten wird, wäre das problematisch, da Lehrkräfte sich wohl kaum von daraus entstehenden Einschätzungen freimachen könnten und Schülerinnen und Schüler damit einen Stempel aufgedrückt bekämen, der ihre Leistungen beeinflusst, denn wer schlecht eingeschätzt wird, wird auch keine gute Performanz zeigen.
Für Schülerinnen und Schüler werden bereits einfache Lernapps angeboten, die zum Beispiel mit Gamification arbeiten. Häufig steckt in diesen Angeboten wenig KI-Technologie. Eingegebene Lösungen werden schlicht mit einer Datenbank abgeglichen und als richtig oder falsch bewertet. Hier sehe ich die Gefahr eines Rückfalls in den Behaviorismus, also ein rein auf Optimierung des Outputs hin optimiertes Lernen.
Ein Intelligentes Tutorsystem kann bei Fehlern meist zielgenau diagnostizieren, welches Fehlverständnis die Ursache ist.
Deutlich sinnvoller sind sogenannte Intelligente Tutorsysteme (ITS), die als Ergänzung zum Unterricht im Klassenverband individualisiertes Lernen ermöglichen. Ich illustriere das an einem Beispiel: Wenn Kinder in der dritten Klasse den Algorithmus für das schriftliche Subtrahieren lernen, haben einige Kinder Verständnisprobleme, zum Beispiel wie das Entbündeln funktioniert. Eine einfache App oder auch eine überlastete Lehrkraft würde zahleiche Rechenaufgaben stellen und bei fehlerhaften Lösungen schlicht mit „falsch“ oder vielleicht zusätzlich der richtigen Lösung reagieren. Egal, wie viele Aufgaben man gibt, einem Kind mit einem Verständnisproblem wird das nicht helfen. Ein ITS verfügt dagegen über Wissen über den Problembereich und kann bei Fehlern meist zielgenau diagnostizieren, welches Fehlverständnis die Ursache für einen bestimmten Fehler ist. Darauf basierend kann gezielt Feedback gegeben werden. Wir haben ein solches ITS in unserem Team entwickelt. Basierend auf der diagnostizierten Fehlerursache wird ein analoges Beispiel gegeben: „Deine Lösung ist noch nicht ganz richtig, ich zeige Dir an einem ähnlichen Beispiel, wie ich das rechne.“ Dadurch hat das Kind die Möglichkeit, sein Fehlkonzept aufzulösen, es lernt direkt im Problemlösekontext und erlebt Selbstwirksamkeit statt Frustration.
EDL: Welche Risiken bestehen beim Einsatz von KI im Schulalltag?
Schmid: Meine beiden größten Sorgen sind, dass der Zwang zum Datensammeln, um maschinelles Lernen nutzen zu können, wie erwähnt dazu führt, dass nicht mehr die Frage nach dem geeigneten didaktischen Instrument zur Vermittlung eines speziellen Inhalts im Zentrum steht, sondern standardmäßig immer digitale Medien genutzt werden. Häufig werden hier einfache Multiple Choice-Aufgaben zur Wissensdiagnose genutzt. Da die Art, wie ein Inhalt gelernt wird, immer auch davon beeinflusst wird, wie das Wissen abgeprüft wird, besteht das Risiko, dass – noch mehr – bloßes Auswendiglernen im Zentrum steht statt Verständnis und Problemlösekompetenz. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass solche einfachen Aufgaben zur Kontrolle keine KI-Technologie nutzen – hier genügt eine einfache Datenbank.
Wichtig wäre, dass Vermittlung und Prüfung nicht ein bloßes Auswendiglernen abfragen.
EDL: Was müsste im Lehr-Lern-Prozess verändert werden, damit KI sinnvoll eingesetzt werden kann?
Schmid: Meiner Meinung nach ist eine der besten Auswirkungen der Einführung von ChatGPT, dass wir erstmals seit Langem einen breiten öffentlichen Diskurs über das Thema Bildung führen. Bereits seit es Suchmaschinen, Wikipedia, Erklärfilme und andere digitale Angebote gibt, wäre es Zeit gewesen, sich Gedanken zu machen, wie wir diese digitalen Technologien sinnvoll einsetzen können, um Kompetenzen zu erweitern und zu fördern. Natürlich geht es in kaum einem Fach ganz ohne Auswendiglernen: Ohne Vokabeln zu können, kann ich keine Sätze formulieren, ohne das Einmaleins kann ich nicht rechnen und ohne Fakten fehlt mir jede Orientierung – sei es in Geschichte oder in Geografie. Wichtig wäre, dass Vermittlung und Prüfung nicht ein bloßes Auswendiglernen abfragen, sondern den Fokus vor allem auf Zusammenhänge legen. Ich erlebe immer wieder, dass sonst kurzfristig etwas gewusst wird und danach nicht mal mehr, auf welchem Kontinent ein Land liegt, oder geschichtliche Ereignisse nicht auf der Zeitachse eingeordnet werden können.
In allen Fächern gilt: Wir brauchen die Kompetenz, um die Ausgaben von Systemen beurteilen zu können – ob die Rechtschreibkontrolle, ein Computerprogramm, ein Rechenergebnis, die Faktentreue eines Textes oder auch die argumentative Struktur, die Wortwahl oder die grammatische Formulierung korrekt beziehungsweise sinnvoll ist. Das heißt, diese Fertigkeiten müssen weiter vermittelt werden und dazu kommt eine stärkere Betonung von Beurteilung vorliegender Information als Ergänzung zur Fähigkeit, diese selbst zu produzieren.
Da die Art, wie geprüft wird, stark beeinflusst, wie gelernt wird, sollten hier einfache Wissensabfragen mit Lückentexten oder Multiple Choice-Aufgaben, wenn möglich, durch generative Formate ergänzt oder ersetzt werden. Dazu zählen Aufgaben, die Freitextantworten verlangen und die die Schülerinnen und Schüler veranlassen, Zusammenhänge herzustellen, wie beispielsweise Textaufgaben im Bereich Mathematik. Dadurch wird die Beurteilung aber aufwendiger und angreifbarer. Neben mehr Personal werden daher auch Strategien benötigt, die Lehrkräften helfen, dass ihre begründeten Notengebungen akzeptiert werden – bei Multiple Choice ist das einfach, bei komplexeren Aufgaben schwieriger.
Digitale Werkzeuge inklusive KI-Werkzeuge sollten als Erweiterung der didaktischen Möglichkeiten – zum Beispiel Arbeitsblatt plus Intelligentes TutorSystem, Unterrichtsgespräch plus Erklärfilm – und als neue Tools, die Kompetenzen erweitern und fördern – zum Beispiel ChatGPT als Ideengeber, automatische Datenanalyse beziehungsweise maschinelles Lernen als weiterer Zugang in der Mathematik –, verstanden und genutzt werden.“[14 ]
Eher pessimistisch, wenn auch nicht weniger differenziert, wirkt dagegen die Stellungnahme von Sven Edmund Lennartz:
„Noch mehr Macht für Internetgiganten
Vom Start weg haben sich die Branchenriesen mit großem Geld bei den aufstrebenden KI-Firmen eingekauft und bestimmen nun mit. Microsoft bei OpenAI, Amazon bei Anthropic. Oder sie bringen gleich ihre eigene KI heraus, wie Facebook/Meta oder Google. So beherrschen sie den Markt, bevor der sich überhaupt entfaltet hat.
Wir machen uns abhängig
Und zwar voll und ganz. Wir werden uns nicht einmal wehren, es wird einfach geschehen. Man gewöhnt sich halt dran. Die Abhängigkeit kommt schleichend. Ich fürchte, ein Teil von uns wird sogar das Denken einstellen. Ich rede vom bewussten, reflektierenden und steuernden Denken; Ziele, Zukunftsplanung, solche Dinge. Den Weg zum Kühlschrank findet man auch mit dem Stammhirn. Der Verein der anonymen KI-Nutzer wird uns nicht retten können. Wir sind am Arsch, so oder so.
Betrüger werden KI im großen Stil nutzen
Einige tun es schon jetzt, das wird sich noch steigern, und die Tricks werden immer besser – KI optimiert und exekutiert. Es wird schwer, sich dagegen zu wehren. KI kann alles hochoptimieren, Texte fälschen, sodass sie von niemandem vom Original unterschieden werden können. Auch per Sprache, und bald Video. Organisierte Ban-den werden sich eigene Kunstintelligenzen bauen lassen, die weder Zurückhaltung noch Zensurfilter kennen. Im Gegenteil, sie werden wie Diebe, Lügner und Betrüger denken und die besten sinistren Ansätze und Lösungen finden. Schurkizität 100%! Aber hey, böse KI, warum nicht? In den richtigen Händen wird man viel Geld damit scheffeln können.
Überall Zensur, Filter und Falschinformationen
Computer, Netz und KI sind nicht so neutral, wie man vielleicht denken könnte. Überall wird reguliert, gefiltert, gesäubert, beobachtet und gedreht. Na gut, das hatten wir schon vor der KI, du erinnerst dich an die Tagesschau? Aber mit KI wird das alles noch mal eine Dimension krasser. Sie repliziert nicht nur die Fehler der anderen, sondern macht auch noch selbst welche. Was wird dann zukünftig noch stimmen? Ich weiß nicht, wem man überhaupt noch wird glauben können. Da hilft dann auch keine KI mehr. Möglicherweise folgt auf das Wissen eine neue Periode des Glaubens. Die Gewissheit wäre zurück. Und wir bei der armageddiösen Klimakatastrophe, die liefert das Beispiel.
Nicht nur das WWW vermüllt
Eine Welt, in der es möglich ist, quasi auf Zuruf komplette Bücher zu erzeugen, wird in Büchern ertrinken. Deren Inhalte werden immer ähnlicher und immer flacher, zwangsläufig, auch wenn das am Anfang nicht so scheinen mag. Es wird dann nicht Millionen, sondern Milliarden geben, die meisten werden nie gelesen. Auch das WWW wird zugemüllt, das kann keiner verhindern. Bald wird man komplette Websites, nicht nur einzelne Seiten oder Artikel, per Mausklick erzeugen können. Man wird Content nachmachen, immer wieder und wieder, weil es so einfach ist. Das alles wird niemand mehr indizieren und durchsuchen können, und niemand wird je darin surfen wollen.
Die Jugend verblödet weiter – wieder einmal
Schrankenloser Konsum und Wohlstand haben uns in die Dekadenz geführt. Das Handy war der dickste Sargnagel. Es zertrümmert die Jugend regelrecht. Wie soll man da nicht wahnsinnig werden? KI wird das nicht retten, sondern jungen Leuten mehr ermöglichen. Einige werden dadurch schlauer, die meisten aber leider eher nicht. Sie gehen den bequemen Weg, lassen die KI die Arbeit machen, um Party zu feiern. Warum auch nicht, solange es noch geht… Eine Zukunft allerdings baut man sich so nicht. Verübeln kann ich es ihnen nicht. Erwachsene waren es, die ihnen die Technik in die Hände gaben und sie damit allein ließen. Die gleichen Erwachsenen, die sich jetzt über TikTok beschweren.
Kreativität wird beliebig und damit entwertet
Wenn Maschinen alles vermögen und im Nu jedes erdenkliche Medium hervorzaubern können, warum sollte sich der Mensch dann noch damit befassen? Die Kunst, millionenfach reproduzierbar, jederzeit und überall zugänglich, würde schlichtweg ihren Wert verlieren. Wie Sand am Meer. Es hätte keine Bedeutung mehr, der Flut noch ein paar Körnchen hinzuzufügen. Einst erwarb man sich selten ein Album, und wenn doch, dann war es eine Kostbarkeit, die man mit Sorgfalt behandelte und beinahe feierlich dem Plattenspieler überantwortete. Doch was bedeutet heute ein Album oder ein Lied in Zeiten von Spotify? Selbst wenn es einem gefällt, es geht rasch verloren im Strom und durch etwas neues, noch cooleres ersetzt. Bald wird KI diesem Universum Milliarden Sterne hinzufügen. Wir werden wahrscheinlich weiterhin Musik hören, aber wozu sie noch selbst erschaffen? Das wäre nur öde, ohne Wert. Geld verdienen wird man damit auch nicht mehr können.
Geisteswissenschaften haben keine Zukunft
Philosophie, Geschichte, Literaturwissenschaft, Linguistik, Soziologie, Anthropologie, Kunstgeschichte, Theologie … kann nicht jeder, muss man studieren. Aber nicht mehr lange, denn was Geisteswissenschaftler erzeugen, kann die KI schon heute besser. So gut, dass auffällt, wie wenig die Geisteswissenschaftler tatsächlich beizutragen haben. Auf sie zu verzichten, wird Ressourcen sparen. Apropos Theologie … KIs werden auch die besseren Geistlichen. Predigten auf den Punkt, immer ein offenes Ohr, zu jeder Zeit, nie nachtragend, nie von Gefühlen und Zweifeln geplagt – und sie werden auch die Kinder in Ruhe lassen.
Die Jobs sind weg und kommen nicht wieder
Nicht alle, aber fast. Mancher findet das ja sogar gut. Endlich Ferien für alle und für immer. Was erstmal gut klingt, wird uns mittelfristig noch träger, noch fetter, noch unleidlicher machen. Natürlich, zuerst übernimmt die KI langweilige Routinearbeiten, so beruhigt man uns. Aber das ist nur der Einstieg, der Türöffner, so fixt man jemanden an. Wer etwas anderes glaubt, denkt naiv. Nach dem Routinekram kommen anspruchsvollere Arbeiten dran, und so wird es weitergehen. Dem Menschen bleiben hie und da Funktionen als Supervisor und KI-Betreuer, bis, ja bis auch das substituiert wird. Am Ende sind alle Jobs weg. Denkbar, dass KIs dann auch unsere Kriege führen und uns regieren werden.“[15 ]
Diese eher pessimistischen Einschätzungen teile ich jedoch nicht. Mein Fazit lautet:
Erschwert wird die weltweite Kontrolle der KI durch das Fehlen eines allgemeinen, inter-nationalen KI-Rechts. Umso mehr empfiehlt es sich, aus dem Vorliegenden die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Natürlich gibt es weltweit neben den Gesetzes-Vorlagen der EU, der USA und Chinas weitere, ähnliche Projekte. Wahrscheinlich aber nicht mit höherer inhaltlicher Relevanz. An den drei Gesetzesvorlagen fällt auf, dass sie die Probleme der schwachen KI nur ansatzweise, die der starken kaum oder gar nicht behandeln. Weder der US-amerikanische Nietzsche-Kult und -Hype noch R. Kurzweils „Singularitäts“-Phantastereien noch die monströse „Symbiose“ von Mensch und Technik werden analysiert. Die Gefahr einer Selbstauslöschung der Menschheit durch KI wird ignoriert.
Gravierend kommt hinzu, dass bisher anscheinend in keinem einzigen Gesetzes-Vorhaben die Tatsache erwähnt wird, dass die KI-„Singularität“ das Ende aller Bemühungen um sinnvolle Alternativen zum Bestehenden, d.h. zum globalisierten Neo-Liberalismus, bedeuten würde. An die Stelle eines Reichs der Freiheit würde eine hochexplosive, nicht funktionstüchtige „Symbiose“ von Menschen und Robotern treten.
Um die negativen Auswirkungen der schwachen und starken (generativen) KI wirksam zu bekämpfen, werden nationale Gesetze nicht ausreichen. Vielmehr bedarf es verbindlicher, internationaler Vereinbarungen, z.B. auf UN-Ebene. Dies hat auch Antonio Guterres, der UNO-Generalsekretär, bereits erkannt. Angesichts der existenziellen Bedrohung der Mensch-heit durch KI kritisierte er die Macht von Großunternehmen und -Staaten, von denen die Menschenrechte missachtet werden. In einem Positionspapier der UNO stellte er Vorschläge zum weltweiten Umgang mit KI vor und kündigte die Einrichtung entsprechender hoch-rangiger Beratergremien und die Gründung einer UN - Regulierungsbehörde an.[16 ]
Kaum einen Monat später nahm der UNO-Menschenrechtsrat in Genf eine Resolution an, in der Schutz- und Kontrollmaßnahmen zur KI beschlossen wurden. Die Transparenz entspre-chender Systeme soll gefördert werden, speziell zur Verwendung der für die KI-Technologie benutzten Daten, die „auf menschenrechtskonforme Weise gesammelt, verwendet, weiter-gegeben, archiviert und gelöscht werden“ sollen. Die Resolution wurde im Juli 2023 ein-vernehmlich angenommen.[17 ]
V. Lebenslange Bildung
Anthropologie und Ethik
Ethik ist nicht Theorie der Gesellschaft, sondern der Moral. Diese aber ist stets gesell-schaftlich bedingt und daher stets nur von relativer, nicht absoluter Gültigkeit und Dauer. Woraus folgt, dass auch jede Ethik gesellschaftlich bedingt und daher nicht als absolut gültige konzipierbar ist, eine Tatsache, die Kant anscheinend unterschätzt hat. Folgt daraus etwa auch, dass es zwar Werte, aber keine Normen geben kann? Nicht, solange Gesetze – und nicht nur „Faktisches“ – normative Kraft haben. Aus Werten können, wie ich meine, auf jeden Fall dann Normen werden, wenn sie in Gesetzesform gebracht bzw. im individuellen Über-Ich verinnerlicht werden.
Daran hat sich seit Kant nichts geändert. Normen müssen deshalb jedoch nicht als „absolut gültige“ begründet werden; es genügt, dass sie rechtskräftig und gegebenenfalls auch naturrechtlich korrigierbar sind. Dies aber verweist auf elementare geschichtsphilosophische, anthropologische und politische Dimensionen der Ethik Wenn nicht nur im Naturrecht, sondern auch in der Alltagspraxis Solidarität herrschte und jede/r seinen/ihren Bedürfnissen entsprechend leben könnte, wäre dies Sozialismus, den es jedoch „in Reinkultur“ bisher nirgendwo gab. Wenn Ernst Bloch dementsprechend eine Veränderungsethik fordert, anerkennt er die gesellschaftliche Bedingtheit von Ethik und kann folglich nicht mehr, wie in seinem frühen Geist der Utopie (1923), die Ethik hoch über alles, über die „ganze Weltenzyklopädie“ stellen. Wie erklärt sich dieser Wandel? Wohl aus der Tatsache, dass Bloch nicht umhin konnte, seine frühe Gottgläubigkeit zu Gunsten des Atheismus (auch im Christentum!) aufzugeben, und zwar in Folge der notwendigen Neubewertung dessen, was als das Höchste Gut anzusehen sei: nicht mehr Gott, sondern das Reich der Freiheit. Das es in „wachsendem Menscheinsatz“ (auch „ins religiöse Geheimnis“) zu erkämpfen gilt.[18 ]
Ethik kann sich nicht auf das Unbedingte und Absolute, wohl aber auf Geschichtsphilosophie und Anthropologie stützen. Dazu passt die Tatsache, dass Ethik zwar eine Wissenschaft, aber keine mathematisch-exakte ist. Ethik hat die Unwägbarkeiten und Zufälligkeiten der Geschichte und des Menschseins mit einzukalkulieren. Und: „Die Wirkungsbereiche und -möglichkeiten der Individuen und der Gesellschaften sind nicht überschaubar und reichen zuweilen nur so weit wie deren Urteilskraft. Es sind Wirkungsbereiche, die von keiner Ethik in allen Details bestimmt werden können.“ (s.o.). Schematisch lassen sich die Zusammen-hänge von Ethik, Geschichtsphilosophie und Anthropologie wie folgt darstellen:
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Dass Verhalten sich nicht nur auf Handlungen, sondern auch auf die Materie im Ganzen bezieht, mag verwundern, kann aber kaum bezweifelt werden. Schon Elementarteilchen verhalten sich in teils bestimmter, teils unbestimmbarer Weise. Solange dies der Fall ist, bleibt Raum für philosophische Spekulation und Hypothesen-Bildung. Auch wenn Ernst Bloch Kants Höchstes Gut durch das Reich der Freiheit ersetzt hat, bedeutet dies nicht, dass ein Höchstes Gut (= Gott bzw. Blochs „Natursubjekt“) ein für allemal als Postulat erledigt wäre. Gibt es ein Höchstes Gut als Urheber des Ganzen, beginnt die Entstehung von Werten tatsächlich schon in der anorganischen Materie, was als ein In-Möglichkeit-Sein (= Entelechie) zu beachten ist. Ohne dabei zu verkennen, dass die Natur nicht nur „unvollendet“, sondern auch unvollkommen ist. Naturkatastrophen, Seuchen, Tod, Krankheit und Gebrechen, Fehlbildungen, das anscheinend sinnlos Zerstörerische im Menschen und in der Natur – all dies erschüttert immer wieder den Glauben und das Vertrauen auf Sinn- und Zweckhaftigkeit des Ganzen.
Dennoch ist anzunehmen, dass an dessen Ursprung nicht ein „Handeln“, sondern ein Geschehen steht, aus dem sich vorwärtstreibende, entelechetische Faktoren entwickelt haben. Insofern enthalten Geschichtsphilosophie und Anthropologie nicht nur Referenz-Theorien der Ethik, sondern gehören auch zu deren Begründungs-Instanzen.
Zur Relevanz von Geschichtsphilosophie und Anthropologie für eine Ethik der Verhaltenssteuerung
Die Menschen wollen wissen, woher sie kommen und wohin sie gehen. Also muss Geschichtsphilosophie kosmologisch beginnen, d.h. bei Fakten und Vermutungen über Anfang und Ende, Vergangenheit und Zukunft des Ganzen, obwohl das Ganze nicht überschaubar ist.
Der Ekpyrotische Kosmos (Paul Steinhardt 2002). In diesem Kosmos gibt es keinen Urknall, so dass sich die Kritiker der Urknall-Theorie in frappierender Weise bestätigt sehen können. Wie der US-amerikanische Physiker Paul Steinhardt (Princeton-Universität) festgestellt hat, leidet das bisherige Modell eines zyklischen Universums an entscheidenden Konstruktions-fehlern, so bei der Behauptung, der sogenannte ‚big crunch‘ stelle „ein genaues Spiegelbild zum Urknall“ dar, was nicht zutreffe.[19 ] Singularitäten wie der „Urknall“ seien ohnehin „der Giftmüll des Kosmos“.
Dagegen stellt Steinhardt sein Modell eines pulsierenden, ekpyrotischen Universums. Das altgriechische ‚ekpyrosis‘ bedeutet eigentlich „Weltenbrand“, woraus in der Stoischen Philosophie ein Begriff wird, nach dem „die Welt zyklisch in Brand gesetzt und neu geboren wird“.[20 ] Laut Steinhardt hat kein Big Bang aus dem Nichts, sondern die Kollision von „Branen“ zur Entstehung des uns bekannten Universums geführt: „Das Ekpyrotische Modell entspricht einem zyklischen Universum, das sich immer dann, wenn Branen-Kollisionen stattfinden, ausdehnt, wieder zusammenzieht und nach erneuter Kollision wieder expandiert.“ (ebd.)
Wonach also die Welt-Materie nicht aus dem Nichts oder aus purer Information, sondern aus bereits existierender, immer schon vorhandener Materie (inclusive Information, Energie und Strahlung) entstanden ist. – Und diese dynamische, in Bewegung befindliche Materie ist eben keine Klotz-Materie, sondern ein materielles Raum-Zeit-Geschehen in einem Meer unendlicher Möglichkeiten, ein Experimentierfeld des In-Möglichkeiten-Seins, aus dem schließlich auch der Mensch hervorgegangen ist. Evolutionsgeschichtlich wird die Materie Energie- und Informationsträgerin, d.h. Trägerin von Mustern und Bedeutungen in der Evolutionskette: Ursprung (?) – Nicht – Noch-Nicht – Anorganisches – Organisches – Seelisches – Geistiges. Die ursprüngliche kosmische Materie – und mit ihr die ursprüngliche Weltzeit – geht ein in die Welt-Materie und damit später auch in die Person des Menschen.
Information ist nicht alles, aber sie darf nicht unterschätzt werden, denn sie ist keineswegs ein bloßes Gedankending, sondern von Anfang an in der Natur, als ursprüngliche Welt-Information, vorhanden. Laut Rainer E. Zimmermann werden im Universum andauernd Informationen produziert. Im Jahre 2011 postulierte Zimmermann einen „Urstoff“, der allerdings nur gedacht, nicht beobachtet werden könne. Immerhin könne, wenn auch nur mathematisch-abstrakt, ein „Spin-Netzwerk“ dargestellt werden, das „auf der fundamentalen Ebene des Universums“ wie ein ständig Informationen erzeugender „Quanten-Computer“ wirke, „der zugleich hardware und software ist“. Dieses Spin-Netzwerk liege allem zu Grunde, was beobachtet werden kann. Es sei ein neuer Ausdruck für die Schöpferkraft der Natur (‚natura naturans‘) und zugleich eine Erweiterung der diesbezüglichen Erkenntnisse von Aristoteles, Spinoza, Schelling und Ernst Bloch – und speziell auch von Blochs hypothetischem „Natursubjekt“.[21 ]
Ähnlich argumentiert der Theoretiker Erich Bieramperl in seiner Autoadaptions-Theorie.[22 ] Auf subatomarer Ebene erkennt Bieramperl Vorgänge, die an die Arbeitsweise von Sensoren denken lassen. Elementarteilchen gewinnen Informationen über ihre Umgebung, d.h. über andere E-Teilchen, mit denen sie Kontakt aufzunehmen vermögen. Wie ein Radar tastet das E-Teilchen seine Umgebung darauf hin ab. Information, Kontakte und Verbindungen von E-Teilchen sind keineswegs neue Phänomene. Bieramperl fand aber eine neue Erklärung dafür – mit weitreichenden Konsequenzen: Die Natur organisiert sich anscheinend selbst, aber aus einem ursprünglichen „Selbst“ heraus, das bereits Subjektives in sich zu tragen scheint. Fragt man jedoch nach der Zielursache des Ganzen, wird man nicht umhin können, die informationshaltige Materie selbst, d.h. nicht unbedingt Ernst Blochs hypothetisches „Natursubjekt“ , wohl aber sein Konzept einer „unvollendeten Entelechie der Materie“, als Grundlage anzunehmen.
Zeit. In ihr spielt sich alles ab. Dennoch wird darüber gestritten, wie sie zu begreifen sei. Ein Hauptproblem sehe ich darin, die subjektiven und die objektiven Aspekte der Zeit miteinander in Einklang zu bringen, ohne Einsteins physikalische Theorie der Raumzeit in Frage zu stellen. Dazu habe ich eine Hypothese zur ursprünglichen Weltzeit vorgeschlagen, und zwar an Hand der folgenden Feststellung von Heidegger: „Die ekstatische Einheit der Zeitlichkeit, das heißt die Einheit des >Außer-sich< in den Entrückungen von Zukunft, Gewesenheit und Gegenwart, ist die Bedingung der Möglichkeit dafür, daß ein Seiendes sein kann, das als sein >Da< existiert.“ (Sein und Zeit S. 350). – Der Begriff „Bedingung der Möglichkeit“ erscheint hier zunächst rein subjektiv-intelligibel, als pure Verstandeskategorie. Aber: Sein Referenz-Objekt, das seiende Sein, das „Da“, ist nicht nur im Verstand vorhanden; es ist vielmehr zugleich die objektive Grundlage jeglicher Verstandestätigkeit. Die Zeitlichkeit dieses Seins kann daher zunächst auch nur objektiv sein, in der „Ekstase“, im „Außer-sich“ der zeitlichen „Entrückungen“. Als 4. Dimension kontrastiert das Zeitliche mit allem Räumlichen – auch dies ein Grund, warum man die Zeit aus sich selbst heraus verstehen sollte.
Dessen ungeachtet wohnt das Zeitliche auch in uns selbst (vermutlich bis wir’s „gesegnet“ haben), z.B. als „psychologischer Zeitpfeil“. Das objektive „Da“ der Weltzeit manifestiert sich in uns als Dauer, erlebte Zeit, also subjektiv . Und genau darin besteht die gesuchte Vermittlung zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven der Zeit!
Im Übrigen bedeutet auch diese Vermittlung keine Fixierung der Zeit. Das Wesen ist nicht nur Hegels „Ge-wesenheit“ der Vergangenheit, sondern auch das Noch-Nicht der Zukunft, die noch nicht erschienene Zukunft. Und die Zukunft wird wohl immer klarer erweisen, was es mit der Zeit auf sich hat. Die Zeit ist kein Ding, keine bloße „Erscheinung“, wohl aber – vorläufig und hypothetisch – eine Grundbefindlichkeit des Seins, ursprüngliche Weltzeit als anscheinend unveränderliche Reihe von Momenten bzw. Augenblicken.
Diese Zeit ist, z.B. als Internationale Weltzeit in den verschiedenen Zeit-Zonen, zwar messbar, aber inhaltlich, d.h. in ihren „verschwindend“ kleinen Einzelmomenten, nicht erlebbar. Wir leben nicht den Augenblick, wohl aber in der Zeit der Gegenwart.
An der Weltzeit partizipieren wir alle, allerdings in unterschiedlichen, relativ kurzen Zeitspannen, in denen unsere individuelle Vergangenheit immer länger und unsere individuelle Zukunft immer kürzer wird. Es wäre ein grausames Narrenspiel, gäbe es nur Heideggers „Vorlaufen in den Tod“, nicht aber Blochs Hoffnungsbilder gegen den Tod,, den Geist der Utopie, den Glanz des kosmologischen Alles (natürlich auch im Sinne der Blochschen Kosmologie), einer Vollendung, deren Vor-Schein die Schatten des Nichts, des Nihilismus, zu vertreiben vermag.[23 ] So dass wir auch in finsteren Zeiten zunehmender Un-freiheit nicht an der Aufgabe verzweifeln müssen, dem Reich der Freiheit näherzukommen . – Die Weltzeit lässt sich nicht manipulieren. Sie verlangt ihren Tribut in Form mehr oder weniger sinnvoll genutzter Zeit.[24 ]
Turbo-Zeit. Wer ihr unterworfen ist, wird sich von ihrem Zwangsregime auch durch die von Isabel Winn gemachten Vorschläge zum Zeit-Management (s.o. S. 197 f.) kaum befreien können. Die möglichen Folgen forcierter Beschleunigung und falscher Zeit-Einteilung sind einerseits weithin bekannt, andererseits jedoch in solchem Maße individuell verschieden, dass sie sich kaum darstellen lassen. Daher muss ich mich hier mit ein paar Hinweisen und Anmerkungen begnügen. Bei Karlheinz Geißler spiegelt sich die angedeutete Schwierigkeit u.a. darin wider, dass er einige seltsam und mitunter auch monströs anmutende Begriffe verwendet. Neben der „Arbeitsverdichtung“ präsentiert er da die „Optionssteigerung“, d.h. neben der „Patchwork-Identität“ den „Tod des Subjekts“ – und schließlich solche Monster-bildungen wie das „Erreichbarkeitsmanagement“, den „Stand-by-Alltag“ und die „Instant-Genuss-Kultur“.[25] – Hinter diesen Begriffs-Monstern stehen krasse Fehlentwicklungen. Und wer glaubt, darin sein Glück – oder sogar das Glück überhaupt – finden zu können, kann leicht auf Abwege geraten. Denn: Das Glück verfehlt ja mit Sicherheit, wer ihm pausenlos nachjagt. Wo es keine Pausen, keine Unterbrechungen gibt, gibt es auch keine Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen. Und das macht mit Sicherheit unglücklich! – Auf Nonstop und Multitasking sind wir nicht vorbereitet, jedenfalls nicht unsere Gehirne, die einfach nicht in der Lage sind, „gleichzeitig mehrere unterschiedliche Dinge mit identisch hoher Konzentration zu steuern“ (Geißler a.a.O. S. 151). Wer das missachtet, nimmt nicht nur zunehmende Mängel an Konzentrationsfähigkeit, sondern auch Störungen der Wahrnehmung und der Informationsverarbeitung in Kauf (a.O. S. 153 ff.). – Markantes Kennzeichen der Nonstop-Gesellschaft ist ihre tendenzielle Schlaflosigkeit, erkennbar an steigender Unfall-häufigkeit durch Übermüdung, „Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, Schlafstörungen und Leistungsabfall“ (a.O. S. 111) sowie zunehmender Abhängigkeit von Schlaf- und Beruhigungsmitteln. Besonders in Mitleidenschaft gezogen werden Ehe und Familie. Stichworte hierzu: steigende Scheidungsraten, Geburtenrückgang, immer mehr Alleinlebende, instabile Wohngemeinschaften. – Geißler bilanziert und warnt: „Die Grenzen des Nonstops sind dort erreicht, wenn nicht sogar überschritten, wo der Mensch durch den gestiegenen Zeitdruck und die gewachsene Zeitverdichtung zum Sicherheitsrisiko wird, wenn ihm Müdigkeit und Unaufmerksamkeit als Systemdefekt oder als „menschliches Versagen“ zugerechnet werden. Es wäre schließlich fatal, wenn in der Nonstop-Gesellschaft die Subjekte ihre Zeit damit zubringen müssten, ihr Leben und ihre Gesundheit zu retten, weil sie permanent um diese fürchten müssten.“ (a.O. S. 114).
Als Gegenmittel empfiehlt Geißler u.a. die Rückbesinnung auf die Grenzen der menschlichen Natur, die Fragen nach Sinn, Zweck und Ziel des eigenen Tuns, die Fähigkeit zum Nein-Sagen und das, was er, ähnlich wie nach ihm Isabel Winn, die „Kunst der Zeit“ nennt, worauf ich hier aber – nicht nur aus zeitlichen Gründen – nicht näher eingehen kann, so dass ich auf meine diesbezüglichen früheren Darlegungen (in: Robra 2015, S. 474 ff.) verweisen muss.
Globalisierung. In der Geschichte geht es nicht selten eher ungeistig bzw. „geistlos“ zu. Viel beschworen wurden der „Ungeist des Nationalsozialismus, ... des Bolschewismus, ... des religiösen Fanatismus“ usw. Wenn nicht einfach „große Männer“ in Haupt- und Staatsaktionen, sondern Personen jeglicher Herkunft, Couleur und Wesensart Geschichte machen, ist deren gesamte Tätigkeit – und nicht nur ihre gesellschaftliche Arbeit – der „Motor der Geschichte“. Woraus folgt, dass auch die Globalisierung, zumal unter dem Aspekt der Weltgeschichte oder gar der Ewigkeit (‚sub specie aeternitatis‘), keineswegs das Ganze der Geschichte ausmacht. (Wobei ich erneut betone, dass dieses Ganze nicht überschaubar ist.) So dass zu fragen ist, welche Teilaspekte der Geschichte denn gemeint sein können, wenn von Globalisierung die Rede ist. Dem Wort nach: das Umspannen (sprich: Umspannen!), der Einbezug des gesamten Erdballs in die Geschichtshorizonte der Menschheit und in die Möglichkeiten geschichtlichen Handelns.
Anscheinend beginnt alles „lokal“, z.B. die Geschichte jeder Einzelperson im Mutterleib, aber auch politisch-geografische Expansionen wie die der Geschichte Roms und seines Imperiums. Wonach dann das bloß Lokale aufgegeben wird zu Gunsten stetiger Horizonterweiterung, die schließlich nicht auf einzelne Regionen beschränkt bleibt.
In frappierender Weise ändern sich die Antworten auf die Fragen nach der Bedeutung der Globalisierung, und zwar oft in Abhängigkeit von teilweise völlig unvorhersehbaren Wechsel-fällen der Geschichte. Eher deterministisch nahm ich im Jahre 2003 noch an, dass sich mit der Globalisierung auch der sogenannte Turbo-Kapitalismus verstetigen würde. Das hat sich nicht bestätigt. Als Gründe hierfür nennen Harald Schumann und Christiane Grefe schon im Jahre 2009 – und schon unter dem Eindruck des fürchterlichen Finanzcrashs von 2008 – Folgendes: „Die wechselvolle Wirtschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts belegt: Die grenzenlose Ausdehnung des Kapitalismus ist keineswegs vorherbestimmt. Der Lauf der Geschichte kann durchaus eine andere Richtung nehmen. Es handelt sich um einen dialektischen Prozess. Wo immer der Mechanismus von Angebot und Nachfrage, von Kapitalrendite und Strukturwandel Grenzen überwindet, Partikularinteressen verletzt oder bestehende Kulturen bedroht, erzeugt dieser Vorgang auch Gegenbewegungen. Und die Konsequenzen sind offen. Dass der Trend zur globalen Integration anhält und nicht wieder ins Gegenteil umschlägt, ist keineswegs ausgemacht.“[26 ]
In der Tat gibt es vielfältige, teils bedenklich populistische Gegenbewegungen gegen die turbo-kapitalistische Globalisierung, die ich hier aus Platzgründen nicht näher beschreiben kann. Weiterhin gültig und geboten ist jedenfalls die Warnung vor einer Verharmlosung kata-strophaler „Nebenwirkungen“ der Globalisierung, darunter die der Verschärfung der sozialen Gegensätze und Konflikte, die schleichende bis akute Klima- und Umwelt-Katastrophe, zu-nehmend ungleicher Handel, zunehmende Weltmarkt-Beherrschung durch einige Großkon-zerne (die „Global Players“), mit bösen Folgen wie dem Kollaps ganzer Volkwirtschaften in Afrika und anderswo, was u.a. zu Kriegen, katastrophalen Flüchtlingskrisen und humanitären Katastrophen geführt hat. – Hinzu kommt der Banken- und Finanz-Crash des Jahres 2008, mit schwerwiegenden, unabsehbaren Folgen für die Weltwirtschaft und den Verlauf der Globa-lisierung. Und auch die Corona-Pandemie des Jahres 2020 wirft die Systemfrage auf, die Frage, welches Wirtschafts- und Gesellschaftssystem besser geeignet ist, lebensgefährlichen Bedrohungen standzuhalten.
Zur Ethik des „Digitalen Humanismus“
In einer Veröffentlichung des Jahres 2023 stellen Julian Nida-Rümelin und Nathalie Weidenfeld die Frage: „ Was kann und darf künstliche Intelligenz? “, mit dem Untertitel Ein Plädoyer für Digitalen Humanismus. Darin schreiben sie:
„Der digitale Humanismus plädiert für eine instrumentelle Haltung gegenüber der Digitalisierung: Was kann ökonomisch, sozial und kulturell nutzen, und wo lauern Ge-fahren? …
Der digitale Humanismus lässt die Kirche im Dorf. Er betont die weitgehende Unver-änderlichkeit der Menschennatur und der Bedingungen einer humanen Entwicklung. Er verteidigt kulturelle Errungenschaften wie die Trennung von Privatem und Öffent-lichem und das, was das Bundesverfassungsgericht als »informationelle Selbstbestim-mung« bezeichnet hat. Er plädiert für eine Stärkung der Demokratie, auch unter Ein-satz der neuen digitalen Möglichkeiten, er warnt vor einem Verfall der zwischen-menschlichen Verständigung in Zeiten der zunehmenden Anonymisierung und Mani-pulation der Internetkommunikation. Er plädiert für eine Stärkung der Urteilskraft, um in dem Überangebot von Daten verlässliche Orientierung zu ermöglichen.
Der digitale Humanismus ist nicht defensiv, er möchte den technischen Fortschritt im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz nicht bremsen, sondern fördern, er spricht sich für eine Beschleunigung des menschlichen Fortschritts unter Einsatz der digitalen Möglichkeiten aus, um unser Leben reichhaltiger, effizienter und nachhaltiger zu machen. Er träumt nicht von einer ganz neuen menschlichen Existenzform wie Trans-humanisten, er bleibt skeptisch gegenüber utopischen Erwartungen, ist aber optimi-stisch, was die menschliche Gestaltungskraft der digitalen Potenziale angeht.“ (S. 253-255)
Kritische Anmerkungen
Der „Digitale Humanismus“, den J. Nida-Rümelin und N. Weidenfeld vortragen, wirkt anthropozentrisch, zumal beide Autoren heftig auf menschlicher Subjektivität und Bewusst-seins-Autonomie insistieren. Eher statisch wirkt dabei das Menschenbild, weil die Autoren von einer relativen Unveränderlichkeit der menschlichen Natur ausgehen, ohne jedoch den Umstand zu thematisieren, dass der Mensch nicht nur Natur-, sondern auch Kultur-Wesen ist. Nida-Rümelin wiederholt zwar nicht seine Kritik am naturalistischen Reduktionismus, erkennt aber auch keine Notwendigkeit, den Humanismus mit dem Naturalismus zu verbinden; wie es schon Marx vorschwebte und von Ernst Bloch in seiner Natur-Allianztechnik verwirklicht wurde (s.o.). Dem entspricht die Tatsache, dass Nida-Rümelin zu Marx ein eher zwiespältiges Verhältnis bekundet, attestiert er ihm doch einerseits einen „ethischen Humanismus“, andererseits aber auch einen „politischen Anti-Humanismus“; beides sei schon in Marxens Gesamtwerk enthalten, der „Anti-Humanismus“ also nicht erst durch totalitäre Verfälschungen nach seinem Tod entstanden.[27 ] Unverständlich ist vor allem, dass Nida-Rümelin und Weidenfeld die Bedeutsamkeit und Notwendigkeit einer Synthese von Humanismus und Naturalismus – insbesondere angesichts der weltweiten Umwelt- und Kima-Krisen – offenbar nicht erkannt haben.
Anthropologie – die „Ressource Mensch“. Angesichts der beschriebenen Lage erscheint es ratsam, sich auf die menschliche Natur zu besinnen, auch wenn deren Analyse wohl nie endgültig sein kann. Neue Erkenntnisse zwingen auch hier immer wieder zu neuen Über-legungen und Standortbestimmungen. Stets aufbauen kann man aber auf Faktoren wie Kommunikation, Kontakt und Kooperation, nachweisbar schon in der anorganischen Materie und in allen weiteren Seinsstufen bis hin zum individuellen Bewusstsein und zum gesell-schaftlichen Sein; Grundlagen von Weiter- und Höherentwicklung.
Demgemäß gibt es auf die Frage, was der Mensch sei, mindestens drei einleuchtende Antworten: 1.) Der Mensch ist das, was er geworden ist; sein „Ge-wesenes“ ist sein Wesen. 2.) Er ist das, was er noch werden kann, noch nicht ist. 3.) Und das ist meine (vorläufige) Antwort: Er/sie ist Materie und Person zugleich. Bestimmbar daher sowohl materiell als auch geistig, sowohl vom „Gesamtumfang“ des Mensch-Seins als auch von der stofflichen und informationell-entelechetischen Materie her. Wobei zu dem Gesamtumfang bekanntlich nicht nur das Körper-Sein und der Geist, sondern auch die Psyche, die Seele als Erlebnis-Grundlage, gehört. Der Versuch, die leib-seelische Einheit zu verstehen, ist oft unternommen worden und möglicherweise nie gelungen. Eine „endgültige“ Lösung kann es schon deshalb nicht geben, weil wir nicht wissen, welche Möglichkeiten, welches Noch-Nicht uns die Zukunft bescheren wird. Immerhin verhilft dialektisches Denken dazu, die prinzipielle Unüberschaubarkeit des Leib-Seele-Problems auf ein erträgliches Maß zu reduzieren und plausible Lösungsansätze bieten zu können, wie ich im Folgenden zu zeigen hoffe. Wobei ich natürlich auch auf die Antworten 1.) und 2.) zurückkommen werde, zurückkommen muss.
Zu Anwort 1.). Sie erheischt einen Rückgang in den Ursprung, den mutmaßlichen Anfang des Kosmos, zumindest aber zur materiellen Grundlage des menschlichen Seins – und damit zu der gigantischen Evolutionsgeschichte, die in uns, d.h. z.B. in unserem genetischen Erbe, nachwirkt. Schon auf subatomarer Ebene werden Informationen bzw. Strukturen vorge-funden, die analysiert und als „bedeutsam“ interpretiert werden können. Es sind u.a. „dynamische Muster“ mit bestimmten Wellen-Funktionen bzw. raum-zeitlichen Symmetrien und Asymmetrien, denen Physiker bereits Zwecke zuordnen können.[28 ]
Eine Teleonomie, die sich in den Atomen in der Entwicklung des periodischen Systems der chemischen Elemente niederschlägt, wobei „syntaktische Zuordnungsprinzipien“ vorzu-herrschen scheinen.
Wie molekulare Codierung funktioniert, zeigt sich in der speziellen Semantik der genetischen Codes und damit des Lebens selbst, das zugleich das biologisch-materielle Substrat der natürlichen Wort-Sprachen enthält. Wiederum wirken Assoziations- und Zuordnungsprinzi-pien, die ein „Prinzip von Höherentwicklung und Transcodierung“ enthalten (a.O. S. 22). Und aus DNS-Molekülen bestehen auch die Pflanzen und die Lebewesen. Im Verhalten der Menschen führen die außerordentliche Vergrößerung des Neocortex und die Ausbildung des Bewusstseins u.a. zu immer besseren Formen des sprachlichen Ausdrucks und dessen Kommunikation. Wobei primär bedeutsam allerdings nicht die bloße Kommunikation gewesen zu sein scheint, sondern die „ Konstruktion eines kohärenten Weltbildes, zusammen-gesetzt aus unterschiedlichen Sinnesmodalitäten“ (a.O. S. 29). Träger, Muster und Bedeutung sind Grundelemente jeglicher Sprache, wobei für die Entwicklung der Psyche bereits die Zellsprache, d.h. die „Zeichengebung in den Zellen“ als maßgeblich gilt (ebd.). So dass sich erneut das Leib-Seele-Problem als Kernfrage der Anthropologie erweist.
Pionierarbeit hat hierzu die US-amerikanische Biomedizinerin Candace B. Pert (2001) geleistet. Um jeglichen Dualismus zu vermeiden, analysiert sie „das gesamte zelluläre (bzw. energetische) Geschehen in lebenden Organismen als dynamisches Informations-Geschehen “. Wahre Vermittlung zwischen Materiellem und Immateriellem erfolge dabei durch die Gefühle, repräsentiert u.a. in Neuropeptiden, die für die „informationelle Interaktion“ zwischen den Körperzellen und u.a. auch zwischen Psyche und Immunsystem sorgen. Es ist eine Einheit, die Pert auch als „Körpergeist“ bezeichnet, eine Definition, die mich jedoch nicht überzeugt, zumal man den Geist im Menschen mit Schelling als dialektische Subjekt-Objekt-Beziehung oder mit Gregory Bateson als „die Welt der Informationsverarbeitung“ verstehen kann, so dass sich der verwirrende Begriff „Körpergeist“ durch den der Körper-Geist-Information ersetzen lässt.
Woraus ich allerdings eine neue Hypothese zur Lösung des Leib-Seele-Problems ableite. Dialektisch-materialistisch analysierbare Information vermittelt zwischen Leib und Seele; dialektisch durchaus mit Schellings Subjekt-Objekt; dialektisch-materialistisch, weil Information auf der Basis der neurowissenschaftlich erklärbaren Trias Träger – Muster – Bedeutung als In-Form-Setzung verstanden werden kann. Das Gehirn – indirekt also der ganze Körper – dient als Träger von neuronal bestimmbaren (synaptischen) Mustern, die ihrerseits Träger von Symbolik sind, z.B. in sprachlichen und nicht-sprachlichen Bedeu-tungen.
Außerdem kann Information qua Kommunikation auch als ein Verhältnis von Subjekt-Objekt, Objekt-Subjekt verstanden werden. Was mich schließlich zu der Folgerung veranlasst hat: „Dialektik als Einheit von Identität und Nicht-Identität betrifft voll und ganz die leib-seelische Befindlichkeit des Menschen, wobei Grenzen der Erklärbarkeit, z.B. außerhalb der von Empfängnis und Tod begrenzten leib-seelischen Identität des Menschen, erkennbar werden. Anfang und Ende des Ganzen, dessen Teile wir sind, kennen wir ohnehin nicht. Damit sind auch die Grenzen benannt, in denen sich eine dialektisch-materialistische Theorie der leib-seelischen Existenz des Menschen bewegen kann.“[29 ] – Überschaubar ist also nicht die Person als Ganze (Mouniers „volume total de l‘homme“), wohl aber ein Kern-Aspekt ihrer leiblich-seelischen Verfasstheit, ihrer „Grundbefindlichkeit“. Das Ganze des Person-Seins analysieren zu wollen, dürfte ohnehin ein aussichtsloses Unterfangen sein.[30 ]
Vom Selbst zur Demokratie
Dankbar bin ich für eine politische Perspektive, die sich aus einem von Joachim Bauer nicht erwähnten Aspekt des Selbst-Systems ergibt:
Da das Selbst-System zur Ich-Findung, Selbst-Fürsorge und Fürsorge für andere Menschen befähigt, hat das Individuum – das personale Selbst – einen Rechtsanspruch auf Selbst-bestimmung, und zwar auch deshalb, weil der Mensch das einzige Wesen ist, „das sich an der Konstruktion seiner selbst – und seines Selbst“ beteiligt bzw. beteiligen kann, soll und muss. Beteiligt ist der Mensch vom Säuglingsalter an (s.o.). Beteiligen muss er sich später daran, wie sein Selbst konkret gestaltet wird, dabei auch im gesamtgesellschaftlichen Rahmen. Dieser darf seinem Anspruch auf Selbstbestimmung nicht im Wege stehen, was nur dann möglich zu sein scheint, wenn der Anspruch auf Selbstbestimmung tatsächlich auch gesamt-gesellschaftlich gewährleistet wird. Jedes Volk hat das Recht auf Selbstbestimmung, wobei jedes personale Individuum, die Einzelperson, an der individuellen Inanspruchnahme und Wahrnehmung dieses Rechts nur dann gehindert werden darf, wenn es dabei die Rechte sei-ner Mitmenschen verletzt oder missachtet.
Politisch besagt dies: Demokratie bedeutet nicht nur „Herrschaft des Volkes für das Volk und durch das Volk“, sondern auch Selbstbestimmung des Volkes. Demgemäß erstrebenswert er-scheint eine Mischung aus direkter und repräsentativer Demokratie, weil in beiden Formen – und erst recht in ihrer Kombination und effektiver Kooperation – sowohl das Gemeinwohl als auch die Rechte der Einzelpersonen gewahrt werden. – Dieser gesamtgesellschaftliche Aspekt des Selbst-Systems sollte in seiner Bedeutung nicht unterschätzt werden.
Allerdings: Weder mit Liebe noch mit Demokratie allein oder zusammen können sämtliche akuten und latenten Welt-Probleme gelöst werden. Hierzu bedarf es weiterer Anstrengungen – nicht nur ethischer, sondern vor allem auch politischer Natur.
Als aktuelle Probleme mit höchstem Bedrohungspotential lassen sich herausstellen:
1. Die Öko-Katastrophe, d.h. die Zerstörung von Lebensgrundlagen in Umwelt, Natur und Klima, greift um sich, auch wenn gelegentlich Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
2. Der neolíberale Turbo-Kapitalismus verschärft in seiner globalisierten Form weltweit die sozialen Ungleichheiten, Gegensätze und Konflikte und lässt dabei u.a. Rechts-radikalismus, Nationalismus und Populismus in gefährlichem Ausmaß erstarken.
3. Die Digitalisierung droht in eine „Digitale Diktatur“ umzuschlagen, z.B. in Folge von zunehmendem Daten-Diebstahl und -Missbrauch, Cyberkrieg, illegalem Drohnen-Einsatz u.a.m.
4. Die Ideologie des Transhumanismus begünstigt ebenfalls den Missbrauch von Digi-talisierung („Big Data“) und Künstlicher Intelligenz.
5. Posthumanismus. Wie u.a. Ray Kurzweil behauptet, gibt die Menschheit sich in der „Singularität“ des Jahres 2045 selbst auf, und zwar zu Gunsten superintelligenter, „unsterblicher“ Roboter.
6. Nicht zu vergessen ist auch die Tatsache, dass die Menschen seit 1945, d.h. seit Hiroshima und Nagasaki, in der Angst vor der Atomkriegsgefahr leben.
Nur bei zweien (Nr. 4. u. 5.) dieser aktuellen Probleme lassen sich Bezüge zu Nietzsche herstellen: bei Trans- und Posthumanismus, wenn auch mit eher fragwürdigen Ergebnissen. Nietzsche predigt bekanntlich den Übermenschen, versteht den Menschen als „Etwas, das überwunden werden soll“ und fragt uns, was wir denn zu dieser Überwindung beigetragen hätten. Antworten des 20. Jahrhunderts lauten z.B.: Superman und Cyborg („cybernetic organism“).
„Mehr Emotionen wagen“?
Demokratie und rechtsextremer Populismus gelten als unvereinbare Gegensätze. Wie können Demokraten verhindern, dass der Populismus – ein weltweites Phänomen – die Demokratie zerstört? Antworten auf diese Frage versucht Johannes Hillje in seinem 2025 erschienenen Buch Mehr Emotionen wagen. Wie wir Angst, Hoffnung und Wut nicht dem Populismus über-lassen. Dabei verteilt er seine Analysen des Populismus auf nahezu sämtliche Kapitel des Bu-ches und spannt dabei zunächst den Bogen von Trump über Meloni und die österreichische FPÖ bis hin zur AfD. Wie Trump emotionalisiert, wird schon an der Art und Weise erkenn-bar, in der er seine Bewegung MAGA (‚Make America Great Again‘) präsentiert: Sie sei „eine Bewegung, gebaut auf Liebe“.[31 ] Womit er natürlich alle erreichen will, in Sonderheit die vom Christentum Überzeugten. (Vgl. Das Hohelied der Liebe des Apostels Paulus!), wobei er nicht nur die Armen, sondern auch Elon Musk, den reichsten Mann der Welt, einbe-zieht („I love you, Elon.“).
Trump selbst hält sich nach den ersten 100 Tagen seiner 2. Amtszeit für den Herrscher über die ganze Welt, zuvor ohnehin schon für den „Gesandten Gottes“, dabei stets mit höchst anmaßendem, unberechenbarem Führerkult. Folgerichtig unterstützen Trump und Musk un-umwunden autoritäre bis faschistische Regime und Parteien überall auf der Welt, so die von Meloni und Orbán, sowie die FPÖ und die AfD. Gemeinsam ist diesen Strömungen die Absicht, nicht nur ihre Anhänger, sondern immer weitere Teile der Bevölkerungen emotional anzusprechen und an sich zu binden. Wobei sie – wie einst der Nazi-Führer Goebbels – behaupten, sie hätten die Wahrheit für sich gepachtet, so dass Irrtum, Lern- und Korrek-turfähigkeit von vornherein ausgeschlossen werden. Und:
„Die Monopolisierung der Wahrheit braucht eine Immunisierung der Lügen gegen die Fakten. Dazu werden einerseits seriöse Informationsquellen und ihre Faktenchecks diskreditiert. Andererseits schaffen sich rechtspopulistische Bewegungen ganze Öko-systeme sogenannter alternativer Medien, die im Zusammenspiel mit der Social-Media-Kommunikation die Lügen und Weltbilder ihrer politischen Anführer in einem journalistischen Gewand und teils mit pseudo-wissenschaftlicher Bestätigung zu Fak-ten erklären.“ (a.a.O. S. 149)
Es wird also wissentlich und systematisch gelogen, und dies zigtausendfach, wie schon im Fall Trump nachgewiesen wurde. Populisten simplifizieren, provozieren, dramatisieren, pola-risieren, wobei sie immer wieder die Ebenen der Gefühle und des Irrationalen zu erreichen versuchen. Im Vordergrund stehen dabei, wie Hillje erklärt, 1. Hoffnung, 2. Angst, 3. Wut.
Zur Hoffnung. Nur beiläufig erwähnt Hillje Ernst Blochs fast 1700 Seiten umfassendes Hauptwerk Das Prinzip Hoffnung (1977), in dem die Hoffnung stets eine progressive, gelehrte (docta spes) ist. Umso mehr fällt auf, dass Hillje die Rolle der Hoffnung im Po-pulismus Melonis, Trumps und der AfD hervorhebt, wobei er anmerkt, dass es „Hoffnungs-forschung“ in Deutschland nur ansatzweise gebe, während in der Bevölkerung, vor allem Ostdeutschlands, die CDU am meisten mit Hoffnung assoziiert werde; ebenso bei den Partei-gängern der AfD, während genau diese Partei „in der Gesamtwählerschaft am meisten Wut und Angst“ auslöse (a.a.O. S. 129)
Zur Angst. Als Synonyme von Angst nennt Hillje „Panik, Furcht, Sorge, Anspannung und innere Unruhe“ (ebd.), wobei er den gewichtigen Unterschied zwischen Angst und Furcht außer Acht lässt. In der AfD gehören Ängste, bzw. das Schüren von Ängsten, zur Tagesord-nung (was anscheinend auch mit den Persönlichkeitsstrukturen der meisten AfD-Wähler zu-sammenhängt). Bei diesen lasse sich viel mehr als bei anderen Wählern feststellen:
„Zukunftsangst, Furcht vor dem sozialen Abstieg, Ängste im Zusammenhang mit der Globalisierung, Sorge vor Islamisierung und Überfremdung oder seit 2022 auch Angst, dass Deutschland in den Krieg in der Ukraine hineingezogen wird.“ (a.a.O. S. 130).
Hinzu kommen angstbesetzte Verschwörungsmythen („globalisierte Eliten“, „deep state“: Staat im Staat mit geheimen Umtrieben, Klima-Diktatur u.a.m.).
Zur Wut. Diese spielt in der AfD eine noch größere Rolle als die Angst. Als Synonyme von Wut nennt Hillje „eine ganze Reihe von emotionalen Zuständen, darunter Zorn, Ärger, Empö-rung, Abscheu, Gereiztheit, Enttäuschung und Unzufriedenheit“ (S. 133). Zwar könne Wut angesichts gesellschaftlicher Missstände durchaus motivierend und konstruktiv wirken, so bereits in der Französischen Revolution, die ohne Wut kaum zustande gekommen wäre. Aber: Die Rechtspopulisten hätten es geschafft, diese eher linke Motivation zu übertrumpfen, und zwar mittels Feindbildern wie: „die politischen Eliten, journalistische Medien, Migranten, sexuelle Minderheiten und politisch Andersdenkende“ (S. 135). Mehr als Angst werde Wut von der AfD bewusst geschürt, und zwar ausgehend von den „subjektiven Sorgen“ der Individuen, die über den „Mechanismus des Ressentiments“ verallgemeinert würden. Sünden-böcke werden als Zielobjekte der Wut gesucht und gefunden. Das Fazit einer Studie hierzu lautet:
„Je länger man diese Partei wählt, desto wütender wird man. Die stetig eskalierenden Botschaften der AfD sind genau darauf ausgelegt. Das Kalkül ist plausibel: In der Neurowissenschaft wird Wut mit Kartoffelchips verglichen. Sie macht süchtig, und wenn man einmal zugegriffen hat, hört man damit nicht auf.“ (S. 137)
Angst und Wut sind Grundlagen für die „undemokratische Emotionalisierung“. Angst führt zu Wut und diese zum Hass, und zwar sehr zum Schaden der Demokratie; wobei sogar das Fun-dament jeglicher Demokratie ins Wanken geraten könne und die Anzahl rechtsextremer Gewalttaten ständig zunehme, so z.B. gegen Geflüchtete und deren Unterkünfte.
Als weitere Formen solcher Demokratie-Feindlichkeit nennt Hillje „Entmenschlichung, Anta-gonisierung, Wahrheitsmonopolisierung und Verächtlichmachung demokratischer Institutio-nen“ (S. 141). Die AfD verachtet die Menschenwürde und setzt dieser ihre Ideologie der Un-gleichwertigkeit entgegen . Zu den angeblich „Ungleichwertigen“ gehören vor allem Auslän-der un Muslime, aber auch Deutsche mit Migrationshintergrund, Bevölkerungsgruppen, die von AfD-Politikern „pauschal als »Parasiten«, »Viecher« oder »Monster«“ bezeichnet wer-den, während Trump Eingewanderte „Tiere“ nennt – systematische Deshumanisierung, die auch vor der Herabwürdigung von Frauen und Transgendern nicht Halt macht.
Antagonisierung bedeutet z.B., dass Meinungsstreit in Polarisierung und diese in gefährliche Antagonismen vorangetrieben wird, so wenn AfD-Politiker demokratisch gewählte Regie-rungsmitglieder als „Volksverräter“ bezeichnen und Gewalt mehr und mehr gerechtfertigt wird.
Zur Wahrheitsmonopolisierung s.o. S. 37. Zur Verächtlichung demokratischer Institutionen schreibt Hille:
„Im Zentrum der Angriffe steht meist die Behauptung, dass das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip der Verfassung durch die herrschenden Eliten ausgehebelt werde. Die Verächtlichmachung hüllt sich somit in den Mantel der Demokratieverteidigung. Am stärksten emotionalisieren dürfte der Vorwurf, es handele sich beim politischen System in Deutschland nur noch um eine demokratische Fassade, hinter der längst ein diktatorisches Regime etabliert worden sei. Merkeldiktatur, Coronadiktatur, Ökodikta-tur, Wokediktatur, Meinungsdiktatur – die Diktaturlüge wird an Themenkonjunkturen flexibel angepasst und von der AfD, mitunter auch dem BSW, Reichsbürgern und po-pulistischen Bewegungen wie »Querdenken 711« vorgetragen.“ (S. 151)
Ähnlich wie Trump bedient die AfD sich außerdem der perfiden Taktik, Zweifel an der Inte-grität und Legitmität demokratischer Wahlen zu säen (vgl. S. 153).
Was aber setzen Demokraten solchen Tendenzen destruktiver politischer Emotionalisie-rung entgegen?
Hierzu beschreibt Hilllje schon am Anfang seines Buches (S. 18 ff.) drei „idealtypische Mu-ster“:
1. „Stoische Sachlichkeit“. Prototyp: Olaf Scholz, mit wenigen Ausnahmen. Man will dem Emotionalismus mit betontem Rationalismus begegnen, was Hillje aus zwei Gründen für verfehlt hält: a) Verkürzung des Populismus auf Wut und Empörung, b) Ausblendung lebensweltlicher Realitäten und Identifikationsmöglichkeiten. Politiker irren, wenn sie meinen, auf Emotionen verzichten zu können. Denn Tatsachen können nicht von den sie begleitenden Gefühlen getrennt werden: „Die Annahme, sachliche und seriöse Antworten allein würden die Menschen überzeugen, ist womöglich der folgenreichste Irrtum der Aufklärung.“ (S. 18 f.)
2. „ Selektives Kopieren“. Man imitiert die Emotionalität der Rechtsextremen; gut zu be-obachten z.B. bei Friedrich Merz, der von ukrainischen Flüchtlingen als „Sozialtouris-mus“ sprach und mehrfach ähnliche „Strongman-Posen“ an den Tag legte, womit er auch zu den enormen Stimmzuwächsen der AfD bei der Bundestagswahl 2025 beitrug. Hillje nennt solche Phänomene „Populismusplagiate“.
3. „Betonte Positivität“. Man will den rechtsextremen Schwarzmalern eine Reihe positiver Gefühle und Attitüden entgegenstellen, redet aber an den tatsächlichen Emo-tionen der Bevölkerung vorbei, statt bei deren Sorgen und Befürchtungen anzusetzen Kamal Harris scheiterte u.a., weil sie kein überzeugendes wirtschaftspolitisches Kon-zept vorzutragen vermochte, aber Positivität ausstrahlen wollte.
Hilljes Fazit:
„Von den drei beschriebenen Ansätzen erlebt man in der politischen Praxis von allen ein bisschen, dominant ist aber die stoische Sachlichkeit, die nicht selten als ein Pathos der Pathoslosigkeit selbst emotionalisiert wird. Die bittere Er-kenntnis lautet, dass die demokratische Mitte noch immer ziemlich hilflos ge-genüber dem Populismus ist. Und zwar in einer ganzen Reihe von westlichen Demokratien. … Es geht … nicht in erster Linie um Kommunikation. Es geht darum, Lösungen auf der Höhe der Probleme zu entwickeln und die Menschen zum Teil dieser Lösungen zu machen. Um Vertrauen in demokratische Lösun-gen herzustellen, ob konservative oder progressive, bedarf es allerdings der emotionalen Involvierung der Menschen.“ (S. 22)
Hilljes Gegenvorschläge
Gegen die rechtsextreme Vereinnahmung der Gefühle schlägt Hillje vor a) „Emotionen für Demokratinnen und Demokraten“ (S. 177 ff.), b) eine „neue politische Emotionskultur“ (S. 211 ff.). Grundsätzlich seien die Deutschen auch von Politikerinnen und Politikern emotional ansprechbar. Dies gelte auch für „Progressive Wutbotschaften“, in denen z.B. das Sterben von Flüchtlingen im Mittelmeer angeprangert wird. Dabei emotionalisiert Menschlichkeit stets po-sitiv. In Bezug auf den Klimawandel erweisen sich Progressive als sogar der rechtspopuli-stischen Wut überlegen (S. 201 ff.).
Was aber versteht Hillje unter einer „neuen politischen Emotionskultur“? Weil Demokratie grundsätzlich kommunikativ sei, könne und müsse sie auch emotional sein. Die Menschen wollen aber in ihren Alltagsproblemen, Sorgen und Interessen ernst genommen und ange-sprochen werden. Daher muss Politik ihre Botschaften „verständlich und alltagsnah“ über-mitteln; wobei Emotion kein Selbstzweck ist, sondern stets von glaubwürdigen politischen Konzepten überwölbt sein muss. Nicht die Länge, sondern der Inhalt und die (emotionale) Form einer poltischen Botschaft sind entscheidend. „Neue Wut“ könne „Antrieb für Gerech-tigkeit“ sein, auch wenn Wut sich sowohl konstruktiv als auch destruktiv auswirken könne:
„Radikaler Populismus malt seine Feindbilder mit Wut auf Projektionsflächen, er ku-ratiert seine Politik als Dauerausstellung dieser Hassobjekte. Die Aufgabe demokrati-scher Kräfte ist es, den Zulauf der Unzufriedenen zu dieser Veranstaltung zu verrin-gern, nicht aber von vornherein ihr Ungerechtigkeitsgefühl zu disqualifizieren, ob-gleich es sich im Laufe der demokratischen Aushandlung und Abwägung als wenig stichhaltig erweisen kann.“ (S. 216))
Aufgabe der Demokraten sei es, „die Hoheit über die politischen Emotionen zu gewinnen“ (S. 217).
Neue Hoffnung könne durch vernünftiges politisches Handeln geweckt werden; wobei zu be-achten sei, dass Hoffnung sich stets auf die Zukunft richtet, während Wut und Angst zumeist auf Vergangenem beruhen. Hoffnung kann es nur geben, wenn a) klare Ziele angegeben wer-den, b) Wege zu einer besseren, gerechteren Gesellschaft aufgezeigt werden, c) „ agency“, d.h. Handlungs- und Wirkungsfähigkeit unter Beweis gestellt werden (S. 212).
„Kultursensibilität“ müsse an die Stelle von Kulturkämpfen treten. Vertrauensaufbau sei un-abdingbar, zumal Vertrauen wahrscheinlich sogar „das wichtigste Gefühl“ in einer repräsen-tativen Demokratie sei. Gesetze müssen auch auf ihre emotionalen Implikationen und Folgen hin überprüft, das Wir-Gefühl stets gestärkt werden. Ähnliches gelte für die positive Emotio-nalisierung politischer Kompromisse. Emotionskultur ist auf Gemeinsinn und Solidarität an-gewiesen. Hilljes Schlussplädoyer lautet dementsprechend:
„Die Sehnsucht der Bevölkerung nach politischen Visionen hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Das heißt: Wir brauchen heutzutage mehr solcher Reden.[32 ] [30 ]Am Ende sind es die politischen Visionen, die unsere Emotionen verdienen. Wagen wir es.“ (S. 236)
Kritische Anmerkungen
Hilljes Erkenntnisse können wie folgt in Kernsätzen zusammengefasst und hervorgehoben werden:
1. Der rechtsextreme Populismus arbeitet weltweit mit Emotionalisierungen der Politik und droht damit die Demokratie zu zerstören.
2. Folgerichtig unterstützen Trump und Musk unumwunden autoritäre bis faschistische Regime und Parteien überall auf der Welt.
3. Wobei sie – wie einst der Nazi-Führer Goebbels – behaupten, sie hätten die Wahrheit für sich gepachtet, so dass Irrtum, Lern- und Korrekturfähigkeit von vornherein aus-geschlossen werden.
4. Populisten simplifizieren, provozieren, dramatisieren, polarisieren, wobei sie immer wieder die Ebenen der Gefühle und des Irrationalen zu erreichen versuchen.
5. Im Vordergrund stehen dabei, wie Hillje erklärt, 1. Hoffnung, 2. Angst, 3. Wut.
6. In der Bevölkerung, vor allem Ostdeutschlands, werde die CDU am meisten mit Hoffnung assoziiert; ebenso bei den Parteigängern der AfD, während genau diese Partei „in der Gesamtwählerschaft am meisten Wut und Angst“ auslöse.
7. In der AfD gehören Ängste, bzw. das Schüren von Ängsten, zur Tagesordnung (was anscheinend auch mit den Persönlichkeitsstrukturen der meisten AfD-Wählerinnen und Wähler zusammenhängt).
8. Feindbilder der AfD: „die politischen Eliten, journalistische Medien, Migranten, sexuelle Minderheiten und politisch Andersdenkende“.
9. Mehr als Angst werde Wut von der AfD bewusst geschürt, und zwar ausgehend von den „subjektiven Sorgen“ der Individuen, die über den „Mechanismus des Ressen-timents“ verallgemeinert würden. Sündenböcke werden als Zielobjekte der Wut ge-sucht und gefunden.
10. Angst und Wut sind Grundlagen für die „undemokratische Emotionalisierung“. Angst führt zu Wut und diese zum Hass, und zwar sehr zum Schaden der Demokratie.
11. Als weitere Formen solcher Demokratie-Feindlichkeit nennt Hillje „Entmensch-lichung, Antagonisierung, Wahrheitsmonopolisierung und Verächtlichmachung demo-kratischer Institutionen“.
12. Die AfD verachtet die Menschenwürde und setzt dieser ihre Ideologie der Un-gleichwertigkeit entgegen .
13. Antagonisierung bedeutet z.B., dass Meinungsstreit in Polarisierung und diese in gefährliche Antagonismen vorangetrieben wird, so wenn AfD-Politiker demokratisch gewählte Regierungsmitglieder als „Volksverräter“ bezeichnen und Gewalt mehr und mehr gerechtfertigt wird.
14. Verächtlichung demokratischer Institutionen. „Im Zentrum der Angriffe steht meist die Behauptung, dass das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip der Verfassung durch die herrschenden Eliten ausgehebelt werde.“
15. Was Demokraten solchen Tendenzen destruktiver politischer Emotionalisierung ent-gegensetzen: 1. „Stoische Sachlichkeit“, 2. „ selektives Kopieren“, 3. „betonte Posi-tivität“.
16. Hilljes Gegenvorschläge. Gegen die rechtsextreme Vereinnahmung der Gefühle schlägt Hillje vor a) „Emotionen für Demokratinnen und Demokraten“, b) eine „neue politische Emotionskultur“.
17. Die Menschen wollen in ihren Alltagsproblemen, Sorgen und Interessen ernst genommen und angesprochen werden.
18. Daher muss Politik ihre Botschaften „verständlich und alltagsnah“ übermitteln; wobei Emotion kein Selbstzweck ist, sondern stets von glaubwürdigen politischen Konzepten überwölbt sein muss.
19. Aufgabe der Demokraten sei es, „die Hoheit über die politischen Emotionen zu gewinnen“.
20. Neue Hoffnung könne durch vernünftiges politisches Handeln geweckt werden; wobei zu beachten sei, dass Hoffnung sich stets auf die Zukunft richtet, während Wut und Angst zumeist auf Vergangenem beruhen.
21. „Kultursensibilität“ müsse an die Stelle von Kulturkämpfen treten.
22. Vertrauensaufbau sei unabdingbar, zumal Vertrauen wahrscheinlich sogar „das wich-tigste Gefühl“ in einer repräsentativen Demokratie sei.
Angesichts dieser beeindruckenden Phalanx von Kern- und Leitsätzen, die ursprünglich von Hillje stammen, stellt sich die Frage, ob negative Kritik an diesen Sätzen überhaupt möglich ist. Dies ist zu bejahen, denn Hillje übergeht einige wesentliche Aspekte oder behandelt sie in unzulänglicher Art und Weise. So z.B. hinsichtlich des Gewalt-Problems. In einer Kriminal-Statistik des Jahres 2023 heißt es, dass „mit knapp 29.000 Taten … erneut am meisten rechts-extremistisch motivierte Fälle gezählt“ wurden, was im Vergleich zu 2022 „eine Zunahme von rund 23 Prozent“ bedeute.[33 ] Wenn dem so ist, muss die Frage erlaubt sein, wie die Justiz mit einer solchen Zunahme rechtsextremistischer Straftaten umgeht. Hillje stellt diese Frage aber nirgendwo in seinem Buch, so dass folgende Hinweise vonnöten sind:
„Politisch motivierte Gewaltkriminalität ist die Teilmenge der Politisch motivierten Kriminalität, die eine besondere Gewaltbereitschaft der Straftäter erkennen lässt. Sie umfasst folgende Deliktsbereiche/Deliktskategorien:
Tötungsdelikte, Körperverletzungen, Brand- und Sprengstoffdelikte, Landfriedens-bruch, Gefährliche Eingriffe in den Schiffs-, Luft-, Bahn- und Straßenverkehr, Frei-heitsberaubung, Raub, Erpressung, Widerstandsdelikte, Sexualdelikte.
Hasskriminalität
Hasskriminalität bezeichnet politisch motivierte Straftaten, wenn in Würdigung der Umstände der Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie aufgrund von Vorurteilen des Täters bezogen auf Nationalität, ethnische Zu-gehörigkeit, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit/Weltanschauung, sozialen Status, phy-
sische und/oder psychische Behinderung oder Beeinträchtigung, Geschlecht/ge-schlechtliche Identität, sexuelle Orientierung, äußeres Erscheinungsbild begangen werden.
Bei der Würdigung der Umstände der Tat ist neben anderen Aspekten auch die Sicht der/des Betroffenen mit einzubeziehen.
Straftaten der Hasskriminalität können sich unmittelbar gegen eine Person oder Personengruppe, eine Institution oder ein Objekt/eine Sache richten, welche(s) seitens des Täters einer der o. g. gesellschaftlichen Gruppen zugerechnet wird (tatsächliche oder zugeschriebene Zugehörigkeit) oder sich im Zusammenhang mit den vorgenannten Vorurteilen des Täters gegen ein beliebiges Ziel richten.
Erläuterung:
Der Begriff Hasskriminalität ist an den international eingeführten Begriff Hate Crime angelehnt. Fremdenfeindliche, darunter auch antisemitische, Straftaten sind Teilmengen der Hasskriminalität. Fremdenfeindliche Straftaten
Fremdenfeindlich ist der Teil der Hasskriminalität, der aufgrund der zugeschriebenen oder tatsächlichen Nationalität, ethnischen Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religions-zugehörigkeit des Opfers verübt wird.
Antisemitische Straftaten
Antisemitisch ist der Teil der Hasskriminalität, der aus einer antijüdischen Haltung heraus begangen wird.“[34 ]
Microsoft-Copilot habe ich am 6.5.2025 die Frage vorgelegt, wie die Justiz mit rechts-extremen politischen Straftaten umgehen sollte. Die Antwort:
„Die Justiz muss in einem Rechtsstaat stets neutral und unabhängig agieren – das Prinzip der Unschuldsvermutung und ein faires Verfahren sind unumstößlich. Bei der Bewertung von Fällen, bei denen politische Straftaten aus rechtsextremen Motiven im Raum stehen, sollte daher klar zwischen der strafrechtlichen Tatsachengrundlage und der politischen Einordnung unterschieden werden. Die richterliche Beweiswürdigung muss streng auf Fakten beruhen, ohne von gesellschaftlichen Emotionen oder politischen Strömungen beeinflusst zu werden.
Gleichzeitig sind rechtsextreme Straftaten oft ein Angriff auf das Fundament der demokratischen Ordnung. Darum ist es gerechtfertigt – und auch notwendig –, dass solche Taten in ihrer Schwere besonders gewürdigt und sanktioniert werden. Es geht dabei nicht darum, politische Ansichten pauschal zu kriminalisieren, sondern das strafrechtliche Instrumentarium konsequent dann einzusetzen, wenn durch Hass, Hetze oder Gewalt die Menschenwürde und die verfassungsmäßige Ordnung angegriffen werden. Eine klare juristische Qualifikation und die konsequente Anwendung der entsprechenden Gesetze, etwa in Fällen von Volksverhetzung oder Anstiftung zum Hass, sind dabei unerlässlich.
Es gilt jedoch auch, eine Gratwanderung zu meistern: Während der Staat und die Justiz ein deutliches Signal gegen extremistische Gewalt setzen müssen, darf dies nicht dazu führen, dass verfassungsrechtlich garantierte Freiheiten – und damit auch der politische Diskurs – übermäßig eingeschränkt werden. Eine transparente und sorgfältig dokumentierte Beweisführung hilft der Justiz, in besonders brisanten Fällen das Vertrauen der Bevölkerung zu erhalten und Vorwürfen von politisch motivierter Justizwillkür entgegenzuwirken.
Zusammengefasst sollte die Justiz bei rechtsextremen politischen Straftaten einerseits streng und konsequent eingreifen, wenn es um den Schutz von Menschenwürde und demokratischen Werten geht, andererseits aber auch jederzeit die Grundprinzipien und den fairen Rechtsstaat wahren. Dieser Balanceakt ist für die langfristige Sicherheit und das Vertrauen in das demokratische System von entscheidender Bedeutung.
Ein weiterer interessanter Aspekt ist, wie präventive Maßnahmen und Bildungsarbeit in der Gesellschaft dazu beitragen können, den Nährboden für extremistische Ideologien zu verringern – denn eine nachhaltige Bekämpfung von Extremismus beginnt oft bereits weit vor dem eigentlichen Tatgeschehen und berührt Fragen der sozialen Integration und politischen Bildung.“
Die staatliche Justiz steht also der Zunahme rechtsextremer Gewalt keineswegs hilflos gegen-über. Das Hauptproblem besteht anscheinend darin, dass die Justiz „streng und konsequent eingreifen“ muss, ohne dabei in „politisch motivierter Justizwillkür“ zu verkommen. – Im Übrigen zeigt sich erneut, wie wesentlich die hier dargestellten Zusammenhänge von Selbst – Demokratie – Politik und lebenslanger Bildung sind.
Als Grund für das Erstarken des rechtsextremen Populismus nennt Hillje die manipulative Emotionalisierung (s.o.). Völlig außer Acht lässt er jedoch den Hauptgrund, ein Phänomen, das weltweit Furore gemacht hat: den globalisierten Neoliberalismus, der überall Ungerech-tigkeit, Ungleichheit, Ausbeutung und soziale Gegensätze und Konflikte verschärft hat und auch hauptsächlich für die katastrophalen Flüchtlingsbewegungen aus den wenig entwickelten Ländern des Südens in die reichen, hochentwickelten Industriestaaten des Nordens verant-wortlich ist. Dazu heißt es in einer Verlautbarung von Microsoft-Copilot vom 6.5.2025:
„Der globalisierte Neoliberalismus wirkt über mehrere Ebenen auf das Erstarken des Rechtsextremismus ein, indem er sozioökonomische und kulturelle Dynamiken in Gang setzt, die von extrem rechten Akteuren gezielt instrumentell genutzt werden.
Ökonomische Verwerfungen und soziale Ungleichheit
Neoliberale Politiken wie Deregulierung, Privatisierung und eine Betonung freier Märkte führen häufig zu einer Konzentration von Reichtum und Macht in den Händen weniger. Während internationale Finanzmärkte und Großkonzerne florieren, bleiben viele Bürger – besonders aus der Mittelschicht und traditionell arbeitenden Bevöl-kerung – mit stagnierenden Einkommen, prekären Arbeitsverhältnissen und dem Verlust sozialer Sicherungssysteme zurück. Diese erlebte ökonomische Unsicherheit und das Gefühl, von den „Eliten“ buchstäblich und symbolisch abgehängt zu werden, schaffen einen Nährboden für Ressentiments. Rechtsextreme Gruppen nutzen exakt diese Erfahrungen, um einfache narrative Erklärungen zu bieten, die die Schuld an sozialen und wirtschaftlichen Krisen bei Ausländern, Migranten oder supranationalen Institutionen suchen.
Kultureller Identitätsverlust und gesellschaftlicher Umbruch
Parallel dazu fördert der globale Austausch von Gütern, Ideen und Lebensstilen auch eine kulturelle Homogenisierung. Traditionelle und lokal geprägte Lebensweisen geraten in Bedrängnis, während ein Gefühl des Identitätsverlusts Einzug hält. Rechtsextreme Ideologien interpretieren diesen kulturellen Wandel als Angriff auf das „wahre“ nationale Selbst und nutzen diese Verunsicherung, um Abgrenzung zu definieren. Sie propagieren den Mythos, dass die Globalisierung – verkörpert durch neoliberale Wirtschaftsstrukturen – zu einem Verlust von Werten, Traditionen und nationaler Souveränität führt.
Institutioneller Verfall und Vertrauensverlust
Neoliberale Reformen haben häufig zur Aushöhlung traditioneller öffentlicher Institutionen geführt. Wenn Bürger feststellen, dass staatliche Stellen zunehmend pri-vatisiert werden und die sozialen Dienste zur Ware reduziert werden, wächst das Misstrauen in den öffentlichen Sektor. In einem solchen Klima sind viele empfänglich für radikale Versprechen, die eine Rückkehr zu einer angeblich „stärkeren“ und „authentischeren“ Staatsführung versprechen. Rechtsextreme Parteien und Bewe-gungen nutzen diese institutionelle Leere und behaupten, dass der etablierte politische Diskurs nicht mehr die Bedürfnisse des „Volks“ widerspiegele.
Populismus und die Instrumentalisierung von Globalisierungsängsten
Die enge Verknüpfung von wirtschaftlicher Unsicherheit und kulturellem Wandel führt zu einem klaffenden Riss in der Gesellschaft. Politiker und Gruppen, die sich dem Rechtsextremismus zuordnen, wissen diesen Keil zu nutzen, indem sie einen einfachen Feind – etwa Migranten, internationale Eliten oder supranationale Organi-sationen – definieren. Ihre Rhetorik verspricht eine Wiederherstellung von Ordnung, nationaler Identität und sozialer Gerechtigkeit, auch wenn die Lösungen oft radikal vereinfachend sind. Durch das Spiel mit Ängsten, die tatsächlich in den neoliberalen Prozessen begründet sind, gelingt es diesen Gruppen, Unterstützer aus Bevölke-rungsgruppen zu mobilisieren, die sich in einer globalisierten Welt verloren fühlen.
Zusammengefasst: Der globalisierte Neoliberalismus begünstigt das Erstarken des Rechtsextremismus nicht als direkte Ursache, sondern schafft über ökonomische Ungleichheiten, kulturelle Desorientierung und das Ausdünnen staatlicher Strukturen ein Klima, in dem extrem rechte Narrative besonders fruchtbar werden. Diese Dynamiken können – im Zusammenspiel mit historischen, lokalen und medialen Faktoren – zu einem ernstzunehmenden politischen Phänomen führen, das in vielen Regionen der Welt zu beobachten ist.
Es lohnt sich, auch darüber nachzudenken, wie alternative Wirtschafts- und Gesell-schaftsmodelle, die stärker auf soziale Gerechtigkeit und den Erhalt lokaler Identitäten setzen, zur Überwindung dieses Polarisierungsprozesses beitragen könnten.“
Differenzierter hat schon 2001 (!) Christoph Butterwegge die dargestellten Zusammenhänge analysiert, und zwar folgendermaßen:
„Wenn vom „globalisierten Rechtsextremismus“ gesprochen wird, meint man meist seine weltweite organisatorische Vernetzung und/oder seine Internet-Präsenz. … Sehr viel wichtiger ist jedoch die Frage, welche Folgen der Globalisierungsprozess für die Entwicklung von Politik, Programmatik und Massenbasis des Rechtsextremismus hat. Kernideologien, organisatorische Formen, politische Strategien und soziale Wähler-potenziale des Rechtsextremismus differenzieren sich im Rahmen der Globalisierung aus: Neben den völkischen (Abwehr-)Nationalismus in Bevölkerungsschichten, die Angst vor einem sie überfordernden „Turbo-Kapitalismus“ (Edward N. Luttwak) haben, tritt ein Standortnationalismus, den in erster Linie solche Schichten unter-stützen, die von einer neoliberalen Modernisierung profitieren, den „Umbau“ des Wohlfahrtsstaates nach Marktgesetzen forcieren und die soziale Ausgrenzung der weniger Leistungsfähigen intensivieren möchten.
Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt sind keineswegs bloß „hinterwäldlerisch“ anmutende Reaktionsweisen direkt betroffener oder benachteiligter Gruppen auf Glo-balisierungs-, neoliberale Modernisierungs- und soziale Marginalisierungsprozesse. Vielmehr verursachen diese auch in der gesellschaftlichen Mitte bzw. genauer: auf den „höheren Etagen“ bedrohliche Erosionstendenzen. „Gefahren der Entwicklung – auch solche der sozialen Desintegration und rechtsextremer Potentiale – gehen nicht von der ‚Masse‘ der Bevölkerung aus. In der politischen Qualifikation der alten und neuen Eliten liegt das Problem.
Globalisierung, als neoliberale Modernisierung ins Werk gesetzt, führt zu diversen Spaltungen: Soziale Polarisierung innerhalb der und zwischen Gesellschaften; Dualisierung des Prozesses transnationaler Wanderungen in Experten- bzw. Eliten-migration einerseits und Elendsmigration andererseits; Krise bzw. Zerfall der Städte, bedingt durch Marginalisierung und sozialräumliche Segregation, gehören zu den negativen Folgen, auf die der Rechtsextremismus eine demagogische, keine wirklich überzeugende Antwort gibt.
Die neoliberale Modernisierung bewirkt auch eine Umstrukturierung, politisch-orga-nisatorische wie geistig-ideologische Ausdifferenzierung und Dualisierung des Rechtsextremismus, der seither in einen traditionalistischen und einen modernistischen Flügel zerfällt. Sozialstrukturell zieht ersterer primär die Globalisierungs- bzw. Modernisierungsverlierer, letzterer besonders die Globalisierungs- bzw. Modernisie-rungs gewinner in seinen Bann. Mir scheint, dass der traditionalistisch-orthodoxe, sehr stark am Faschismus der Zwischenkriegszeit und dem noch älteren Antisemitismus orientierte Rechtsextremismus eher in Ostmitteleuropa dominiert, während der moder-nisierte, ökonomistisch und marktradikal orientierte Rechtsextremismus in West-europa bereits über die „Blut-und-Boden“-Variante triumphiert.
Mit diesem Deutungsmuster sind auch Entwicklungsunterschiede des Rechts-extremismus in Ost- und Westdeutschland erkärbar: Während in den alten Bundes-ländern eher Standortnationalismus und Wohlstandschauvinismus das ideologische Terrain beherrschen, feiert in den neuen ein mehr „konventioneller“, auf gesell-schaftliche und politische Modernisierungsrückstände verweisender Deutschnatio-nalismus fröhliche Urständ. „In der politischen Alltagskultur und im politischen Denken der östlichen Bundesländer scheint ein Trend zum ‚Völkischen‘ beobachtbar, den es zwar auch in Westdeutschland (wohl gleichfalls zunehmend) gibt, der dort aber aufgrund der großen politischen und größeren ethnischen Heterogenität dieser Gesellschaft nicht so deutlich in den Vordergrund tritt.“[35 ]
All dies hat Hillje leider nicht berücksichtigt. Hinzu kommt, dass er eine maßgebliche ethische Komponente der Emotionalisierung außer Acht lässt: Da Emotionen sich sowohl konstruktiv als auch destruktiv auswirken können, bedarf es einer Vergleichsinstanz, die Orientierung vermittelt und dadurch begründete, situationsgerechte Entscheidungen ermög-licht. Die Emotionen allein können hier nicht maßgeblich sein, weil sie kontrovers und nur von subjektiven, im Gedächtnis verankerten Interessen getragen sind. Das Gedächtnis selbst stellt aber darüber hinaus gehende Informationen sachlich-rationaler Art zur Verfügung. Diese vermitteln dem Individuum die gesuchte Vergleichsinstanz, die nicht nur die subjektiven, son-dern auch die objektiven bzw. in der Außenwelt befindlichen situativen Fakten in die Re-flexions- und Orientierungs-Horizonte einbezieht, in denen immer auch die Mitmenschen – als Rechtspersonen – von eminenter Bedeutung sind. – Auch diese Horizonte sind aber von Gefühlen und (Be-)Wertungen durchsetzt und geprägt, die sich auf die gesamten Sphären von Ethik und Moral erstrecken. Daraus folgt: Ohne ethische und moralische Reflexion kann es keine adäquate Einschätzung von Emotionen, Emotionalität und Emotionalisierung geben.
Grundlagen solcher Reflexion bietet nach wie vor Ernst Blochs Veränderungsethik, die sich problemlos mit seinem Prinzip Hoffnung verknüpft. Gelehrte Hoffnung (docta spes) zielt stets auf notwendige, sinnvolle Alternativen zum Bestehenden ab; am weitesten gehend in Konkre-ter Utopie, wohingegen Emotionalisierung allein diese Erfordernisse nicht erfüllen kann (was Hillje wissen müsste!).
Ernst Blochs Veränderungsethik knüpft an Marx und Engels an, aber auch an die von Kant vorgetragenen Konzepte zu ethischen Begriffen und Postulaten wie Wert, Würde, höchstes Gut, Tugend und Verantwortung.
Für höchst bedeutsam halte ich Blochs Wert-Begriff, ermöglicht dieser doch, wahrscheinlich erstmals, nicht nur die subjektiven, sondern auch die objektiven Komponenten des Begriffs – und damit das Wert-Problem überhaupt – einleuchtend zu erklären. Bloch definiert: „ Erst Arbeit plus Rohstoff und Stoffgehalt erzeugt alle Werte; es gibt keine Werterzeugung, vor allem auch in höherer Klimax, durch isolierte Subjektseite ohne hereinwirkende Wert-materien.“[36 ] Wird so die menschliche Arbeit am Stoff zum entscheidenden Kriterium, gibt die Objektseite zwar „das Material zum Wert“, aber erst durch die Arbeit an diesem Material ergeben sich Wertdifferenzierungen und -staffelungen, und zwar aufgrund von Zweck-setzungen und zweckdienlicher Tätigkeit: „Überall geht so der Wert auf ein Begehren zurück, samt dessen subjektiv intendiertem, objektiv konkretisierbarem Wert-Zweck-Inhalt.“ (a.a.O. S. 1570). So dass auch Gebrauchs-, Tausch- und Mehrwert selbstverständlich auf die mensch-liche Arbeit zu beziehen sind, wobei Bloch nachdrücklich auf die Marxschen Definitionen hinweist: Wert = „verdichtete Arbeit“, Maß des Wertes = die „gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit“ (S. 1571 f.), um schließlich auch die Grenze jeglicher Werttheorie anzugeben: „ ... die subjektive wie die objektive Werttheorie hört, gleich dem gesamten voneinander noch abgehaltenen Subjekt-Objekt-Verhältnis, am höchsten Augenblick des höchsten Guts auf “ (S. 1577).
Und das macht letztlich auch den Inhalt von Blochs Veränderungsethik aus, die ja nicht nur darauf drängt, „daß homo homini lupus sich nicht mehr rentiert“, dass Menschen endlich einander nicht mehr wie Wölfe gegenüberstehen und zerreißen. Vielmehr soll diese Ethik dazu dienen, reale Freiheit zu erkämpfen, wozu Bloch in seinen Politischen Messungen (1977, S. 252) schreibt: „Einzig diese Veränderungs-Ethik hebt so die bloße Wandelgalerie der bisherigen Ethik-Geschichte auf.“ Wodurch nicht alle vorherige Ethik obsolet, sondern kritisch beerbbar wird, und zwar nicht zuletzt auch zu Gunsten konkreter politischer Praxis, wozu Bloch anmerkt:
„Eine wirklich ermunternde Ethik kann so anfangen, gegen Entmenschung gerichtet, mit Theorie-Praxis hin zum Citoyen. Vermutet man mit Kant, die wahre Politik könne keinen Schritt tun, ohne vorher der Moral gehuldigt zu haben, so ist das richtig, aber nur, weil auch die wahre Moral in dieser unserer Zeit keinen Schritt tun kann, ohne Politik zu sein, revolutionäre.“ (ebd.)
Was nicht bedeutet, dass Moral endgültig in Politik aufzugehen habe, denn: „Politik löst weder die Individualkonflikte unterhalb ihrer vollständig auf (etwa das >kommunistische Vergißmeinnicht< der Geschlechtsliebe) noch erläutert und erhellt sie das Wozu, das Summum bonum und gar das Dunkel des Todes.“ (a.a.O. S. 253). Auch und gerade in der Veränderungsethik verleiht erst die Moral der Einzelperson ihre Würde, und zwar sowohl in der Klassengesellschaft als auch in einem zukünftigen Reich der Freiheit einer Klassenlosen Gesellschaft: „Man stirbt nicht für ein durchorganisiertes Produktionsbudget; unsere Totalität ist keine nur politisch abmachbare, geschweige bloß ein Rat- und Lehrinhalt der Politik. Dem Kämpfer fürs Reich der Freiheit fällt die Sittlichkeit von selber zu, doch daß er ein Kämpfer sei, dies steht nicht in der kommunistischen Politik, sondern nur in der kommunistischen Moral geschrieben. “ (ebd. Hervorhebungen durch mich.)[37 ]
VI. Zusammenfassung
Von Rousseau stammt der Satz: „L’homme est né libre et partout il est dans les fers.“ („Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten.“) Nichtsdestoweniger ist es Rousseau gelungen, eine Erziehungs-Theorie zu erarbeiten, mit der er großen Einfluss und nachhaltige Wirkung erzielt hat. Und zwar dadurch, dass er – zunächst in der Theorie, später, indirekt und posthum, auch in der Praxis z.B. der Französischen Revolution – dem zweiten Teil des zitierten Satzes mit überzeugenden Überlegungen und Argumenten entgegengetreten ist; ohne sich allerdings um einen Nachweis der Richtigkeit des ersten Satzteils zu bemühen.
Heute weiß man, dass wir Menschen mit ererbter Willensfreiheit auf die Welt kommen, diese Freiheit im Laufe des Lebens entwickeln und erproben können – und müssen, aber vollkom-meine Freiheit nie erreichen werden, jedenfalls nicht unter den gegenwärtig herrschenden ge-sellschaftlichen Bedingungen. Außer Frage steht dennoch, dass der sinnvolle Gebrauch der Freiheit eines der obersten Ziele der Erziehung und der lebenslangen Bildung ist.
Wie die Bemühungen um die Erziehungsziele sich geschichtlich tatsächlich gestaltet haben, ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Als Lehrer und Erzieher der Menschheit nennt Rous-seau die Natur, die Menschen und die Dinge, wobei nur die Natur stets maßgeblich und ver-lässlich sei. Inzwischen weiß man aber, dass die menschliche und die außer-menschliche Natur nicht identisch sind. In beiden gibt es sowohl Freiheit als auch Determinierung, aber in unterschiedlichen Erscheinungsformen. Freiheitsgrade leiten sich in der Natur -Betrachtung z.B. aus der subatomaren Unschärferelation, aber auch aus der Tatsache ab, dass schon E-Teilchen bestrebt sind, sich mit anderen Teilchen zu neuen Konglomeraten zu verbinden. Im Übrigen bestimmen die Naturgesetze die Determinierung der Natur.
Im Menschen liegen die Dinge anders. Seit Freud kennt man die Macht des Unbewussten – aber erst seit kurzem die Grenzen dieser Macht, so durch Libet 2005 und M. Kiefer 2015. Auch rationale Faktoren aus Erfahrung, Ethik und Vernunft gehen ins Unbewusste ein. Kaum noch feststellbar ist hier, wo die Freiheit endet und die Determinierung beginnt.
Eine materielle Voraussetzung für den Erziehungsprozess ist jedenfalls die Ausreifung der entsprechenden Hirn-Areale, die aber vor dem 18. Lebensjahr kaum abgeschlossen sein dürfte. Womit die materielle, nicht aber die geistige Komponente des Erziehungsvorgangs be-nannt ist. Entscheidend für letztere ist die Entwicklung des Selbst. Und dies hat anscheinend auch Rousseau schon erkannt, als er forderte, den Heranwachsenden „stets in sich selbst und auf dasjenige aufmerksam zu erhalten, was ihn unmittelbar angeht“ (s.o. S. 4). Doch nicht schon Rousseau, sondern erst Joachim Bauer (2019) blieb es vorbehalten, im Einzelnen zu erklären, wie das Selbst entsteht und funktioniert. Wobei zu beachten ist, dass das Selbst nicht, wie Nietzsche vermeinte, mit dem Leib identisch ist, sondern in den Resonanz-Vor-gängen der Beziehungen zwischen Säuglingen bzw. Kindern und Jugendlichen einerseits und deren Bezugspersonen andererseits entsteht (s.o. S. 13 ff.). Das Selbst besteht in einem Ge-misch aus der Personalität des Individuums – als Einheit aus Leib, Seele und Geist – , dem Einfluss der Bezugspersonen und der Umwelt und der Gesamtheit der individuellen Erfahrun-gen (S. 13). Leitbild und Horizont der Erziehung sollte stets die Lebenswirklichkeit der Heranwachsenden sein.
Demgemäß sind auch Rousseaus Erziehungs-Empfehlungen neu zu bewerten, wobei zu be-achten ist, dass es Rousseau nicht gelungen ist, eine Harmonie zwischen Mensch- und Citoy-en-Sein dadurch zu erreichen, dass man einfach die „Ordnung der Natur“ auf die der Gesell-schaft überträgt. Von Rouuseaus sechs empfohlenen Erziehungs-„Maßnahmen“ (s.o. S. 4 f.) scheinen nur zwei weiterhin gültig zu sein, nämlich die erste und die dritte. Hingegen sind „Leidenschaften“ nicht nur durch körperliche bzw. sportliche Übungen, sondern auch durch Geisteskraft (Bewusstmachung, Folgenabschätzung usw.) zu besänftigen. Menschenkenntnis lässt sich nicht nur durch das Studium von Literatur und Geschichte, sondern vor allem durch persönliche Lebens-Erfahrungen erwerben. Einen Überblick über das Ganze vermag aktuell auch die Religion nicht mehr zu verschaffen, weil das Ganze einfach nicht mehr überschaubar ist. – Auch kann es nicht Aufgabe von Erzieherinnen und Erziehern sein, Lebensgefährtinnen und -gefährten für die erwachsen gewordenen Jugendlichen auszusuchen.
Im Übrigen stehen grundsätzlich wohl drei Erziehungsmethoden zur Verfügung: 1. Ne-gierend: Verzicht auf jegliche Erziehung, 2. autoritäre, 3. nicht-autoritäre Erziehung. Von diesen haben sich die beiden ersten als untauglich bzw. unzulänglich erwiesen. Nicht-autoritä-re Erziehung stößt an gesellschaftliche Grenzen; diese sind heutzutage im Wesentlichen:
a) Der Turbo-Kapitalismus,
b) Konsumismus und Spaßgesellschaft,
c) die Gefährdung der Demokratie durch rechtsextremen Populismus.
Letztere ist besonders relevant auch für den Erziehungsprozess, weil es einen notwendigen, sozusagen organisch-naturwüchsigen Zusammenhang zwischen dem Selbst, der Demokratie und der Politik gibt. Jedem Selbst steht das Recht auf Selbstbestimmung zu, ein Recht, das folglich auch jedem Volk zukommt, so dass Demokratie wesentlich auf Selbstbestimmung beruht (s.o. S. 34 f.). Was für die notwendigen Erziehungs-Empfehlungen und -Ziele ange-sichts der aktuellen Krisen Folgendes bedeutet:
1. Jegliches Lernen erfordert Aufmerksamkeit und die Anstrengung zu Werten wie „Sozialkompetenz, Selbstverantwortung, Mut, Stärke, Motivation, Kreativität und Konfliktfähigkeit zur Bewältigung zukünftiger Herausforderungen in Partnerschaft, Familie, Beruf und Gesellschaft“ (s.o. S. 20).
2. „Kinder sollen stark werden, zur Verantwortung fähig sein und mutige, selbst-aktive Mitglieder einer Gesellschaft werden, die in der Lage ist, jeden zu integrieren, zu respektieren und in seinen Grundrechten abzusichern.“ (S. 21)
3. Erziehungs-Werte: „Respekt, Wahrhaftigkeit, Fairness, Verantwortungsbewusstsein, Reife, die Fähigkeit, an etwas zu glauben“, ergänzbar z.B. durch „richtiges Handeln, Liebe und Gewaltlosigkeit“ (ebd.).
4. Grenzen ziehen durch „1. Rituale, d.h. geregelte Abläufe, 2. altersgemäßes Einfordern der Regeln, 3. Vorbild sein, 4. keine falschen Versprechungen machen, 5. auf Beloh-nungssysteme („Mohrrüben-Pädagogik“) möglichst verzichten, 6. Konsequenzen erklären und situationsgemäß umsetzen, ohne Angst einzuflößen (Urheberprinzip: „Wer etwas kaputt macht, muss dies reparieren oder ersetzen.“ …), 7. Respekt und Gerechtigkeit im Umgang. Heranwachsende haben Anspruch auf Fairness und Gleich-behandlung. Frieden und Gewaltlosigkeit im Elternhaus und in der Schule hängen davon ab.“ (S. 22)
Dies sind zugleich auch Voraussetzungen für den Erfolg lebenslanger Bildung, unbedingt zu ergänzen allerdings durch umfangreiche, stets zu aktualisierende Überlegungen zu An-thropologie, Ethik, Geschichtsphilosophie, Politik, digitalen Humanismus, Empathie, Emotionale Intelligenz u.a.m. (s.o. S. 22-52). – Neue Perspektiven eröffnen sich anschei-nend auch durch neue KI-Suchmaschinen. Allerdings sind die Vor- und Nachteile des Ein-satzes von KI in Unterricht und lebenslanger Bildung genau abzuwägen. (s.o. S. 22 ff.)
Literaturhinweise
Bauer, Joachim 2019: Wie wir werden, wer wir sind. Die Entstehung des menschlichen Selbst durch Resonanz, München
Bloch, Ernst 1977 a): Das Prinzip Hoffnung, 3 Bde., Frankfurt a.M.
Habermann, Ernst 1996: Evolution und Ethik. Skeptische Gedanken eines Ethik-Kommis-sars, in: www.geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2013/9705/pdf/GU1996_S?9_38...
Hillje, Johannes 2025: Mehr Emotionen wagen. Wie wir Angst, Hoffnung und Wut nicht dem Populismus überlassen. München
Kiefer, Markus 2015, in: Studie: Unser Wille ist freier als gedacht (2015), https://www.derstandard.at/story/2000011387060/studie-unser-wille…
Libet, Benjamin 2005: Mind Time. Wie das Gehirn Bewusstsein produziert, Frankfurt a.M.
Nida-Rümelin, Julian / Weidenfeld, Nathalie 2023: „ Was kann und darf künstliche Intelligenz? “ Ein Plädoyer für Digitalen Humanismus, München
Robra, Klaus 1991: transcodierung – vom geheimnis der bedeutungen und ihrer vermittlung, Frankfurt a.M.
Robra, Klaus 2015: Wege zum Sinn. Hamburg
Robra, Klaus 2017: Person und Materie. Vom Pragmatismus zum Demokratischen Öko-Sozialismus, München
Robra, Klaus o.J. (2020): Ethik der Verhaltenssteuerung. Eine Neubegründung, München, https://www.grin.com/document/923015
Robra, Klaus 2021: Erziehung und Lernen. Eine Problematik aus der Moderne? München, https://www.grin.com/document/1038715
Robra, Klaus 2022: Gut und Böse. Das Gute als Ursprung und Überwindung des Bösen oder umgekehrt?, München, https://www.grin.com/document/1297008
Robra, Klaus 2023: Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Menschheit. Werden posthumanistische, superintelligente Roboter den Menschen ersetzen? München, https://www.grin.com/document/1383067
Robra, Klaus 2024: Was ist der Mensch im KI-Zeitalter? Philosophische Anthropologie im 21. Jahrhundert, München, https://www.grin.com/document/1525673
[...]
1 Siegel in: https://www.socialnet.de/lexikon/Erziehungswissenschaftliche-Theorien
2 Hegel in: Grundlinien der Philosophie des Rechts, Zusatz § 174)
3 Im italienischen ‚educare‘ mit den überaus heiklen Assoziationen ‚il duca‘: ‚der Herzog‘ und ‚il Duce‘: ‚der Führer‘. Erziehung kann weder nur aristokratisch noch gar faschistisch sein!
4 Uhlig in: https://leibnizsozietaet.de/wp-content/uploads/2013/12/08_uhlig.pdf
5 Ernst Habermann: Evolution und Ethik. Skeptische Gedanken eines Ethik-Kommissars (1996), in: www.geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2013/9705/pdf/GU1996_S?9_38..., S. 31. Hervorhebungen durch mich. Vgl. Robra 2022.
6 Robra 2024, S. 36 ff.
7 In: A. Wunsch: Abschied von der Spaßpädagogik! – oder: wie nachhaltiger auf die Herausforderungen des Lebens vorbereitet werden kann. www.familienhandbuch.de/babys-kinder/erziehungsfragen/allgemein/abschiedvonderspasspaedagogik.php, S. 1
8 Konkrete Vorschläge hierzu finden sich unter: www.rtl.de/diese-werte-sollten-jedem-kind-nahegelegt-werden-4124195.html, S. 2
9 A. Bostelmann: Erziehung braucht Grenzen. www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/paedagogik/2412, S. 2
10 s. www. Fußnote Nr. 4, S. 2
11 Vgl. Susanne Stöcklin-Meier: Was im Leben wirklich zählt – mit Kindern Werte entdecken, in: www.familienhandbuch.de
12 Vgl. Robra 2021 sowie Robra o.J. (2020)
13 https://www.bnw.de/service/blog/allgemein/ki-im-unterricht-bildung-2-0-oder-gefahr-fuer-das-lernen/nd Herausforderungen: KI als Stolperfalle?
14 https://www.einfachdigitallernen.de/lehrkraefte/ki-in-der-schule-chancen-und-risiken-ein-interview-mit-ki-expertin-professorin-dr-ute-schmid/ Dr. Ute Schmid ist Professorin für Kognitive Systeme an der Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik der Universität Bamberg.
15 S. E. Lennartz in: https://bildungssprache.net/ki-nachteile-rant-kuenstliche-intelligenz-negativ/
16 UNO-Generalsekretär Guterres für Regulierungsbehörde zu KI (2023) , https://www.deutschlandfunk.de/generalsekretaer-guterres-fuer-regu...
17 UNO-Menschenrechtsrat-Resolution zu Kontrolle von KI angenommen (2023), https://www.deutschlandfunk.de/resolution-zu-kontrolle-von-ki-an... Vgl. Robra 2023, S. 41 f.
18 Vgl. Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung, S. 1392 ff.
19 Vgl. Werner Kasper: Das Ekpyrotische Universum, ferner: Robra 2017, S. 124 ff., www.abenteuer-universum.de/kosmos/ekpy/html
20 In: Ekpyrotisches Universum, Wikipedia 2015
21 Vgl. Rainer E. Zimmermann: Räume sind Schäume. Über Substanz und Materie im richtigen Verhältnis, in: VorSchein Nr. 31, Nürnberg 2011, S. 117. S. auch Robra 2015, S. 445 f.
22 ca. 2010, wie der Autor selbst mir bestätigte; vgl. www.sensortime.com/time-de.html
23 Vgl. Bloch 1977 a), S. 1297 ff.
24 Vgl. Robra 2015 , S. 479-481
25 Karlheinz A. Geißler: Alles. Gleichzeitig. Und zwar sofort. (Mit dem Untertitel: Unsere Suche nach dem pausenlosen Glück, 2004), S. 30 f., 181 ff., 179, 124, 120. S. auch Robra 2015, S. 464 ff.
26 Harald Schumann / Christiane Grefe: Der globale Countdown. Gerechtigkeit oder Selbstzerstörung – die Zukunft der Globalisierung, Köln 2009, S. 14
27 Vgl. file:///C:/Users/klaus/Downloads/Nida-R%C3%BCmelin,%20Karl%20Marx.pdf
28 Vgl. Robra 1991, S. 18 ff. (auch für das Folgende)
29 K. Robra: Kann das Leib-Seele-Problem durch einen dialektisch-materialistischen Informationsbegriff gelöst werden? in: VorSchein Nr. 30 (2008), S. 151
30 Robra, Klaus o.J. (2020), S. 202 ff.
31 In: Hillje 2025, S. 9
32 Hillje bezieht sich auf Roman Herzogs „Ruck-Rede“ vom 26. April 1997 (vgl. Hillje a.a.O. S. 235).
33 Vgl. https://www.deutschlandfunk.de/polizei-erfasst-rekordwert-an-politisch-motivierten-straftaten-100.html
34 In:https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/sicherheit/definitionssystem-pmk.pdf?__blob=publicationFile&v=2
35 https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Veranstaltungen/2001/MOE/Butterwegge.pdf
36 Bloch 1977a) S. 1568, Hervorhebungen K.R.
37 Vgl. K. Robra: Ethische Grundlagen eines Demokratischen Öko-Sozialismus, München o.J., S. 21 ff. https://www.grin.com/document/1252701. Darin auch Weiteres, u.a. zu Öko-, Natur- und Tier-Ethik.
- Quote paper
- Klaus Robra (Author), 2025, 'erziehen' oder 'educare'. Wie wir (uns) richtig erziehen können, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1586820