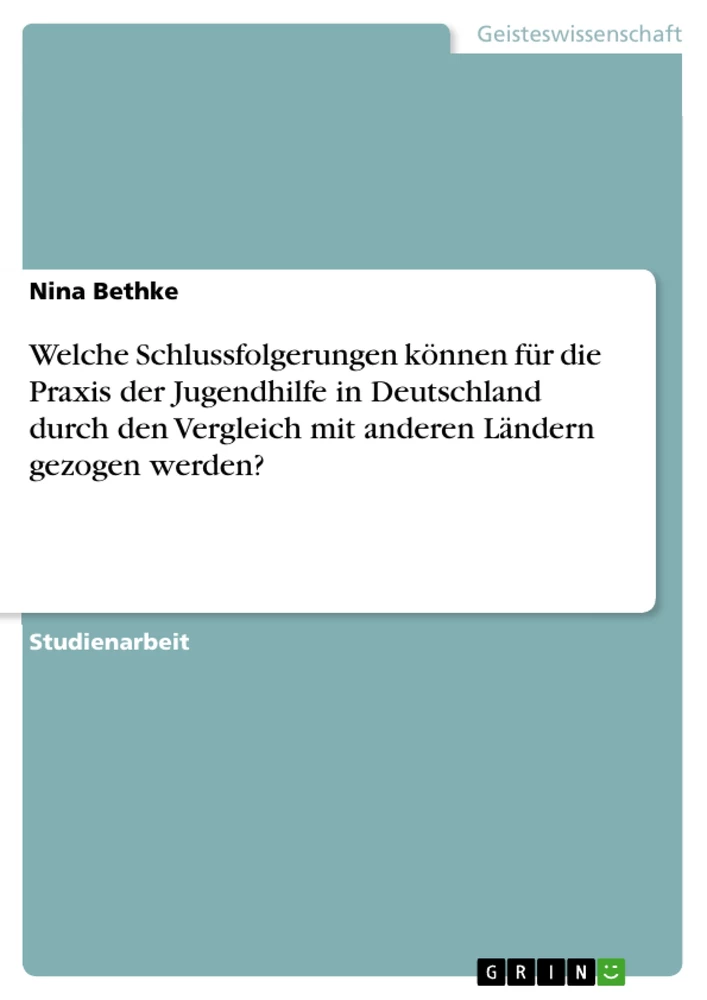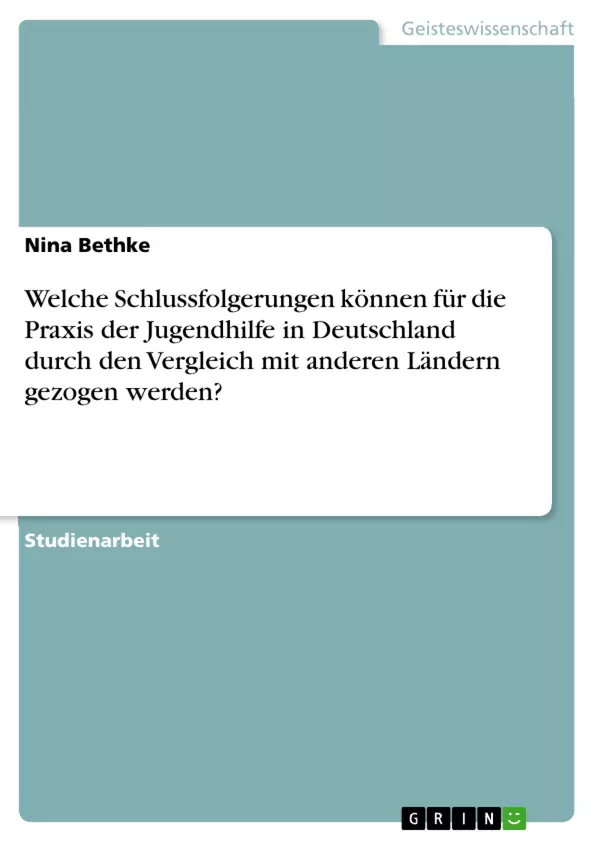Im Rahmen der Blockveranstaltung „Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland und England (Child Care in Germany and the UK)“ habe ich mich im Folgenden mit der Fragestellung: „Welche Schlussfolgerungen können für die Praxis der Ju-gendhilfe in Deutschland durch den Vergleich mit anderen Ländern gezogen werden?“ beschäftigt.
Im Zuge der immer weiter voranschreitenden Globalisierungsprozesse speziell auf europäischer Ebene ist es nachvollziehbar, dass Ansätze und Grundlagen Sozialer Arbeit im Allgemeinen und das System der Jugendhilfe im Besonderen aus dem europäischen Ausland zur Kenntnis genommen werden muss und die Fachkräfte der Sozialen Arbeit diesbezüglich offen für neue Anregungen sein sollten. Eine Schwierigkeit besteht allerdings darin, dass sich die theoretischen und praktischen Vorgehensweisen in jedem Land unterschiedlich darlegen und die Kenntnisse, die mithilfe eines Vergleichs daraus gewonnen werden sollen nicht immer sofort ersichtlich sind. Aus diesem Grund ist ein genauer Überblick und vertieftes Hintergrundwissen der zu vergleichenden Subjekte im internationalen Kontext wichtig. Im Vorfeld einer solchen Herangehensweisen an Themen der Sozialen Arbeit sollte man sich jedoch neben der Auseinandersetzung mit dem Aspekt der Relevanz einer interkulturellen Sichtweise und die damit verbundene Effektivität für die soziale Theorie und Praxis, verstärkt mit den Rahmenbe-dingungen der Jugendhilfesysteme befassen.
Aus diesem Grund werde ich im Folgenden zuerst auf die Interkulturelle Kompe-tenz als Schlüsselkompetenz der Fachkraft der Sozialen Arbeit eingehen und darlegen, aus welchen Gründen diese Fähigkeit für die Methodik des Vergleichs von Bedeutung ist. Im Anschluss daran sollen die Jugendhilfesysteme in Deutschland und in England vor allem bezüglich ihrer Organisationsstruktur be-handelt und in der Folge miteinander auf Affinitäten und Differenzen hin unter-sucht werden. Dieser Vergleich soll abschließend auf seine Relevanz und seinen Nutzen hin geprüft und unter Einbeziehung der Begrifflichkeit ‚Global Social Work‘ kritisch betrachtet werden. Das zusammenfassende Fazit beschäftigt sich schließlich mit der Beantwortung der eingangs gestellten Frage, der Bedeutung einer solchen Veranstaltung im Rahmen des Studiums der Sozialen Arbeit und einem Ausblick auf zukünftige themenbezogene Erkenntnisse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Interkulturelle Kompetenz
- Praxis der Jugendhilfe
- Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland
- Fallbeispiel Inobhutnahme Deutschland
- Child Care in England
- Fallbeispiel Kindeswohlgefährdung England
- Vergleich der Jugendhilfesysteme
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Jugendhilfe in Deutschland und England
- Relevanz eines solchen Vergleichs (Global Social Work)
- Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Vergleich der Jugendhilfesysteme in Deutschland und England. Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Systeme herauszuarbeiten und Schlussfolgerungen für die Praxis der Jugendhilfe in Deutschland zu ziehen.
- Interkulturelle Kompetenz als Schlüsselkompetenz in der Sozialen Arbeit
- Rechtliche Grundlagen und Organisationsstrukturen der Jugendhilfe in Deutschland und England
- Vergleich der Jugendhilfesysteme hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Relevanz eines solchen Vergleichs für die internationale Soziale Arbeit (Global Social Work)
- Bedeutung der interkulturellen Sichtweise für die Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor: Welche Schlussfolgerungen können für die Praxis der Jugendhilfe in Deutschland durch den Vergleich mit anderen Ländern gezogen werden? Sie erläutert die Relevanz eines interkulturellen Blickwinkels im Kontext der Globalisierungsprozesse.
Kapitel 2: Interkulturelle Kompetenz
Dieses Kapitel definiert die Interkulturelle Kompetenz als Schlüsselkompetenz für Fachkräfte der Sozialen Arbeit und verdeutlicht ihre Bedeutung für den Vergleich internationaler Sozialer Arbeit.
Kapitel 3: Praxis der Jugendhilfe
Kapitel 3 widmet sich der Praxis der Jugendhilfe in Deutschland und England. Es erläutert die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Organisationsstrukturen und wichtige Fallbeispiele beider Systeme. Dieser Vergleich soll die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Jugendhilfe in beiden Ländern aufzeigen und die Relevanz eines solchen Vergleichs im Kontext von „Global Social Work“ beleuchten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Interkulturelle Kompetenz, Jugendhilfe, Vergleichende Sozialarbeit, Global Social Work, Kindeswohlgefährdung, Inobhutnahme, Deutschland, England, KJHG, BGB, Child Care, Organisationen, Rechtliche Grundlagen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist ein internationaler Vergleich der Jugendhilfe sinnvoll?
Im Zuge der Globalisierung hilft der Blick ins Ausland, neue Impulse für die eigene Praxis zu gewinnen und die Effektivität sozialer Arbeit durch interkulturelle Perspektiven zu steigern.
Was sind die Hauptunterschiede zwischen der Jugendhilfe in Deutschland und England?
Die Unterschiede liegen vor allem in der Organisationsstruktur, den rechtlichen Grundlagen (z.B. KJHG/BGB vs. Child Care Acts) und der praktischen Herangehensweise bei Kindeswohlgefährdung.
Was bedeutet "Interkulturelle Kompetenz" für Sozialarbeiter?
Es ist eine Schlüsselkompetenz, die es Fachkräften ermöglicht, offen für andere Systeme zu sein und die Methodik des Vergleichs professionell anzuwenden.
Was verbirgt sich hinter dem Begriff "Global Social Work"?
Dieser Begriff beschreibt eine international vernetzte Soziale Arbeit, die globale Standards und länderübergreifendes Wissen nutzt, um lokale Probleme zu lösen.
Welche Fallbeispiele werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit vergleicht konkrete Abläufe bei einer Inobhutnahme in Deutschland mit den Verfahren bei Kindeswohlgefährdung in England.
- Citar trabajo
- Nina Bethke (Autor), 2010, Welche Schlussfolgerungen können für die Praxis der Jugendhilfe in Deutschland durch den Vergleich mit anderen Ländern gezogen werden?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158704