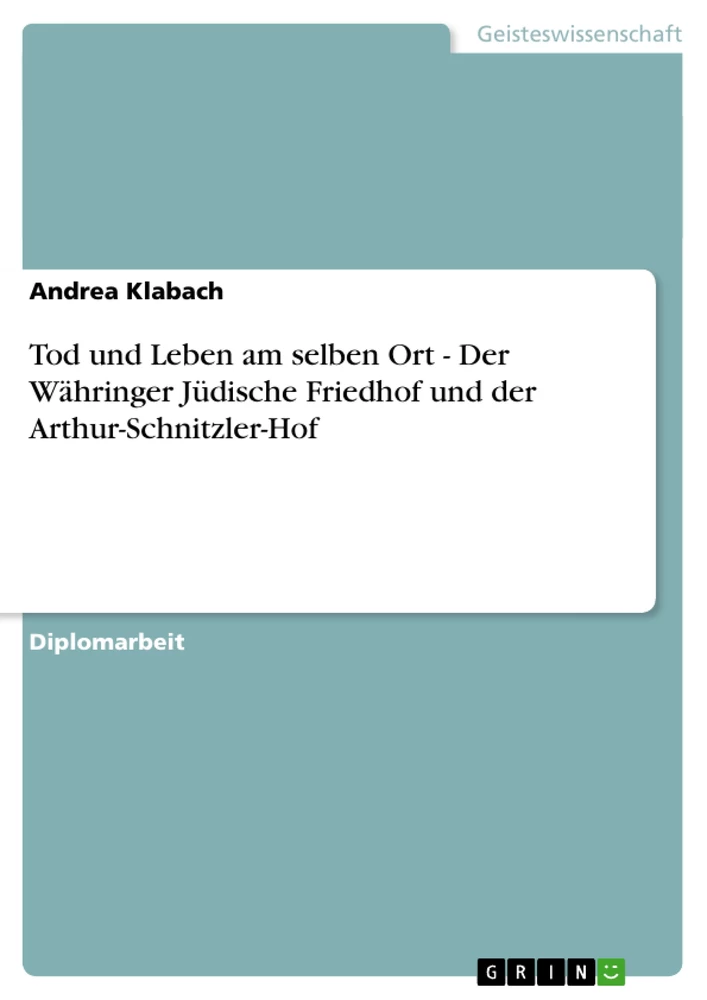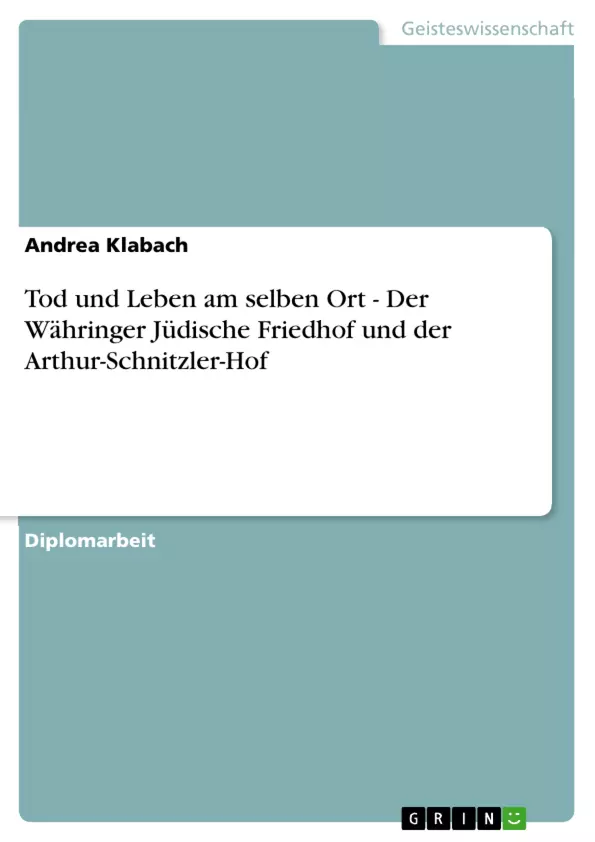Im Rahmen eines Seminars, das ich im Sommersemester 2008 am urund
frühgeschichtlichen Institut der Universität Wien besuchte, wurde
multiperspektivisch und interdisziplinär durch die kulturhistorischen
Wissenschaftsdisziplinen das Thema des Erinnerns am Ort des Währinger
Jüdischen Friedhofs behandelt. Der besseren Lesbarkeit wegen sind die
Personen geschlechtsneutral angesprochen. Die Ergebnisse des
Seminares werden zurzeit in Form einer Posterausstellung2 in
verschiedenen Institutionen und Ländern einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Aus Sicht der Europäischen Ethnologie stellte sich
für mich die Frage nach der Perspektive der Bewohner im angrenzenden
Gemeindebau, die zwar ihr Wohnhaus straßenseitig betreten, deren
Wohnräume jedoch zu einem großen Teil friedhofsseitig liegen. Richtet
man den Blick aus den in Richtung Westen gelegenen Fenstern, so
erfasst man entweder eine Mauer und Stacheldraht, wie es im
Erdgeschoß und in den unteren Stockwerken des Hauses der Fall ist, oder
es ist eine Grünfläche zu erkennen, die - lediglich durch einige verstreut
liegende Grabsteine unterbrochen – mit dem Grünwuchs am Horizont mit
dem Himmel scheinbar eins wird.3 Wie wirkt dieses Gegenüber auf die
Menschen des Schnitzlerhofes? Wer von den zu Befragenden hat je den
Friedhof betreten, der nicht frei zugänglich ist? Erst in den letzten Jahren
hat dieser Friedhof durch das Engagement der Historikerin Tina Walzer
und den Wiener Grünen4 mehr Öffentlichkeit erfahren. Was wird oder
wurde gewusst und was wird vergessen oder nicht gewusst? Wie wird das
Gegenüber der Grabstätte im Alltag der Bewohner wahrgenommen bzw.
integriert?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Arthur-Schnitzler-Hof, ein Gemeindebau
- Der Wahrnehmungsspaziergang als Methode
- WAHRNEHMUNGSSPAZIERGANG TEIL I
- Mauer – Grenze – Stacheldraht – Glassplitter
- WAHRNEHMUNGSSPAZIERGANG TEIL II
- Methoden und Vorgehen
- WAHRNEHMUNGSSPAZIERGANG TEIL III
- Die Gespräche in den Wohnungen
- Zugang zum Arthur-Schnitzler-Hof
- Erzählrichtungen
- Analyse der Erzählrichtungen
- Gewusstes Wissen – nicht gewusstes Wissen
- Analyse der Repräsentation des Wissens
- Blickrichtungen auf den Jüdischen Friedhof Währing
- Der Akteursblick auf das Gräberfeld
- Der Blick der Forscherin – mit den Augen, mit der Kamera
- Das Bild, die Fotografie als Instrument
- Der Friedhof als Forschungsfeld
- Der Friedhof Währing als historischer Ort
- Raumaneignung
- Zusammenfassende Analyse
- Die Bewohner und deren Rezeption
- Rezeption der Forscherin
- Wahrnehmungsspaziergang
- Erinnern und Vergessen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Wahrnehmung des Währinger Jüdischen Friedhofs durch die Bewohner des angrenzenden Arthur-Schnitzler-Hofes. Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Perspektiven und die Integration des Friedhofs in den Alltag der Bewohner zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der multisensorischen Erfahrung des Raumes und den individuellen Erzählungen der Bewohner.
- Die multisensorische Wahrnehmung des Friedhofsumfelds
- Die individuellen Erzählungen und Perspektiven der Bewohner des Arthur-Schnitzler-Hofes
- Der Einfluss der Geschichte des Friedhofs auf die Wahrnehmung der Bewohner
- Die Rolle des Wissens und Nicht-Wissens über den Friedhof
- Raumaneignung und die Konstruktion von Grenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Ausgangssituation: der Arthur-Schnitzler-Hof wurde auf dem Gelände des Währinger Jüdischen Friedhofs erbaut. Die Autorin beschreibt ihre Motivation, die Perspektive der Bewohner zu erforschen und ihre angewandte Methode des Wahrnehmungsspaziergangs.
Der Arthur-Schnitzler-Hof, ein Gemeindebau: Dieses Kapitel beschreibt den historischen Kontext des Gemeindebaus, seine Errichtung auf dem ehemaligen Friedhofsgelände und die sozioökonomischen Hintergründe des Wiener Gemeindebaus im Nachkriegsösterreich. Es beleuchtet die Rolle des Gemeindebaus im sozialen Wohnungsbau und den unterschiedlichen sozialen Milieus der Bewohner.
Der Wahrnehmungsspaziergang als Methode: Hier wird die gewählte Methode, der Wahrnehmungsspaziergang, detailliert erläutert. Die Autorin beschreibt die multisensorische Herangehensweise und die theoretischen Grundlagen ihrer Methodik, unter Bezugnahme auf relevante ethnographische und kulturwissenschaftliche Theorien. Sie betont den subjektiven Charakter der Wahrnehmung und die Kontextualisierung der Ergebnisse.
WAHRNEHMUNGSSPAZIERGANG TEIL I: Dieser Abschnitt dokumentiert den ersten Teil des Wahrnehmungsspaziergangs der Autorin, mit dem Fokus auf die Friedhofsmauer als physische und symbolische Grenze. Es werden Materialien, Gestaltung, und die symbolische Bedeutung der Mauer, des Stacheldrahts und der Glassplitter eingehend beschrieben und in einen historischen Kontext gesetzt (u.a. Bezug auf die Halacha).
WAHRNEHMUNGSSPAZIERGANG TEIL II: Hier setzt der Wahrnehmungsspaziergang an der Döblinger Hauptstraße fort. Die Autorin beschreibt den Kontrast zwischen dem stillen, geschlossenen Raum der Fickertgasse und der lauten Großstadt. Sie schildert eine Begegnung mit einer Passantin, die den Friedhof nicht kennt, und analysiert den Unterschiedlichen Charakter der Mauer entlang verschiedener Abschnitte.
Methoden und Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die Methoden der Datenerhebung, insbesondere die teilnehmende Beobachtung und das leitfadengestützte Interview. Die Autorin reflektiert die Herausforderungen des Zugangs zu den Bewohnern und die Entwicklung ihrer Beziehung zu den Interviewpartnern. Sie diskutiert die Rolle der Fotografie als ergänzende Methode und die ethischen Aspekte der Feldforschung.
WAHRNEHMUNGSSPAZIERGANG TEIL III: Der dritte Teil des Wahrnehmungsspaziergangs führt zur Schrottenbachgasse, dem einzigen Zugangstor zum Friedhof. Die Autorin beschreibt ihre Eindrücke vom Tor, dem Zustand des Friedhofsgebäudes, und der Atmosphäre des Ortes. Sie reflektiert ihre emotionalen Reaktionen und den Kontrast zwischen dem geschützten Raum des Friedhofs und dem öffentlichen Raum.
Die Gespräche in den Wohnungen: Dieses Kapitel präsentiert die Interviews mit drei Bewohnern des Schnitzler-Hofes. Die Autorin analysiert die Erzählrichtungen, das Wissen und Nicht-Wissen der Bewohner über den Friedhof und dessen Geschichte, und die unterschiedlichen Blickrichtungen auf den Friedhof, abhängig von der Stockwerksebene.
Der Friedhof als Forschungsfeld: Dieses Kapitel analysiert den Währinger Jüdischen Friedhof als vielschichtiges Forschungsfeld. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Friedhofs, die Zerstörung während des Nationalsozialismus, und die aktuellen Bemühungen um seine Erhaltung. Die halachische Tradition der jüdischen Bestattungskultur wird in diesem Kontext diskutiert.
Der Friedhof Währing als historischer Ort: Dieses Kapitel beschreibt die geschichtliche Entwicklung des Friedhofs vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, inklusive der Umwidmung des Geländes und der Errichtung des Arthur-Schnitzler-Hofes. Es befasst sich mit den politischen und gesellschaftlichen Kontexten und den Auswirkungen des Nationalsozialismus auf den Friedhof.
Raumaneignung: Dieses Kapitel diskutiert die Raumaneignung und die Konstruktion von Grenzen am Beispiel des Friedhofs und des Gemeindebaus. Die Autorin untersucht die physischen und symbolischen Grenzen, die die Bewohner erleben, und den Einfluss der Geschichte auf die Wahrnehmung und Aneignung des Raumes.
Zusammenfassende Analyse: Dieses Kapitel bietet eine zusammenfassende Analyse der Ergebnisse und stellt die verschiedenen Perspektiven der Bewohner gegenüber. Die Autorin reflektiert ihre eigene Rolle als Forscherin und die Herausforderungen des Forschungsprozesses.
Wahrnehmungsspaziergang: Eine detaillierte Zusammenfassung des Wahrnehmungsspaziergangs der Autorin, mit Fokus auf die multisensorischen Erfahrungen und die verschiedenen Räume und Grenzen. Die Autorin reflektiert ihre Methode und deren Potenzial für zukünftige Forschung.
Erinnern und Vergessen: Dieses Kapitel thematisiert die komplexen Prozesse des Erinnerns und Vergessens im Zusammenhang mit dem Friedhof und dem Gemeindebau. Es wird auf die verschiedenen Formen des Erinnerns eingegangen, die Rolle des kollektiven und individuellen Gedächtnisses, und der Umgang mit der Geschichte des Ortes.
Resümee: Das Resümee fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Währinger Jüdischer Friedhof, Arthur-Schnitzler-Hof, Gemeindebau, Wahrnehmungsspaziergang, qualitative Forschung, Erinnerungsorte, kollektives Gedächtnis, Nationalsozialismus, Holocaust, Halacha, Raumaneignung, Grenzziehung, multisensorische Wahrnehmung, Interview, Fotografie, Erinnern, Vergessen.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Wahrnehmung des Währinger Jüdischen Friedhofs durch die Bewohner des Arthur-Schnitzler-Hofes
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Wahrnehmung des Währinger Jüdischen Friedhofs durch die Bewohner des angrenzenden Arthur-Schnitzler-Hofes. Sie beleuchtet die verschiedenen Perspektiven und die Integration des Friedhofs in den Alltag der Bewohner, mit Fokus auf die multisensorische Erfahrung des Raumes und die individuellen Erzählungen.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die zentrale Methode ist der Wahrnehmungsspaziergang, eine multisensorische Herangehensweise, die die subjektive Wahrnehmung betont. Ergänzt wird dies durch teilnehmende Beobachtung und leitfadengestützte Interviews mit Bewohnern des Arthur-Schnitzler-Hofes. Fotografie diente als ergänzende Methode zur Dokumentation.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die multisensorische Wahrnehmung des Friedhofsumfelds, die individuellen Erzählungen der Bewohner, den Einfluss der Geschichte des Friedhofs auf deren Wahrnehmung, die Rolle des Wissens und Nicht-Wissens, Raumaneignung und die Konstruktion von Grenzen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Einleitung, Beschreibung des Arthur-Schnitzler-Hofes, Erläuterung der Methode (Wahrnehmungsspaziergang), drei Teile des Wahrnehmungsspaziergangs, die Analyse der Bewohnerinterviews, Kapitel zum Friedhof als Forschungsfeld (inklusive Geschichte und Halacha), Raumaneignung, eine zusammenfassende Analyse, Abschnitte zu Erinnerung und Vergessen, und schließlich ein Resümee. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die unterschiedlichen Perspektiven der Bewohner auf den Friedhof, analysiert deren Wissen und Nicht-Wissen über seine Geschichte, und untersucht die Raumaneignung und die Konstruktion von Grenzen. Die Autorin reflektiert ihre eigene Rolle als Forscherin und die Herausforderungen des Forschungsprozesses.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Währinger Jüdischer Friedhof, Arthur-Schnitzler-Hof, Gemeindebau, Wahrnehmungsspaziergang, qualitative Forschung, Erinnerungsorte, kollektives Gedächtnis, Nationalsozialismus, Holocaust, Halacha, Raumaneignung, Grenzziehung, multisensorische Wahrnehmung, Interview, Fotografie, Erinnern, Vergessen.
Was ist der historische Kontext?
Der Arthur-Schnitzler-Hof wurde auf dem Gelände des Währinger Jüdischen Friedhofs erbaut. Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext des Gemeindebaus, seine Errichtung auf dem ehemaligen Friedhofsgelände, die sozioökonomischen Hintergründe, und die Geschichte des Friedhofs selbst, inklusive seiner Zerstörung während des Nationalsozialismus.
Welche ethischen Aspekte werden berücksichtigt?
Die Autorin reflektiert die ethischen Aspekte der Feldforschung, insbesondere den Zugang zu den Bewohnern und den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu den Interviewpartnern.
- Citar trabajo
- Andrea Klabach (Autor), 2010, Tod und Leben am selben Ort - Der Währinger Jüdische Friedhof und der Arthur-Schnitzler-Hof, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158746