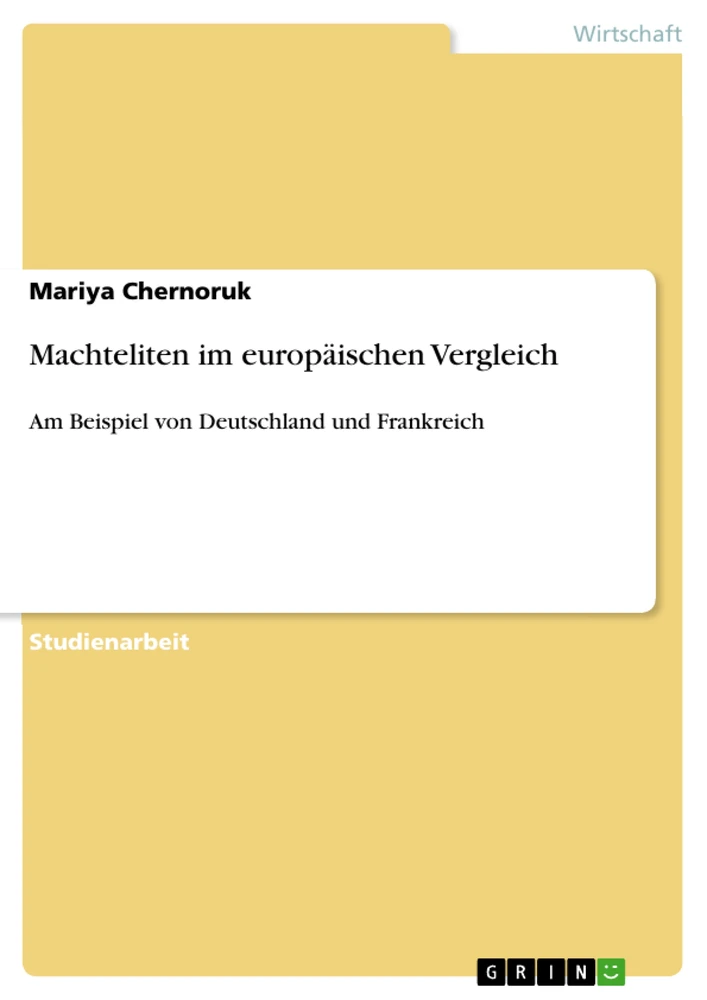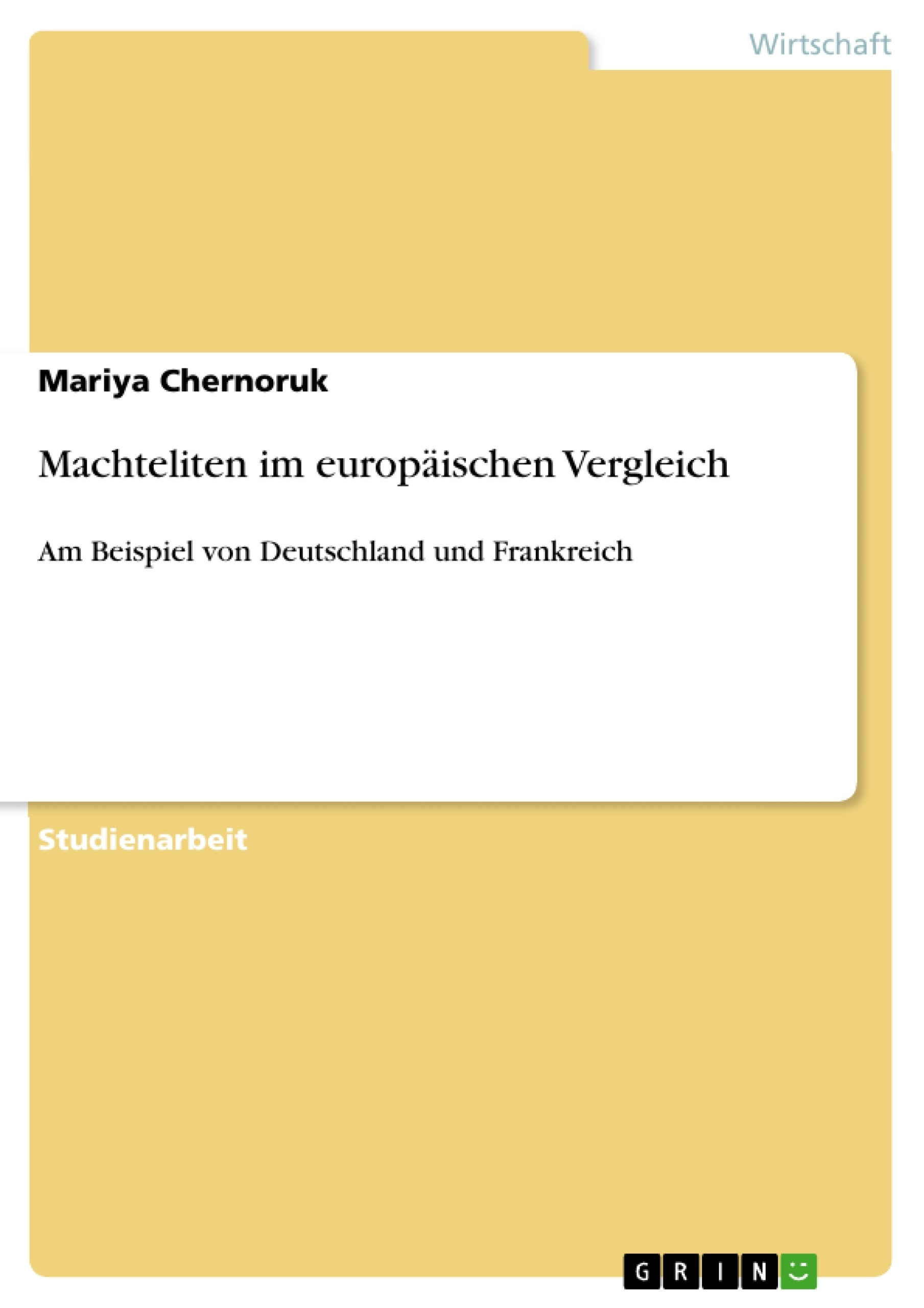Die immer stärker zunehmende Kluft zwischen und Arm Reich in Europa fordert eine Antwort darauf, wer wirklich in der Lage ist, diese Entwicklung mit seinen Entschei-dungen spürbar zu steuern. Bekanntlich haben politische Machteliten einen direkten Einfluss auf die Gesetzgebung wie beispielsweise die Steuererhöhung oder die Einfüh-rung von Studiengebühren. Nutzen sie ihre gesellschaftliche Position ausschließlich für ihre eigenen Vorteile? Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Elitestruktur und der sozialen Ungleichheit eines Landes? Die Behandlung dieser Fragen ist der zentrale Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
Einen interessanten Ansatz bietet die Theorie der Neomachiavelisten, die allerdings in dieser Arbeit nicht weiter vertieft werden soll. Sie stellt eine der beiden wesentlichen existierenden Theorien der soziologischen Elitenforschung dar, in deren Zentrum politische Führer und deren Machtausübung stehen. Diese Theorie, zu deren Vertretern Robert Michels, Charles Mills und Pierre Bourdieu gehören, besagt unter anderem, dass die Machthabenden nicht ausschließlich zum Wohle der Masse regieren, sondern zur Vermehrung des eigenen Reichtums.
Zur Klärung der oben aufgeworfenen Fragen wird in der vorliegenden Arbeit im Kapitel 3 ein Vergleich der Elitenstruktur Deutschlands mit der Frankreichs vorgenommen. Dieser erfolgt anhand von Kriterien wie der Rekrutierung, Homogenität sowie der Zusammensetzung und Mobilität der Eliten. Es wird näher darauf eingegangen, aus welcher sozialen Schicht die Mitglieder der politischen Führung stammen. Jedoch ist zuvor eine Auseinandersetzung mit dem Elitebegriff und den Elitearten für das weitere Verständnis der Arbeit in Kapitel 2 notwendig. Anschließend wird in Kapitel 4 das Ausmaß der sozialen Differenzen in Deutschland und Frankreich mit Hilfe eines Vergleichs der Vermögensverteilung in den ausgewählten Ländern näher betrachtet. Die gewonnenen Schlussfolgerungen schlagen sich ebenfalls in Kapitel 4 nieder, in dem die soziale Ungleichheit in einen Zusammenhang mit der Elitenstruktur gebracht wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was sind Eliten?
- Definition
- Elitearten
- Vergleich politischer Machteliten
- Historische Betrachtung
- Deutschland
- Frankreich
- Homogenität der Elitenstruktur
- Rekrutierung der Eliten
- Frankreich
- Deutschland
- Mobilität
- Frankreich
- Deutschland
- Elitenmacht und soziale Ungleichheit
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die politische Elitenstruktur in Deutschland und Frankreich im europäischen Vergleich. Sie beleuchtet die Rekrutierung, Homogenität, Zusammensetzung und Mobilität der Eliten. Darüber hinaus wird der Zusammenhang zwischen Elitenmacht und sozialer Ungleichheit analysiert.
- Vergleich der Elitenstruktur in Deutschland und Frankreich
- Analyse der Rekrutierung und Mobilität von Eliten
- Untersuchung der Homogenität der Elitenstruktur
- Beziehung zwischen Elitenmacht und sozialer Ungleichheit
- Bedeutung der Eliten für die Gestaltung der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas der politischen Eliten im Kontext zunehmender sozialer Ungleichheit in Europa heraus. Sie führt den Leser in die Thematik ein und benennt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit.
Was sind Eliten?
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Elite und stellt verschiedene Elitearten vor. Es dient als Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel, die sich mit der Analyse von politischen Machteliten in Deutschland und Frankreich befassen.
Vergleich politischer Machteliten
Der Vergleich der politischen Elitenstrukturen in Deutschland und Frankreich umfasst historische Betrachtungen, die Homogenität der Elitenstrukturen, die Rekrutierung der Eliten und die Mobilität innerhalb der Eliten.
Elitenmacht und soziale Ungleichheit
Dieses Kapitel untersucht die Beziehung zwischen Elitenmacht und sozialer Ungleichheit anhand der Vermögensverteilung in Deutschland und Frankreich. Es beleuchtet die Auswirkungen der Elitenstruktur auf die soziale Ungleichheit in den beiden Ländern.
Schlüsselwörter
Politische Eliten, Machteliten, Rekrutierung, Homogenität, Mobilität, soziale Ungleichheit, Deutschland, Frankreich, Europa.
Häufig gestellte Fragen
Was sind politische Machteliten?
Machteliten sind Personen in Schlüsselpositionen, die direkten Einfluss auf die Gesetzgebung und die gesellschaftliche Steuerung eines Landes haben.
Wie unterscheiden sich die Eliten in Deutschland und Frankreich?
Die Arbeit vergleicht Kriterien wie Rekrutierung, Homogenität und Mobilität, wobei in Frankreich oft ein exklusiverer Rekrutierungsweg über Elitehochschulen (Grandes Écoles) besteht.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Eliten und sozialer Ungleichheit?
Ja, die Arbeit untersucht, ob die Herkunft der Eliten aus bestimmten sozialen Schichten die Vermögensverteilung und soziale Mobilität eines Landes beeinflusst.
Was besagt die Theorie der Neomachiavelisten?
Diese Theorie geht davon aus, dass Eliten Macht vorrangig zur Vermehrung des eigenen Reichtums und Status ausüben und nicht ausschließlich zum Wohle der Allgemeinheit.
Was versteht man unter Elitenmobilität?
Sie beschreibt, wie durchlässig eine Elite für Aufsteiger aus niedrigeren sozialen Schichten ist oder ob die Machtpositionen innerhalb bestimmter Kreise vererbt werden.
- Quote paper
- Mariya Chernoruk (Author), 2009, Machteliten im europäischen Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158837