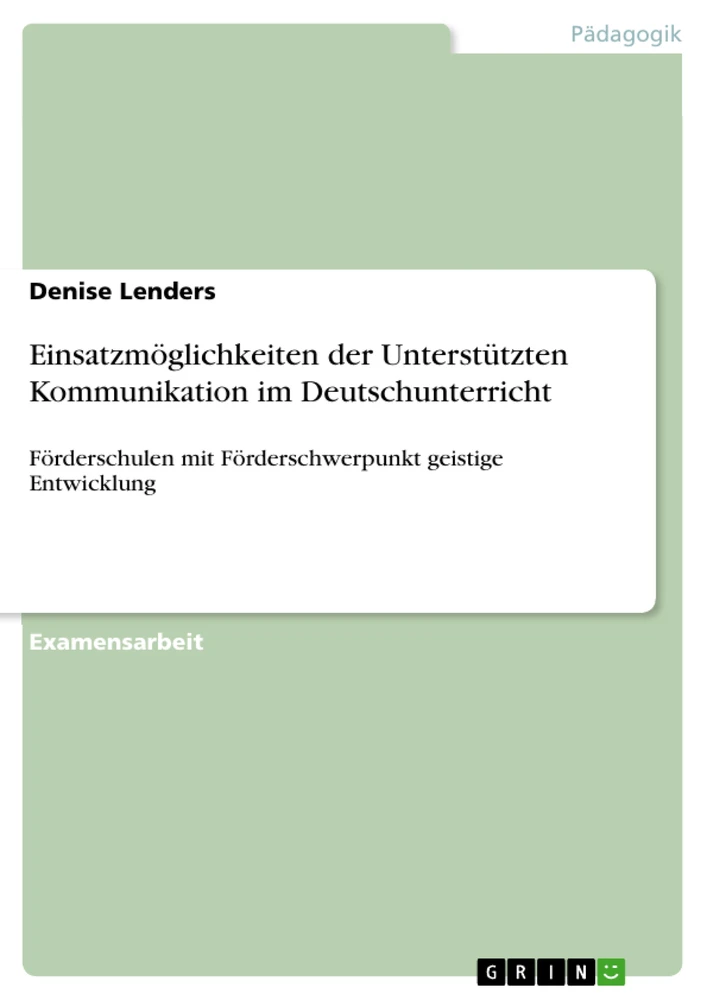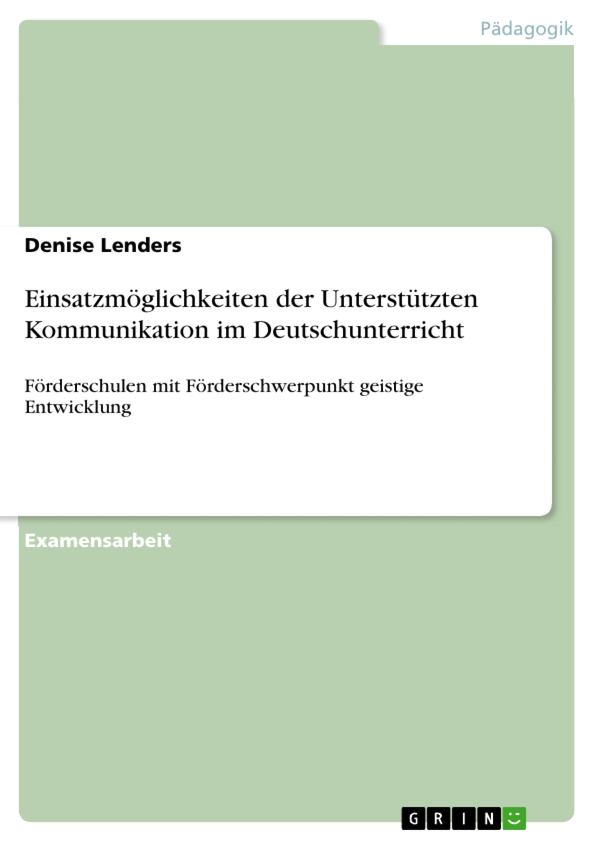Kommunikation ist in der Gesellschaft ein natürliches Grundbedürfnis zum einem und stellt dieselbe als einen signifikanten Teil der Integration dar. Des Weiteren trägt sie zur individuellen Entwicklung bei und formt dementsprechend die Identität. Wichtig bleibt zu beachten, dass die menschliche Kommunikation nicht ausschließlich auf verbaler Ebene von statten geht, sondern ebenso die nonverbalen Ausdrücke wie Gestik und Mimik bedeutsam sind. Um es mit den Worten Paul Watzlawicks (1974) zu verdeutlichen: "Man kann nicht nicht kommunizieren." Für Menschen, welche eingeschränkt bis gar nicht verbal kommunizieren können, stellt sich die Kommunikation zum einen als Schlüssel und zum anderen als Barriere dar. Mit Fokus auf den schulischen Bereich ist Kommunikation immer ein wesentlicher Schwerpunkt für das alltägliche Unterrichtsgeschehen. Speziell auf den Deutschunterricht übertragen ist Sprache hier als Unterrichtsmedium sowie als Lehrgegenstand zu betrachten. Die Praxis zeigt auf, dass die unterstützenden Angebote nicht uneingeschränkt und in jeder Situation unmittelbar einsetzbar sind. Vielmehr kann Unterstützte Kommunikation Austauschprozesse im Klassenzimmer auch behindern. Die Arbeit zeigt mittels Experteninterviews wie die Unterstützte Kommunikation im Deutschunterricht sinnvoll eingesetzt werden kann, um eine Kommunikation anzuregen und nicht ausschließlich als Frage-Antwort-Phänomen genutzt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition „geistige Behinderung“
- Rahmungen und Lehrplan Deutsch für Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Körpersprache
- Unterstützte Kommunikation - Standortbestimmung, theoretische Rahmungen und Interventionsmodell
- Zielgruppen der Unterstützten Kommunikation
- Zielsetzung der Unterstützten Kommunikation
- Körpereigene Kommunikationsformen
- Nichtelektronische Kommunikationsformen
- Elektronische Kommunikationsformen
- Einsatz der Unterstützten Kommunikation in Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Einzelförderung
- Unterrichtsbezogener Einsatz
- Modelling - Grundsätzliches
- Methodik
- Das Experten- und Expertinneninterview
- Leitfadenerarbeitung und Interviewinhalt
- Interviewauswertung
- Unterrichtsbeobachtung
- Ergebnisse
- Kategoriensystem
- Anwendung Unterstützter Kommunikation
- Einsatzmöglichkeiten
- Voraussetzung der Unterstützten Kommunikation
- Zusammenfassung der Beobachtungen
- Diskussion
- Methodendiskussion
- Ergebnisdiskussion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht die Einsatzmöglichkeiten Unterstützter Kommunikation (UK) im Deutschunterricht für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen der UK zu beleuchten und deren praktische Anwendung im schulischen Kontext zu analysieren. Die Arbeit stützt sich auf Interviews mit Expertinnen und Experten sowie Unterrichtsbeobachtungen.
- Begriffsdefinition und theoretische Grundlagen der geistigen Behinderung
- Theoretische und praktische Rahmungen Unterstützter Kommunikation
- Analyse verschiedener UK-Methoden und -Technologien
- Evaluierung des Einsatzes von UK in der Praxis
- Diskussion der methodischen Vorgehensweise und der Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung von Kommunikation als Grundbedürfnis und Grundrecht und führt in die Thematik der Unterstützten Kommunikation (UK) für Schüler*innen mit geistiger Behinderung ein. Sie verweist auf die Notwendigkeit, Kommunikationsbarrieren zu reduzieren und den Zugang zu Kommunikation für alle zu ermöglichen. Das Zitat von Williams unterstreicht die Wichtigkeit vielfältiger Kommunikationsformen.
Begriffsdefinition „geistige Behinderung“: Dieses Kapitel liefert eine präzise Definition des Begriffs „geistige Behinderung“, legt die diagnostischen Kriterien dar und differenziert die verschiedenen Ausprägungen und deren Auswirkungen auf die Kommunikation. Es dient als Grundlage für das Verständnis der Zielgruppe und der Herausforderungen im Unterricht.
Rahmungen und Lehrplan Deutsch für Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Dieser Abschnitt beschreibt den rechtlichen Rahmen und die curricularen Vorgaben für den Deutschunterricht an Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung. Er analysiert die spezifischen Lehrplaninhalte und deren Implikationen für die Anwendung von UK.
Körpersprache: Das Kapitel untersucht die Bedeutung nonverbaler Kommunikation, insbesondere der Körpersprache, im Kontext der geistigen Behinderung. Es analysiert die verschiedenen Aspekte der nonverbalen Kommunikation und deren Rolle im Unterricht, um ein umfassendes Verständnis für die Kommunikationsprozesse zu entwickeln.
Unterstützte Kommunikation - Standortbestimmung, theoretische Rahmungen und Interventionsmodell: Dieser zentrale Teil der Arbeit befasst sich ausführlich mit der Unterstützten Kommunikation. Er beschreibt verschiedene Zielgruppen, die Zielsetzung und diverse UK-Methoden (körpereigene, nichtelektronische und elektronische Formen). Das Kapitel legt verschiedene theoretische Modelle und Interventionen dar, um einen fundierten Überblick über die UK zu geben.
Einsatz der Unterstützten Kommunikation in Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Dieses Kapitel untersucht den praktischen Einsatz der UK in der Schule, sowohl in der Einzelförderung als auch im unterrichtsbezogenen Kontext. Es beschreibt konkrete Beispiele und analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten der Implementierung von UK in unterschiedlichen Unterrichtssettings.
Modelling - Grundsätzliches: Dieser Abschnitt beschreibt die grundlegenden Prinzipien des Modelllernens (Modelling) als Methode der Unterstützten Kommunikation. Es werden die wichtigsten Aspekte und deren Bedeutung für den Lernerfolg von Schüler*innen mit geistiger Behinderung erläutert.
Methodik: Das Kapitel erläutert die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es beschreibt detailliert die Durchführung der Experteninterviews, die Entwicklung des Interviewleitfadens, die Auswertungsmethode und die Kriterien der Unterrichtsbeobachtung. Dieser Teil stellt die wissenschaftliche Fundiertheit der Arbeit sicher.
Ergebnisse: Hier werden die Ergebnisse der Interviews und Unterrichtsbeobachtungen präsentiert und anhand eines Kategoriensystems analysiert. Der Abschnitt beschreibt die Anwendung der UK, die Einsatzmöglichkeiten und die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz im Unterricht.
Schlüsselwörter
Unterstützte Kommunikation, geistige Behinderung, Förderschule, Inklusion, Deutschunterricht, Kommunikation, nonverbale Kommunikation, Interview, Unterrichtsbeobachtung, Modelllernen, elektronische Kommunikationsmittel, nichtelektronische Kommunikationsmittel.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht die Einsatzmöglichkeiten Unterstützter Kommunikation (UK) im Deutschunterricht für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.
Was sind die Hauptziele dieser Arbeit?
Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen der UK zu beleuchten und deren praktische Anwendung im schulischen Kontext zu analysieren. Die Arbeit stützt sich auf Interviews mit Expertinnen und Experten sowie Unterrichtsbeobachtungen.
Welche Themenschwerpunkte werden in dieser Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte:
- Begriffsdefinition und theoretische Grundlagen der geistigen Behinderung
- Theoretische und praktische Rahmungen Unterstützter Kommunikation
- Analyse verschiedener UK-Methoden und -Technologien
- Evaluierung des Einsatzes von UK in der Praxis
- Diskussion der methodischen Vorgehensweise und der Ergebnisse
Was ist Unterstützte Kommunikation (UK)?
Unterstützte Kommunikation (UK) umfasst verschiedene Methoden und Technologien, die Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen helfen, sich auszudrücken und zu verstehen. Dazu gehören körpereigene, nichtelektronische und elektronische Kommunikationsformen.
Welche Methoden wurden zur Erstellung dieser Arbeit verwendet?
Zur Erstellung dieser Arbeit wurden Experteninterviews und Unterrichtsbeobachtungen durchgeführt. Die Interviews wurden mit einem Leitfaden strukturiert und die Ergebnisse anhand eines Kategoriensystems ausgewertet.
Welche Kapitel sind in dieser Arbeit enthalten?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel:
- Einleitung
- Begriffsdefinition „geistige Behinderung“
- Rahmungen und Lehrplan Deutsch für Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Körpersprache
- Unterstützte Kommunikation - Standortbestimmung, theoretische Rahmungen und Interventionsmodell
- Einsatz der Unterstützten Kommunikation in Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Modelling - Grundsätzliches
- Methodik
- Ergebnisse
- Diskussion
- Fazit
Was wird im Kapitel "Begriffsdefinition „geistige Behinderung“" behandelt?
Dieses Kapitel liefert eine präzise Definition des Begriffs „geistige Behinderung“, legt die diagnostischen Kriterien dar und differenziert die verschiedenen Ausprägungen und deren Auswirkungen auf die Kommunikation.
Was wird im Kapitel "Rahmungen und Lehrplan Deutsch für Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung" behandelt?
Dieser Abschnitt beschreibt den rechtlichen Rahmen und die curricularen Vorgaben für den Deutschunterricht an Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung. Er analysiert die spezifischen Lehrplaninhalte und deren Implikationen für die Anwendung von UK.
Welche Rolle spielt die Körpersprache im Kontext der geistigen Behinderung?
Die Körpersprache ist ein wichtiger Aspekt der nonverbalen Kommunikation und wird im Kontext der geistigen Behinderung untersucht, um ein umfassendes Verständnis für die Kommunikationsprozesse zu entwickeln.
Was sind die Hauptergebnisse dieser Arbeit?
Die Ergebnisse der Interviews und Unterrichtsbeobachtungen werden präsentiert und anhand eines Kategoriensystems analysiert. Der Abschnitt beschreibt die Anwendung der UK, die Einsatzmöglichkeiten und die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz im Unterricht.
Was bedeutet Modelling im Kontext der Unterstützten Kommunikation?
Modelling beschreibt die grundlegenden Prinzipien des Modelllernens als Methode der Unterstützten Kommunikation. Es werden die wichtigsten Aspekte und deren Bedeutung für den Lernerfolg von Schüler*innen mit geistiger Behinderung erläutert.
Welche Schlüsselwörter sind mit dieser Arbeit verbunden?
Unterstützte Kommunikation, geistige Behinderung, Förderschule, Inklusion, Deutschunterricht, Kommunikation, nonverbale Kommunikation, Interview, Unterrichtsbeobachtung, Modelllernen, elektronische Kommunikationsmittel, nichtelektronische Kommunikationsmittel.
- Quote paper
- Denise Lenders (Author), 2023, Einsatzmöglichkeiten der Unterstützten Kommunikation im Deutschunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1588519