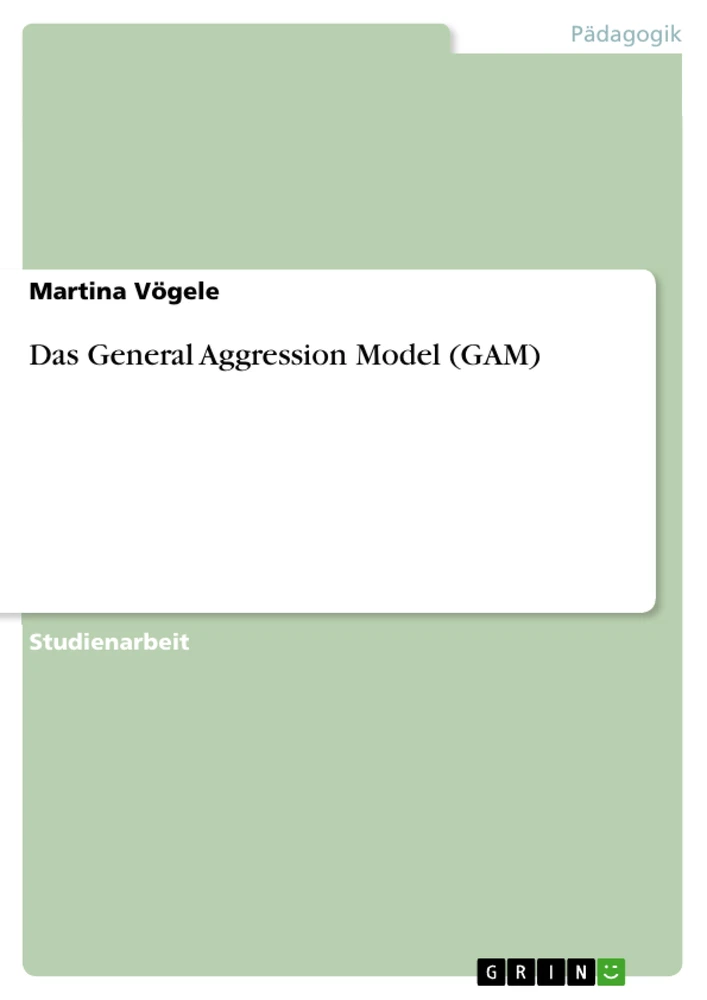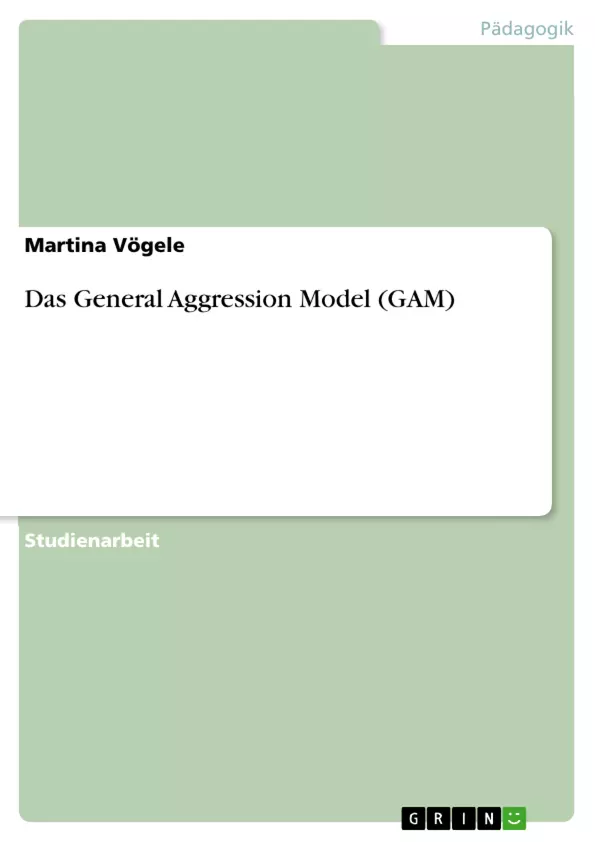Aggressivität von Kindern und Jugendlichen wird heutzutage häufig mit dem Konsum von neuen Medien in Verbindung gebracht. Dabei wurde bereits Mitte des letzten Jahrhunderts die Auswirkung von Gewalt im Fernsehen auf Kinder und Jugendliche in ersten Studien untersucht (Hopf, 2004). Allerdings haben Medien heutzutage neue Dimensionen erhalten, da sie zum einen deutlich leichter für Kinder und Jugendliche zugänglich sind, zum anderen neue Komponenten bei der Mediennutzung hinzu gekommen sind. Während beim Fernsehen der Rezipient ausschließlich konsumiert, ist er beim Computer – sei es beim Spielen oder beim Surfen im Internet – nicht ausschließlich Rezipient sondern auch Mitspieler und Mitgestalter. Damit ist er am Geschehen auf dem Bildschirm unmittelbar beteiligt. Beim Computerspiel ist es zum Beispiel die Entscheidung des Spielers wie er in das Geschehen der Geschichte, welche auf seinem Bildschirm abläuft, eingreifen möchte, mit wem er kooperiert und welche Strategie er verfolgt. Auch bei der Nutzung des Internets hat der Nutzer deutlich mehr Einfluss auf die Inhaltsauswahl als bei einem Film, da das Angebot riesig und unmittelbar abrufbar ist. Die Erfahrung von Gewalt kann somit deutlich direkter ausfallen, als bei dem Konsum eines Gewalt verherrlichenden Filmes.
Diese Tatsache ist für die Bewertung des Einflusses der Medien auf die Gewaltbereitschaft von Jugendlichen insofern ein Problem, dass die Dimension des Akteurs bei früheren Erklärungsmodellen zum Teil außer acht gelassen wurde. Um der Komplexität des Themas der Entstehung von Gewalt besser Rechnung tragen zu können entwickelten Anderson und Bushmann das so genannte General Aggression Model (im folgenden Text mit GAM abgekürzt) (Anderson & Bushman, 2002).
Diese Arbeit wird im folgenden Kapitel zunächst das GAM darstellen und erläutern.
Im Anschluss daran werden Untersuchungen zum Thema Aggression bei Computerspie-lern vorgestellt, welche auf das GAM zurückgreifen. Da das GAM für sich in Anspruch nimmt, ein universelles Modell zur Erklärung der Entstehung von Gewalt zu sein, wird dieser Aspekt ebenfalls mit aufgegriffen.
Zuletzt erfolgt die kritische Bewertung des Modells gefolgt von einem abschließenden Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das General Aggression Model
- 2.1 Das Basismodell
- 2.2 Langfristige Auswirkungen von gewalthaltigem Medienkonsum
- 3 Einsatzgebiete und Erkenntnisse des GAM
- 3.1 Untersuchungen zu Aggression bei Computerspielern
- 3.2 Wirkung von Mediengewalt und Lebenswelt
- 4 Grenzen des GAM
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das General Aggression Model (GAM) als Rahmenmodell zur Erklärung der Entstehung von Aggression, insbesondere im Kontext von Medienkonsum bei Kindern und Jugendlichen. Das Augenmerk liegt auf der Integration verschiedener Theorien und der Anwendung des GAM auf aktuelle Medien wie Computerspiele und Internet. Die Arbeit beleuchtet sowohl die Stärken als auch die Grenzen des Modells.
- Das General Aggression Model (GAM) als integratives Modell zur Erklärung von Aggression
- Der Einfluss von gewalthaltigen Medieninhalten auf die Aggression
- Die Rolle von Computerspielen und Internet in der Entstehung von Aggression
- Untersuchungen zur Aggression bei Computerspielern im Kontext des GAM
- Grenzen und Kritikpunkte des GAM
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt den Zusammenhang zwischen Medienkonsum und Aggressivität bei Kindern und Jugendlichen her. Sie hebt die Unterschiede zwischen traditionellen Medien wie Fernsehen und neuen Medien wie Computerspiele und Internet hervor, wobei letztere eine aktivere Beteiligung des Nutzers ermöglichen und somit den Einfluss von Gewalt direkter gestalten. Die Entwicklung des General Aggression Models (GAM) als Reaktion auf die Komplexität dieses Themas wird als zentrale Motivation der Arbeit genannt.
2 Das General Aggression Model: Dieses Kapitel beschreibt das GAM als integratives Modell, das bestehende Theorien wie den kognitiv-physiologischen Ansatz, die Lerntheorie und die Skript-Theorie vereint. Es wird betont, dass das GAM die Entstehung von Gewalt aus multiplen Ursachen erklärt, im Gegensatz zu Modellen, die sich nur auf eine einzelne Ursache konzentrieren. Die Autoren des GAM heben die Vorteile der ganzheitlichen Betrachtungsweise für die Entwicklung effektiver Strategien zur Bekämpfung von aggressivem Verhalten hervor.
Schlüsselwörter
General Aggression Model (GAM), Mediengewalt, Aggression, Computerspiele, Internet, Kinder, Jugendliche, Medienkonsum, Gewaltdarstellung, kognitiv-physiologischer Ansatz, Lerntheorie, integratives Modell.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: "Das General Aggression Model (GAM)"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über das General Aggression Model (GAM). Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Anwendung des GAM zur Erklärung von Aggression, insbesondere im Kontext von Medienkonsum bei Kindern und Jugendlichen, unter Berücksichtigung von traditionellen und neuen Medien wie Computerspielen und Internet.
Was ist das General Aggression Model (GAM)?
Das GAM ist ein integratives Modell, das verschiedene Theorien (kognitiv-physiologischer Ansatz, Lerntheorie, Skript-Theorie) vereint, um die Entstehung von Aggression zu erklären. Im Gegensatz zu Modellen, die sich auf eine einzelne Ursache konzentrieren, berücksichtigt das GAM multiple Faktoren und bietet somit eine ganzheitliche Betrachtungsweise.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende zentrale Themen: Das GAM als integratives Modell, den Einfluss gewalthaltiger Medieninhalte auf Aggression, die Rolle von Computerspielen und Internet bei der Entstehung von Aggression, Untersuchungen zur Aggression bei Computerspielern im Kontext des GAM und die Grenzen und Kritikpunkte des GAM.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument umfasst folgende Kapitel: Einleitung (Zusammenhang Medienkonsum und Aggressivität, Einführung des GAM), Das General Aggression Model (Beschreibung des Modells und seiner integrativen Natur), Einsatzgebiete und Erkenntnisse des GAM (Untersuchungen zu Aggression bei Computerspielern und die Wirkung von Mediengewalt im Kontext der Lebenswelt), Grenzen des GAM und Fazit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: General Aggression Model (GAM), Mediengewalt, Aggression, Computerspiele, Internet, Kinder, Jugendliche, Medienkonsum, Gewaltdarstellung, kognitiv-physiologischer Ansatz, Lerntheorie, integratives Modell.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Die Zielsetzung des Dokuments ist die Untersuchung des GAM als Rahmenmodell zur Erklärung der Entstehung von Aggression, insbesondere im Kontext von Medienkonsum bei Kindern und Jugendlichen. Es soll die Integration verschiedener Theorien und die Anwendung des GAM auf aktuelle Medien beleuchtet werden, sowie Stärken und Schwächen des Modells aufgezeigt werden.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Wissenschaftler, Studenten und alle Interessierten, die sich mit den Themen Aggression, Medienkonsum, insbesondere im Kontext von Kindern und Jugendlichen, und dem General Aggression Model auseinandersetzen.
- Citation du texte
- Martina Vögele (Auteur), 2010, Das General Aggression Model (GAM), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159027