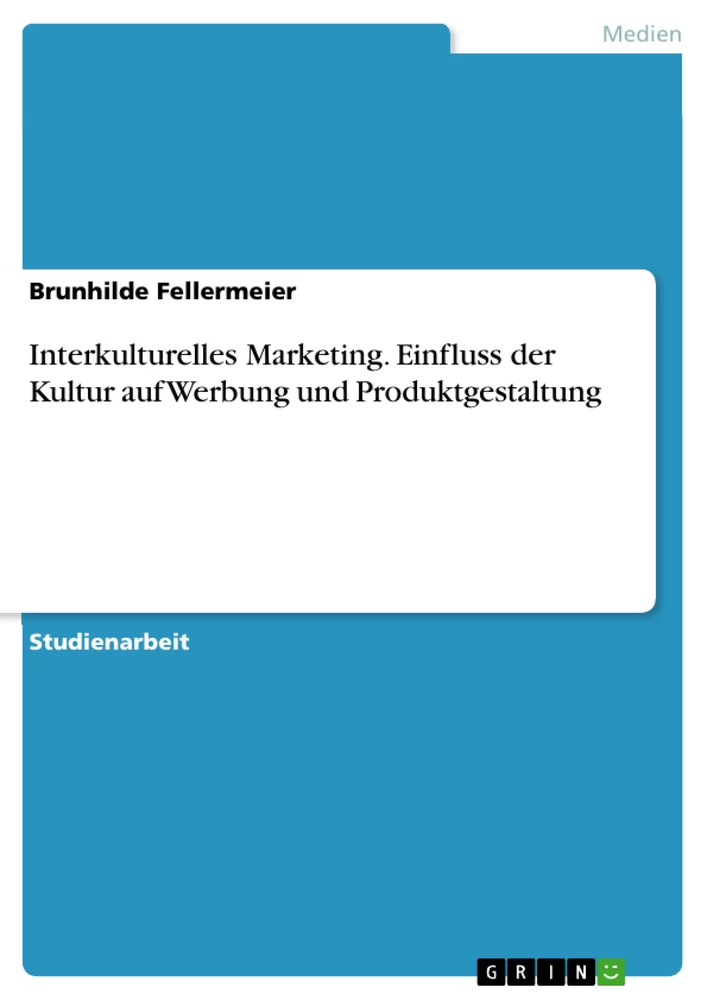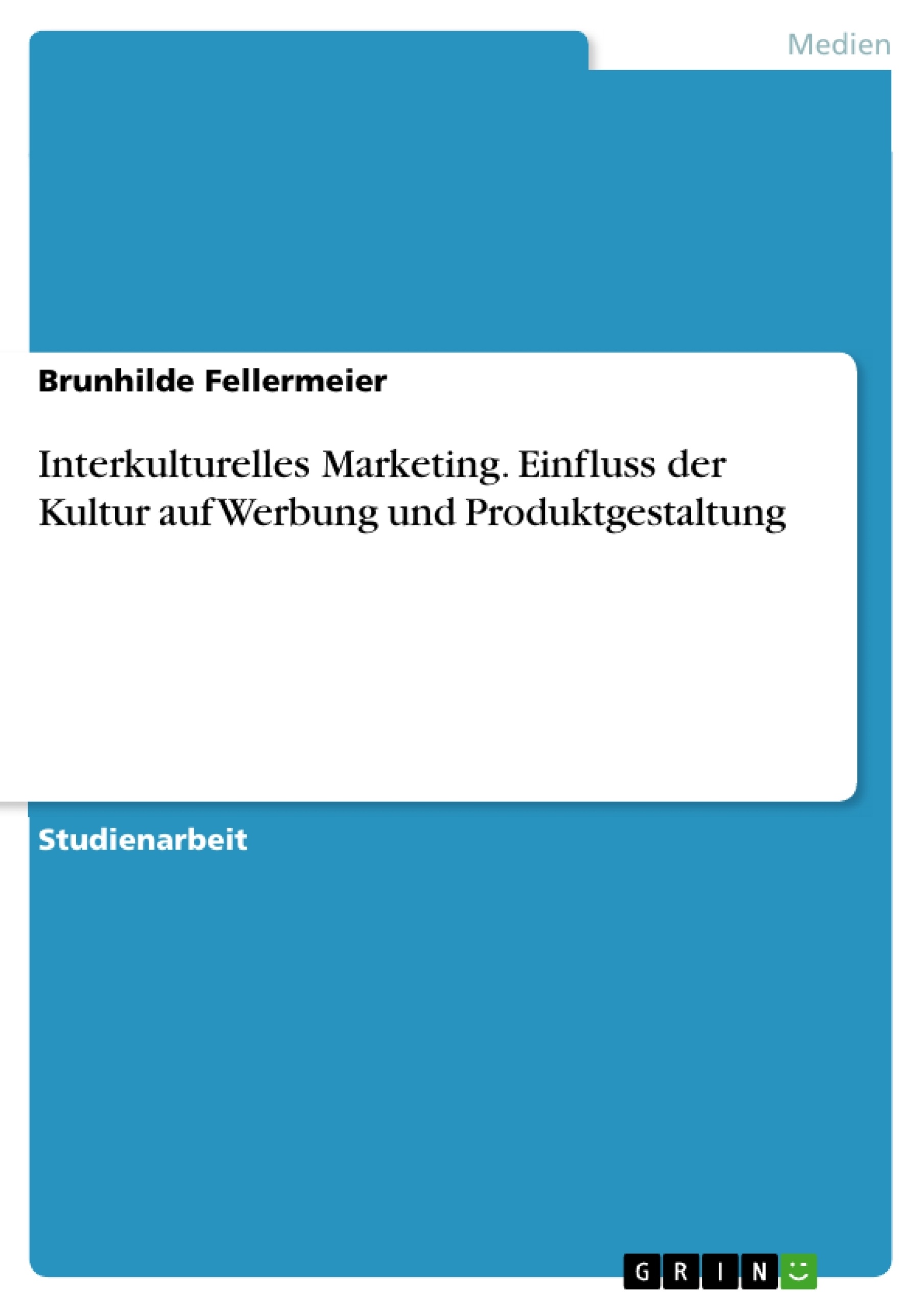Für den Begriff Kultur gibt es keine eindeutige bzw. einheitliche Definition. Kroeber/Kluckhon zählten 164 und Herbig sogar 450 verschiedene Definitionen für Kultur. Um diesen Schlüsselbegriff „Kultur“ zu analysieren, sollen deshalb verschiedene Definitionen betrachtet werden.
- Cultura (lat.): Pflege des Körpers und des Geistes, colere, cultum (lat.) bebauen, bewohnen, pflegen ehren
- „Die Kultur kann in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schließt nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, Wertesysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen.“
- “Culture consists of patterns, explicit or implicit, of and for behaviour acquired and transmitted by symbols, constituting achievements of human groups, including their embodiments in artefacts; the essential core of culture consists of traditional (i.e. historically derived and selected) ideas and especially their attached values; cultural systems may on the one hand be considered as products of action, on the other as condition elements of further action”
- „Kultur ist der Weg, auf dem menschliche Gesellschaften zur Lösung von Problemen finden.”
Diese Definitionen geben einen kleinen Ausschnitt wieder, was unter dem Begriff Kultur verstanden wird. In Bezug auf den Bereich Marketing wird Kultur als Übereinstimmung von Verhaltensmustern vieler Individuen (= Kunden, Zielgruppen) bezeichnet. Dies wird dann auf Sprachgemeinschaften, Länder bzw. gesamte übernationale Einheiten übertragen. Kulturelle Unterschiede in Bezug auf die Verhaltensweisen einer Gesellschaft sind in erster Linie bei der Sprache, dem Wissen, der Gesetzgebung und der Religion, aber auch bei den Essensgewohnheiten, der Musik und Kunst sowie der Technik oder dem Arbeitsverhalten zu finden.
Kulturelle Unterschiede werden besonders durch unterschiedliches Verhalten und Handeln deutlich. Um zu erkennen, welche Ursachen einem bestimmten Handeln zu Grunde liegen, ist es notwendig Kultur unterscheidende Kriterien festzulegen, damit Missverständnissen vorgebeugt werden kann.
Hier werden zwei Kulturdefinitionen dargestellt, die aufgrund ihrer Struktur eine Basis zum Kulturverständnis und einem Kulturvergleich ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Inhalt
- 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN
- 2.1. DEFINITION
- 2.2. KULTURELLE ERKLÄRUNGSANSÄTZE
- 2.2.1. 5-DIMENSIONEN-MODELL NACH HOFSTEDE
- 2.2.2. KULTURDIMENSIONEN-MODELL NACH HALL
- 2.3. KULTURELLE GRUNDLAGEN
- 2.3.1. KOMMUNIKATION
- 2.3.1.1. Sprache
- 2.3.1.2. Nonverbale Kommunikation
- 2.3.2. WELTANSCHAUUNGEN
- 2.3.2.1. Religion
- 2.3.2.2. Wertvorstellungen und Normen
- 2.3.2.3. Partikularismus versus Universalismus
- 2.4. LÄNDERSPEZIFISCHE KRITERIEN
- 2.4.1. Demographische und gesellschaftliche Strukturen
- 2.4.2. Sub-Kulturen
- 2.4.3. Wissensstand, Bildungsniveau und Alphabetisierungsgrad
- 2.4.4. Klimatische Bedingungen
- 2.4.5. PSYCHOKULTURELLE FAKTOREN
- 2.4.5.1. Farben, Zeichen und Symbole
- 2.4.5.2. Ästhetische Wahrnehmung
- 2.4.5.3. Gewohnheiten
- 3. KULTUR UND MARKETING
- 3.1. EINFLUSS VON KULTUREN AUF DAS MARKETING
- 3.2. MARKETING-MIX AUS KULTURELLER PERSPEKTIVE
- 3.2.1. INTERKULTURELLE PRODUKTPOLITIK
- 3.2.1.1.1. Culture-bound und Culture-free Produkte
- 3.2.1.1. Produktstandardisierung versus Produktdifferenzierung
- 3.2.1.1.2. Produkteigenschaften
- 3.2.1.2. Markenpolitik
- 3.2.1.2.1. Namensgebung
- 3.2.1.2.2. Markenstrategien
- 3.2.1.3. Verpackungsattribute
- 3.3. INTERKULTURELLE KOMMUNIKATIONSPOLITIK
- 4. GLOBALE WERBUNG - PRO UND CONTRA
- 4.1. MEDIASELEKTION
- 5. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss von Kultur auf Werbung und Produktgestaltung im interkulturellen Marketing. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen des interkulturellen Marketings zu beleuchten und deren praktische Relevanz für die Gestaltung von Marketingstrategien aufzuzeigen.
- Definition und verschiedene Erklärungsansätze von Kultur
- Kulturelle Grundlagen von Kommunikation und Weltanschauungen
- Länderspezifische Kriterien im interkulturellen Marketing
- Einfluss von Kultur auf den Marketing-Mix (Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Distributionspolitik)
- Globale Werbung: Chancen und Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Einführung in das Thema Kultur. Es beginnt mit der Diskussion unterschiedlicher Definitionen von Kultur und beleuchtet die Schwierigkeiten, den Begriff eindeutig zu fassen. Anschließend werden verschiedene kulturwissenschaftliche Erklärungsmodelle vorgestellt, darunter das 5-Dimensionen-Modell nach Hofstede, das wichtige kulturelle Unterschiede wie Machtdistanz, Individualismus/Kollektivismus, Maskulinität/Femininität, Unsicherheitsvermeidung und langfristige/kurzfristige Orientierung hervorhebt. Die Bedeutung dieser Dimensionen für das Verständnis interkultureller Unterschiede wird ausführlich erläutert und bildet die Grundlage für spätere Kapitel.
3. Kultur und Marketing: In diesem Kapitel wird der Einfluss kultureller Faktoren auf Marketingstrategien analysiert. Es wird detailliert untersucht, wie kulturelle Unterschiede die Produktpolitik, insbesondere die Gestaltung von Produkten (culture-bound vs. culture-free), die Markenpolitik (Namensgebung, Markenstrategien) und die Verpackung beeinflussen. Ein besonderer Fokus liegt auf der interkulturellen Kommunikation und den Herausforderungen, die sich durch unterschiedliche Kommunikationsformen und -stile ergeben. Das Kapitel verdeutlicht, wie wichtig die Berücksichtigung kultureller Nuancen für den Erfolg von Marketingkampagnen ist.
Schlüsselwörter
Interkulturelles Marketing, Kultur, Werbung, Produktgestaltung, Hofstede-Modell, Kommunikation, Markenpolitik, Produktpolitik, Globalisierung, Kulturdimensionen, Marketing-Mix, Länderspezifische Kriterien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Einfluss von Kultur auf Werbung und Produktgestaltung im interkulturellen Marketing"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss von Kultur auf Werbung und Produktgestaltung im interkulturellen Marketing. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen und deren praktische Relevanz für die Gestaltung von Marketingstrategien.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und verschiedene Erklärungsansätze von Kultur, kulturelle Grundlagen von Kommunikation und Weltanschauungen, länderspezifische Kriterien im interkulturellen Marketing, Einfluss von Kultur auf den Marketing-Mix (Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Distributionspolitik) und globale Werbung: Chancen und Herausforderungen.
Welche theoretischen Grundlagen werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene kulturwissenschaftliche Erklärungsmodelle, insbesondere das 5-Dimensionen-Modell nach Hofstede (Machtdistanz, Individualismus/Kollektivismus, Maskulinität/Femininität, Unsicherheitsvermeidung und langfristige/kurzfristige Orientierung). Die Bedeutung dieser Dimensionen für interkulturelle Unterschiede wird ausführlich erläutert.
Wie wird der Einfluss von Kultur auf den Marketing-Mix dargestellt?
Die Arbeit analysiert detailliert, wie kulturelle Unterschiede die Produktpolitik (Gestaltung von Produkten, culture-bound vs. culture-free, Produktstandardisierung vs. -differenzierung), die Markenpolitik (Namensgebung, Markenstrategien) und die Verpackung beeinflussen. Ein Schwerpunkt liegt auf der interkulturellen Kommunikation und den Herausforderungen durch unterschiedliche Kommunikationsformen und -stile.
Welche Aspekte der globalen Werbung werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die Chancen und Herausforderungen der globalen Werbung und berührt Aspekte der Medieauswahl.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Inhalt, Theoretische Grundlagen (Definition von Kultur, kulturelle Erklärungsansätze, kulturelle Grundlagen, länderspezifische Kriterien), Kultur und Marketing (Einfluss von Kulturen auf das Marketing, Marketing-Mix aus kultureller Perspektive, interkulturelle Kommunikation), Globale Werbung - Pro und Contra und Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Interkulturelles Marketing, Kultur, Werbung, Produktgestaltung, Hofstede-Modell, Kommunikation, Markenpolitik, Produktpolitik, Globalisierung, Kulturdimensionen, Marketing-Mix, Länderspezifische Kriterien.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, den Einfluss von Kultur auf Werbung und Produktgestaltung im interkulturellen Marketing zu untersuchen und die theoretischen Grundlagen sowie deren praktische Relevanz für die Gestaltung von Marketingstrategien aufzuzeigen.
- Quote paper
- Brunhilde Fellermeier (Author), 2010, Interkulturelles Marketing. Einfluss der Kultur auf Werbung und Produktgestaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159120