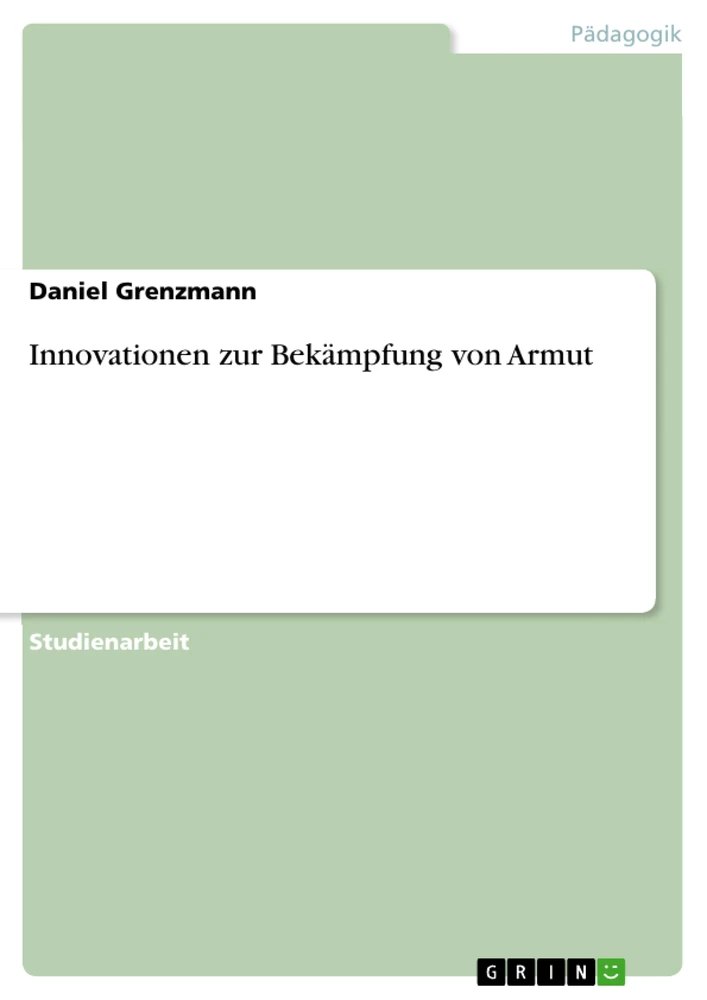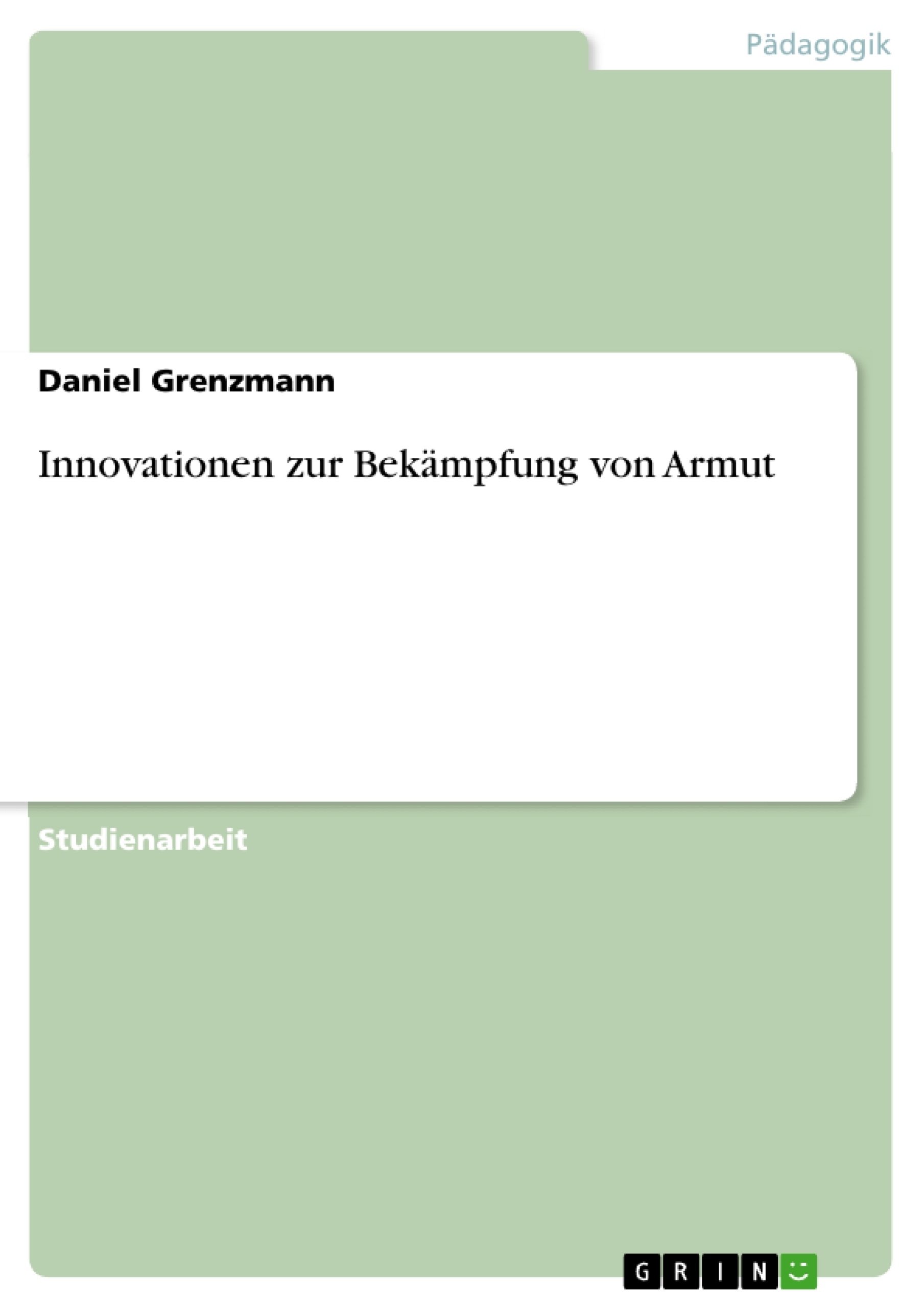In den letzten Jahren war oft die Rede von Nicholas Negroponte, an dessen Idee des 100-Dollar-Laptops für Kinder in Entwicklungsländern auf den Markt zu bringen sich die Geister scheiden.
Zum anderen wurde über Mohammad Yunus berichtet, der mit seiner Meinung „Das Recht auf Kredit sollte ein Menschenrecht sein“ mitunter nur Hohn und Spott erntete.
Offensichtlich geht es den Ländern, in denen technologische Fortschritte erreicht werden ganz gut.
Allgemein bekannt ist, dass in den sogenannten Industrieländern neue Produkte entwickelt, die in alle Welt exportiert werden.
Den Entwicklungsländern bleibt die Rolle als Zuarbeiter: Sie liefern zum Beispiel Rohöl für unsere Chemie, Obst für den Endverbraucher oder zur Weiterverarbeitung oder auch Metalle. Zudem rückte in den letzten Jahren die Rolle der Entwicklungsländer als Lieferant billiger Arbeitskräfte für die Unternehmen der Industrieländer in den Fokus.
Wie stellt sich die Situation dar, wenn die subtileren Faktoren betrachtet werden?
Wie sind die Maßnahmen von Negroponte und Yunus in diesem Kontext zu sehen? Haben sie einen Einfluss auf die Situation der Menschen, die mit ihren Produkten in Berührung kommen?
Ist die Abhängigkeit einseitig oder müssen auch Akteure aus Industrieländern Rücksicht nehmen auf die Entwicklungsländer?
Eine weitere Frage ist die nach den Akteuren, die hier am wirkungsvollsten Abhilfe schaffen können: Muss der Impuls von den Entwicklungsländern selber ausgehen oder muss ein Ruck durch die Industrieländer gehen oder sind es durch Innovationen geschaffene Strukturen?
Müssen politische Vorgaben gemacht werden, kann jemand aus den Reihen der Unternehmer nach wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten zur Lösung des Problems beitragen?
Auch will ich mich der Frage nicht verschließen, ob sich die Armut in den Entwicklungsländern aus den Beziehungen zu den Industrieländern, gemeinhin als Globalisierung bekannt, ergibt. Oder gibt es auch innerstaatliche Gründe für Armut?
Auch wenn diese Thematik auf den ersten Blick ein rein wirtschaftspolitische zu sein scheint, ist die Fragestellung so formuliert, dass pädagogische Gesichtspunkte im Schwerpunkt zum Tragen kommen. Man kommt nicht umhin die Situation mit ihren wirtschaftlichen und politischen Facetten zu beschreiben, um sich dann der Frage zuwenden zu können, wie die beiden genannten Innovationen einzuordnen sind und wie sie auf bestehende soziale Systeme einwirken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Überblick über die Erscheinungsformen der Armut in den Entwicklungsländern
- Ursachen der Armut
- Globalisierung
- Transnationale Konzerne
- Brain Drain
- Innerstaatliche Ursachen
- Globalisierung
- Die Akteure in der Entwicklungshilfe
- Staatliche, nichtstaatliche und privatwirtschaftliche Akteure
- Staatliche Akteure
- Nichtstaatliche Akteure
- Privatwirtschaftliche Akteure
- Zwei vielversprechende Innovationen
- Negropontes 100-Dollar-Laptop und Yunus Grameen Bank
- Die Grameen Bank
- Der 100-Dollar-Laptop
- Staatliche, nichtstaatliche und privatwirtschaftliche Akteure
- Wirkungsweise der Innovationen in den sozialen Systemen
- Zusammenfassung und Stellungnahme des Autors
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie Innovationen als pädagogisches Instrument eingesetzt werden können, um soziale Systeme in Entwicklungsländern zu verändern und Armut effektiv zu bekämpfen. Dabei werden die Ideen des 100-Dollar-Laptops von Nicholas Negroponte und der Grameen Bank von Mohammad Yunus beleuchtet und in den Kontext der Entwicklungshilfe und der Ursachen der Armut in Entwicklungsländern eingeordnet. Die Arbeit analysiert die Wirkungsweise dieser Innovationen auf soziale Systeme und untersucht, ob sie die bestehenden Herausforderungen im Bereich der Entwicklungshilfe wirkungsvoll angehen können.
- Die Rolle von Innovationen in der Armutsbekämpfung
- Die Ursachen der Armut in Entwicklungsländern (Globalisierung, innerstaatliche Faktoren)
- Die Akteure der Entwicklungshilfe (staatlich, nichtstaatlich, privatwirtschaftlich)
- Die Wirkungsweise von Innovationen auf soziale Systeme in Entwicklungsländern
- Die Kritik an den Innovationen von Negroponte und Yunus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Thematik und die Forschungsfrage definiert. Im zweiten Kapitel werden die wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit Armut und Entwicklungshilfe geklärt. Der dritte Abschnitt gibt einen Überblick über die Erscheinungsformen der Armut in Entwicklungsländern. Das vierte Kapitel beleuchtet die Ursachen der Armut, die in zwei Kategorien unterteilt werden: Globalisierung und innerstaatliche Ursachen.
Kapitel fünf widmet sich der Entwicklungshilfe und stellt die verschiedenen Akteure mit ihren unterschiedlichen Interessen vor. Der zweite Teil dieses Kapitels konzentriert sich auf die zwei Innovationen von Negroponte und Yunus. Hier werden die Ideen vorgestellt, hinterfragt und in den Kontext der Entwicklungshilfe eingeordnet. Im sechsten Kapitel wird die Wirkungsweise der Innovationen in den sozialen Systemen analysiert. Dabei wird die Frage gestellt, wie die Ideen von Negroponte und Yunus auf soziale Systeme einwirken und sie verändern. Abschließend fasst das siebte Kapitel die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und enthält die kritische Stellungnahme des Autors.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Armut in Entwicklungsländern, Innovationen in der Bildung, Entwicklungshilfe, Globalisierung, soziale Systeme, pädagogische Instrumente, Transnationale Konzerne, Brain Drain, Kleinkredite, 100-Dollar-Laptop, Nicholas Negroponte, Mohammad Yunus und die Grameen Bank. Die Arbeit analysiert die Rolle dieser Themen in der Entwicklungshilfe und der Armutsbekämpfung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen Innovationen bei der Armutsbekämpfung?
Innovationen wie der 100-Dollar-Laptop oder Kleinkredite dienen als Instrumente, um soziale Systeme zu verändern und Menschen in Entwicklungsländern neue Chancen zu eröffnen.
Was ist die Idee hinter Mohammad Yunus' Grameen Bank?
Yunus vertritt die Ansicht, dass das Recht auf Kredit ein Menschenrecht sein sollte. Kleinkredite ermöglichen armen Menschen den Aufbau einer eigenen Existenz ohne Sicherheiten.
Was bezweckt Nicholas Negroponte mit dem 100-Dollar-Laptop?
Ziel ist es, Kindern in Entwicklungsländern durch günstige Hardware Zugang zu Bildung und digitaler Welt zu verschaffen, um den "Digital Divide" zu überbrücken.
Was sind die Hauptursachen für Armut in Entwicklungsländern?
Die Arbeit unterscheidet zwischen globalen Faktoren (wie transnationale Konzerne und Brain Drain) und innerstaatlichen politischen oder wirtschaftlichen Ursachen.
Ist die Abhängigkeit zwischen Industrie- und Entwicklungsländern einseitig?
Nein, auch Akteure aus Industrieländern sind auf Rohstoffe und Arbeitskräfte angewiesen, was eine komplexe, wechselseitige Beziehung im Rahmen der Globalisierung schafft.
- Quote paper
- Daniel Grenzmann (Author), 2008, Innovationen zur Bekämpfung von Armut, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159151