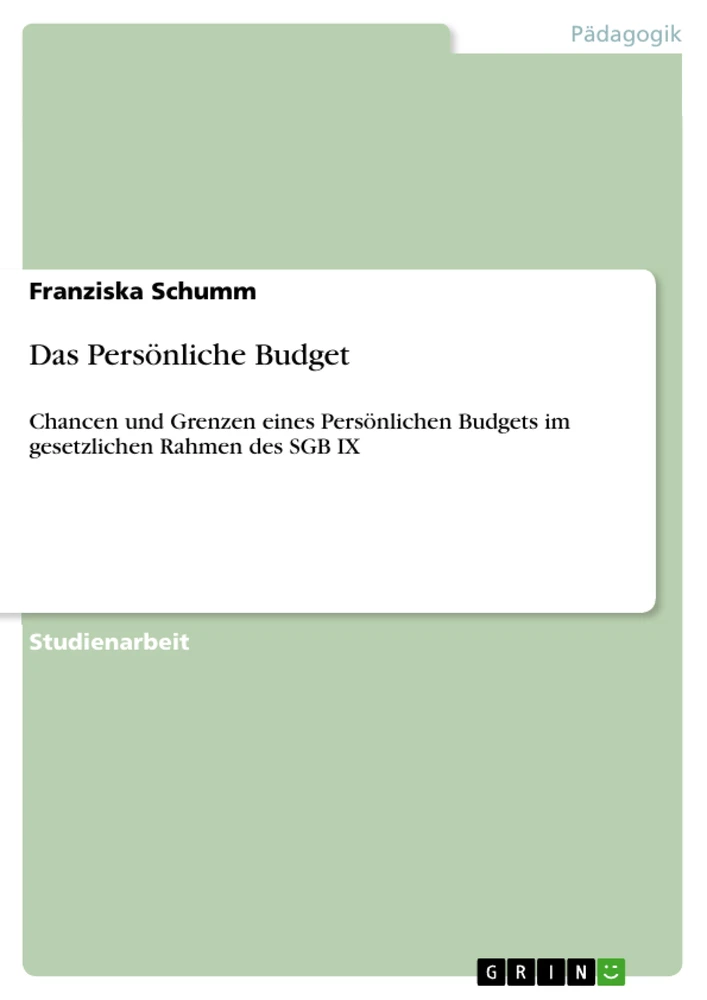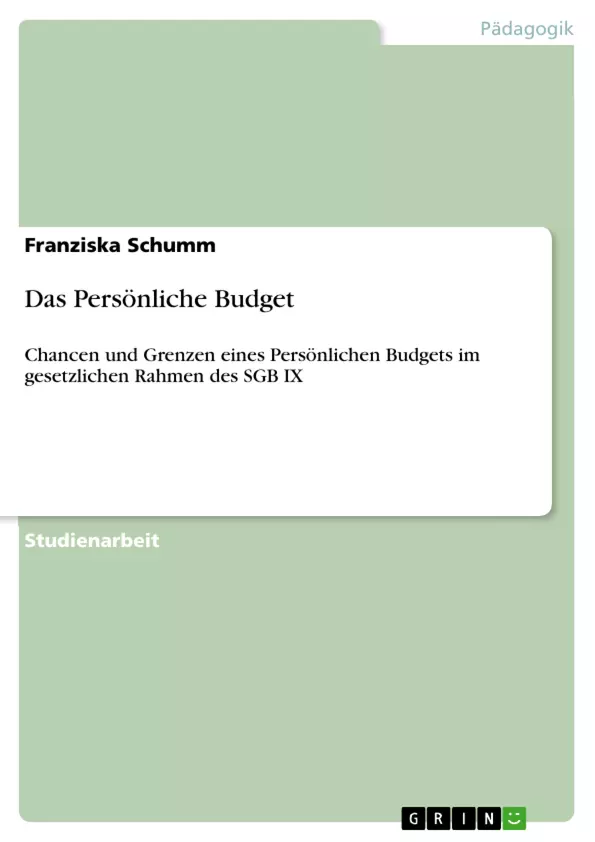[...]
Die nachfolgende Arbeit setzt sich demnach mit der Frage auseinander, ob die sozialpolitische Innovation des Persönlichen Budgets den aufgeführten Erwartungen gerecht werden kann. Der Fokus soll hierbei auf dem bereits mehrfach erwähnten Selbstbestimmungsparadigma liegen. Dabei wird vor allem zu klären sein, inwieweit durch den Bezug eines Persönlichen Budgets Wahlmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung bei der Leistungserbringung tatsächlich erweitert und ob dadurch eine Stärkung selbstbestimmter Lebensformen sowie die Erhöhung der Teilhabe erzielt werden kann.
Da sowohl der Forderung nach mehr Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung als auch der damit verbundenen Einführung des Persönlichen Budgets ein sozialpolitischer Paradigmenwechsel vorausging, soll dieser zunächst erläutert und in seinen Konsequenzen für die Rechtslage von Menschen mit Behinderung dargestellt werden. Im Anschluss daran wird der Fokus wieder auf das Persönliche Budget gerichtet. Nach einer Klärung der Begrifflichkeiten sowie den mit einem Persönlichen Budget zusammenhängenden sozialpolitischen Absichten wird die rechtliche Verankerung dieses Instrumentariums im deutschen Sozialrecht vorgenommen. Grundlage hierfür sind die §§ 10, 14 und 17 SGB IX, welche differenziert dargestellt werden. Der Intention der Arbeit folgend wird anhand von Fallbeispielen aus den Modellprojekten eine Analyse der Lebenssituation und Budgetnutzung durchgeführt. Darüber hinaus sollen Ergebnisse zur allgemeinen Zufriedenheit der Budgetnutzer mit dem Persönlichen Budget zusammengetragen werden. Dadurch wird eine Annäherung an die Umsetzungspraxis Persönlicher Budgets angestrebt, um nachfolgend eine kritische Reflexion zu ermöglichen. Diese soll unter Punkt sechs erfolgen. Um der Fragestellung gerecht zu werden, sollen hier die noch vorherrschenden Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis eingehend diskutiert werden. Die Arbeit schließt letztendlich mit einem Fazit sowie möglichem Ausblick zur zukünftigen Entwicklung Persönlicher Budgets im deutschen Sozialrecht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sozialpolitischer Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe
- Zielvorstellungen
- Rechtliche Konsequenzen des Paradigmenwechsels
- Das Persönliche Budget als sozialrechtliche Innovation im Rahmen des Paradigmenwechsels
- Begrifflichkeiten
- Das Persönliche Budget als Alternative zum Sachleistungsrecht
- Trägerübergreifendes Persönliches Budget
- Sozialpolitische Absichten eines Persönlichen Budgets
- Begrifflichkeiten
- Rechtliche Grundlagen des Persönlichen Budgets
- Das Persönliche Budget im deutschen Sozialrecht
- Persönliche Budgets nach § 17 SGB IX
- Komplexleistungen nach §§ 10 und 14 SGB IX (,,Koordinierung der Leistungen")
- Verfahren der Bedarfserhebung, Budgetbemessung und Kontrolle
- Das Persönliche Budget im deutschen Sozialrecht
- Erfahrungen aus den Modellprojekten zum Persönlichen Budget und der Lebenssituation der Budgetnehmer
- Lebenssituation und Budgetnutzung
- Fallbeispiele zur Wirkung Persönlicher Budgets in der Lebenswelt der Budgetnehmer
- Leben wie bisher“: Hannes Waldenfels - Das Persönliche Budget zur Verhinderung einer stationären Betreuung
- „Leben nach dem Heim“: Giovanni Lavorano – Das Persönliche Budget zur Sicherstellung der gewünschten Betreuungsform
- Zusammenfassung zur allgemeinen Zufriedenheit der Budgetnutzer
- Von der Theorie zur Praxis – Umsetzungsschwierigkeiten und Grenzen Persönlicher Budgets
- Fazit
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Chancen und Grenzen des Persönlichen Budgets im Rahmen des SGB IX. Hauptziel ist die Analyse, inwieweit das Persönliche Budget die gesteckten Ziele der Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung erreicht. Dabei wird der Fokus auf den sozialpolitischen Paradigmenwechsel gelegt, der die Einführung des Persönlichen Budgets ermöglichte.
- Sozialpolitischer Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe
- Das Persönliche Budget als sozialrechtliche Innovation
- Rechtliche Grundlagen des Persönlichen Budgets im SGB IX
- Erfahrungen und Lebenssituationen von Budgetnehmern
- Umsetzungsschwierigkeiten und Grenzen des Persönlichen Budgets
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Persönlichen Budgets ein und benennt die zentrale Fragestellung der Arbeit: Kann das Persönliche Budget die Erwartungen hinsichtlich Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung erfüllen? Ein Zitat eines Budgetnehmers verdeutlicht bereits die angestrebten Ziele: Selbstbestimmung, Passung von Leistung und individuellem Bedarf sowie Integration. Die Arbeit konzentriert sich auf das Selbstbestimmungsparadigma und untersucht, ob das Persönliche Budget tatsächlich Wahlmöglichkeiten erweitert und selbstbestimmte Lebensformen fördert.
Sozialpolitischer Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe: Dieses Kapitel beschreibt den sozialpolitischen Wandel in der Behindertenhilfe seit den 1970er Jahren. Es werden die Zielvorstellungen dieses Wandels erläutert, darunter die Vereinheitlichung des Rechts und die Kompensation der Nachteile des gegliederten Systems. Kritische Punkte des Sachleistungsrechts, wie die Objektstellung der Leistungsberechtigten und die Vernachlässigung vorhandener Ressourcen, werden hervorgehoben. Der Paradigmenwechsel zielt auf mehr Selbstbestimmung und Teilhabe ab.
Das Persönliche Budget als sozialrechtliche Innovation im Rahmen des Paradigmenwechsels: Dieses Kapitel definiert das Persönliche Budget als Alternative zum Sachleistungsrecht und beleuchtet seine sozialpolitischen Intentionen. Es wird die Grundidee erklärt, dass Menschen mit Behinderung mehr Entscheidungsfreiheit über die Art und Weise der Leistungserbringung erhalten. Der Fokus liegt auf der Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe, sowie auf der Reduktion von verwaltungstechnischen Problemen im bestehenden System.
Rechtliche Grundlagen des Persönlichen Budgets: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Grundlagen des Persönlichen Budgets im deutschen Sozialrecht, insbesondere die §§ 10, 14 und 17 SGB IX. Es beschreibt die Verfahren der Bedarfserhebung, Budgetbemessung und Kontrolle. Die verschiedenen Aspekte der rechtlichen Verankerung werden differenziert dargestellt.
Erfahrungen aus den Modellprojekten zum Persönlichen Budget und der Lebenssituation der Budgetnehmer: Dieses Kapitel präsentiert Erfahrungen aus Modellprojekten und analysiert die Lebenssituation und Budgetnutzung der Beteiligten. Es beinhaltet Fallbeispiele, die die Auswirkungen des Persönlichen Budgets auf das Leben der Budgetnehmer verdeutlichen und die allgemeine Zufriedenheit mit dem Instrument beleuchten.
Von der Theorie zur Praxis – Umsetzungsschwierigkeiten und Grenzen Persönlicher Budgets: Dieses Kapitel widmet sich einer kritischen Reflexion der Umsetzung des Persönlichen Budgets und analysiert die bestehenden Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis. Es werden die Herausforderungen und Grenzen der praktischen Anwendung des Persönlichen Budgets im Detail untersucht.
Schlüsselwörter
Persönliches Budget, SGB IX, Selbstbestimmung, Teilhabe, Behindertenhilfe, sozialpolitischer Paradigmenwechsel, Modellprojekte, Rechtliche Grundlagen, Umsetzung, Integration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Persönlichen Budget im SGB IX
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Übersicht über das Persönliche Budget im Rahmen des SGB IX. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel sowie Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse, inwieweit das Persönliche Budget die Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung fördert.
Was sind die zentralen Themen des Dokuments?
Die zentralen Themen sind der sozialpolitische Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe, das Persönliche Budget als sozialrechtliche Innovation, die rechtlichen Grundlagen im SGB IX, die Erfahrungen von Budgetnehmern in Modellprojekten sowie die Herausforderungen und Grenzen bei der Umsetzung des Persönlichen Budgets in der Praxis.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument umfasst Kapitel zu folgenden Themen: Einleitung, Sozialpolitischer Paradigmenwechsel, Das Persönliche Budget als sozialrechtliche Innovation, Rechtliche Grundlagen des Persönlichen Budgets, Erfahrungen aus Modellprojekten, Umsetzungsschwierigkeiten und Grenzen, sowie ein Fazit und Literaturangaben.
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist die Analyse, inwieweit das Persönliche Budget die gesteckten Ziele der Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung erreicht. Dabei wird der Fokus auf den sozialpolitischen Paradigmenwechsel gelegt, der die Einführung des Persönlichen Budgets ermöglichte.
Wie wird der sozialpolitische Paradigmenwechsel beschrieben?
Das Dokument beschreibt den Wandel in der Behindertenhilfe seit den 1970er Jahren mit dem Ziel der Selbstbestimmung und Teilhabe. Kritische Punkte des bisherigen Sachleistungsrechts, wie die Objektstellung der Leistungsberechtigten, werden hervorgehoben. Der Paradigmenwechsel zielt auf mehr Selbstbestimmung und Teilhabe ab.
Was ist ein Persönliches Budget?
Ein Persönliches Budget ist eine Alternative zum Sachleistungsrecht, die Menschen mit Behinderung mehr Entscheidungsfreiheit über die Art und Weise der Leistungserbringung ermöglicht. Es stärkt die Selbstbestimmung und Teilhabe und soll verwaltungstechnische Probleme reduzieren.
Welche rechtlichen Grundlagen werden behandelt?
Das Dokument analysiert die rechtlichen Grundlagen im deutschen Sozialrecht, insbesondere §§ 10, 14 und 17 SGB IX. Es beschreibt die Verfahren der Bedarfserhebung, Budgetbemessung und Kontrolle.
Welche Erfahrungen von Budgetnehmern werden dargestellt?
Das Dokument präsentiert Erfahrungen aus Modellprojekten und analysiert die Lebenssituation und Budgetnutzung der Beteiligten. Es beinhaltet Fallbeispiele, die die Auswirkungen des Persönlichen Budgets auf das Leben der Budgetnehmer verdeutlichen.
Welche Umsetzungsschwierigkeiten und Grenzen werden diskutiert?
Das Dokument analysiert kritisch die Umsetzung des Persönlichen Budgets und die Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis. Es untersucht Herausforderungen und Grenzen der praktischen Anwendung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Persönliches Budget, SGB IX, Selbstbestimmung, Teilhabe, Behindertenhilfe, sozialpolitischer Paradigmenwechsel, Modellprojekte, Rechtliche Grundlagen, Umsetzung, Integration.
- Quote paper
- Franziska Schumm (Author), 2009, Das Persönliche Budget, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159217