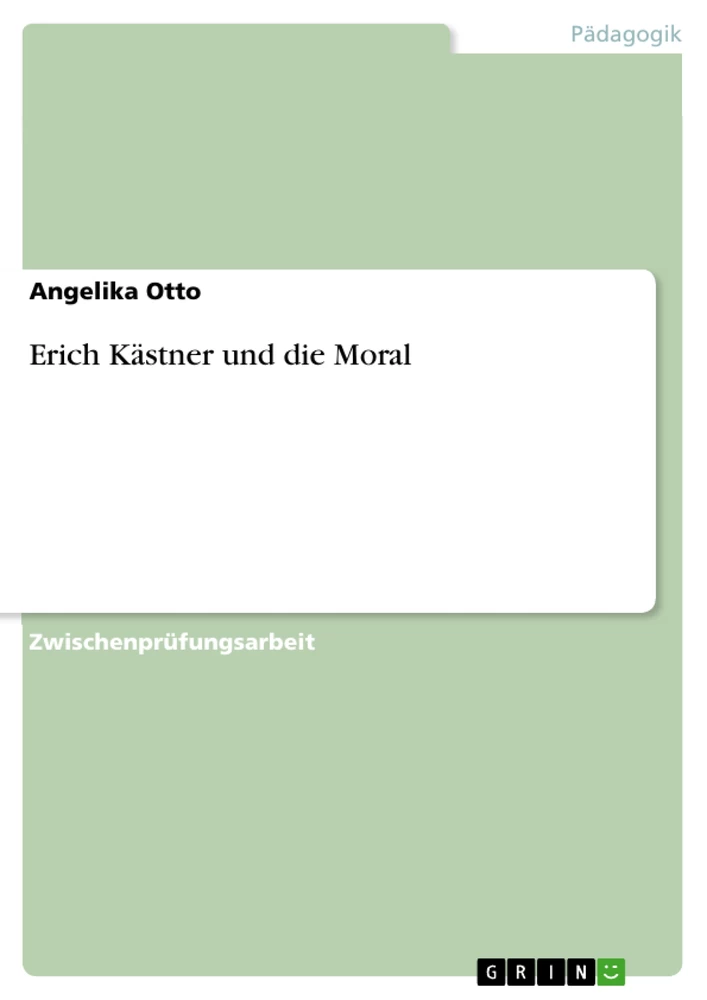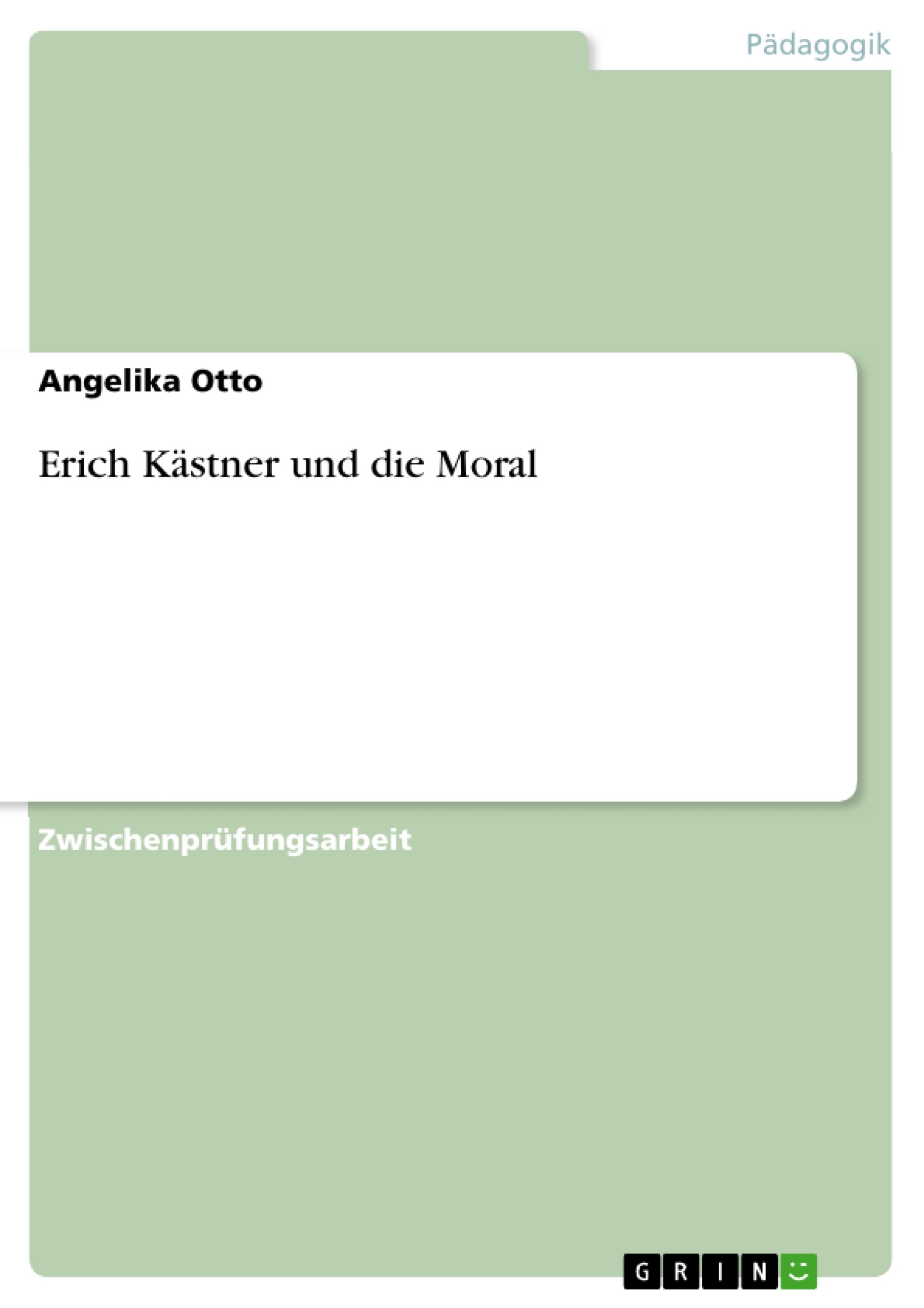Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit Erich Kästner unter dem Gesichtspunkt der Moral. Dabei soll beispielhaft darauf eingegangen werden, wie sich Moralvorstellungen entlang einer Biografie entwickeln und auf einen Lebenslauf auswirken. So soll zum Beispiel der moralische Konflikt Kästners zu Zeiten des Naziregimes beleuchtet werden.
Das erste Kapitel widmet sich der Frage nach der Definition des Begriffs Moral im Allgemeinen.
Im nächsten Kapitel wird dann der Moralbegriff konkret auf Erich Kästner angewendet. Kästner verstand sich selbst als einen Moralisten. Wie er zu dieser Einstellung gelangte, und wie diese sich auf sein Leben und seine Werke auswirkte wird in vier Unterkapiteln genauer erläutert.
Im nächsten Abschnitt wird Kästners Menschenbild im Allgemeinen betrachtet. Als Grundpfeiler der Moral verstand Kästner die Vernunft und machte es sich zur Aufgabe, diese in seinen Werken den Menschen zu vermitteln.
Was passiert, wenn die eigenen Moralvorstellungen nicht mit den gesellschaftlichen Vorstellungen konform gehen, wird im dritten Kapitel betrachtet. Inwiefern geht man – in diesem Fall Erich Kästner – Kompromisse ein? Welche Konsequenzen hat ein Publikationsverbot für das eigene Selbstbild? Welche Vorwürfe musste Kästner sich anhören oder gar selber machen?
Aber auch nach 1945 stellt sich die Frage nach Moral und Vergangenheitsbewältigung. Gegen Kriegsende schrieb Kästner Tagebuch, welches später unter dem Titel Notabene 45 veröffentlicht wurde. In dem Buch spiegelt sich die allgemeine Verunsicherung, denn nach dem Krieg „wird aus Unrecht, das Recht geworden war, wieder Unrecht.“ Neue Zeitungen entstehen, um den Bürgern neue Werte zu vermitteln – was sich auch Kästner zur Aufgabe macht. Diese Themen behandelt das vierte Kapitel.
Im darauffolgenden Abschnitt wird anhand Kästners Biografie rekonstruiert, wie er zu seinen Moralvorstellungen kam.
Im sechsten Kapitel geht es darum, wem Kästner seine Werte vermitteln wollte und welche Wege und Medien er dafür nutzte. Seine Verbreitungswege waren, abgesehen von den zwölf Jahren während des NS-Regimes, breit gefächert. Aber selbst als verbotener Autor wurde seine „Gebrauchslyrik“ begehrt und heimlich gelesen.
Wie sich seine Moralvorstellungen in seinem bekanntesten satirischen Erwachsenenroman Fabian.
Im Fazit werden die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was versteht man allgemein unter dem Begriff „Moral“?
- Kästner ein Moralist
- Kästners politischen Moralvorstellungen
- Kästners Menschenbild
- Kästner und die Frauen
- Kästner und die Kinder
- Was passiert, wenn die eigenen Moralvorstellungen nicht mit den gesellschaftlichen Vorstellungen konform gehen?
- Moral nach 1945
- Wie kommt Kästner zu seinen Wertvorstellungen?
- Wem vermittelt Kästner seine Werte?
- Wie zeigen sich Kästners Moralvorstellungen in seinem Werk Fabian. Die Geschichte eines Moralisten?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Leben und Werk Erich Kästners unter dem Aspekt der Moral. Sie analysiert die Entwicklung seiner Moralvorstellungen im Laufe seiner Biografie und beleuchtet, wie diese sich auf sein Leben und seine Werke auswirkten. Ein besonderer Fokus liegt auf Kästners moralischem Konflikt während des NS-Regimes.
- Definition des Begriffs Moral und seine unterschiedlichen Bedeutungen
- Kästners Selbstverständnis als Moralist und die Einbettung seiner Moralvorstellungen in seine politische Meinung, sein Menschenbild, seine Beziehungen zu Frauen und Kindern
- Die Auswirkungen von Kästners Moralvorstellungen auf sein Leben im Kontext der gesellschaftlichen Verhältnisse, insbesondere während des NS-Regimes
- Kästners literarische Vermittlung seiner moralischen Werte und die Analyse seiner bekanntesten Werke im Hinblick auf diese Werte
- Die Entwicklung von Kästners Moralvorstellungen im Kontext seiner Lebensgeschichte.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert die Zielsetzung und den methodischen Ansatz. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs „Moral“ und unterscheidet zwischen deskriptiver und präskriptiver Bedeutung. Das zweite Kapitel analysiert Kästners Selbstverständnis als Moralist und untersucht seine politischen Moralvorstellungen, sein Menschenbild, seine Beziehungen zu Frauen und Kindern. Das dritte Kapitel beleuchtet die Spannungen zwischen Kästners eigenen Moralvorstellungen und den gesellschaftlichen Vorstellungen, besonders während des NS-Regimes. Das vierte Kapitel behandelt die Frage nach Moral und Vergangenheitsbewältigung nach 1945. Das fünfte Kapitel rekonstruiert, wie Kästner zu seinen Moralvorstellungen kam. Das sechste Kapitel untersucht, wem Kästner seine Werte vermitteln wollte. Das siebte Kapitel analysiert Kästners Moralvorstellungen in seinem Werk „Fabian. Die Geschichte eines Moralisten.“
Schlüsselwörter
Moral, Erich Kästner, Moralvorstellungen, NS-Regime, Politik, Menschenbild, Kinder, Literatur, Fabian, Moralist, Vernunft, Verantwortung
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Erich Kästner unter dem Begriff Moral?
Erich Kästner verstand sich selbst als Moralist. Für ihn war die Vernunft der Grundpfeiler der Moral, und er sah es als seine Aufgabe an, diese Werte durch seine Werke an die Menschen zu vermitteln.
Welchen moralischen Konflikt erlebte Kästner während des NS-Regimes?
Kästner stand im Konflikt zwischen seinen eigenen Moralvorstellungen und den gesellschaftlichen Forderungen des Nationalsozialismus. Trotz eines Publikationsverbots blieb er in Deutschland, was Fragen nach Kompromissen und dem eigenen Selbstbild aufwarf.
Wie entwickelte sich Kästners Moralbegriff nach 1945?
Nach dem Krieg beschäftigte sich Kästner mit der Vergangenheitsbewältigung. In Werken wie "Notabene 45" reflektierte er die Verunsicherung einer Zeit, in der Unrecht wieder zu Recht wurde, und versuchte, neue Werte zu vermitteln.
Welche Rolle spielt das Werk "Fabian" in Bezug auf Kästners Moralvorstellungen?
Der Roman "Fabian. Die Geschichte eines Moralisten" ist Kästners bekanntestes satirisches Werk für Erwachsene, in dem er seine moralischen Ansichten und die Dekadenz der Gesellschaft verarbeitet.
Wem wollte Kästner seine moralischen Werte vermitteln?
Kästner nutzte breit gefächerte Medien, um seine Werte zu verbreiten. Seine Zielgruppen reichten von Kindern bis hin zu Erwachsenen, wobei seine "Gebrauchslyrik" selbst während der Zeit des Verbots heimlich gelesen wurde.
- Citation du texte
- Angelika Otto (Auteur), 2008, Erich Kästner und die Moral, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159218