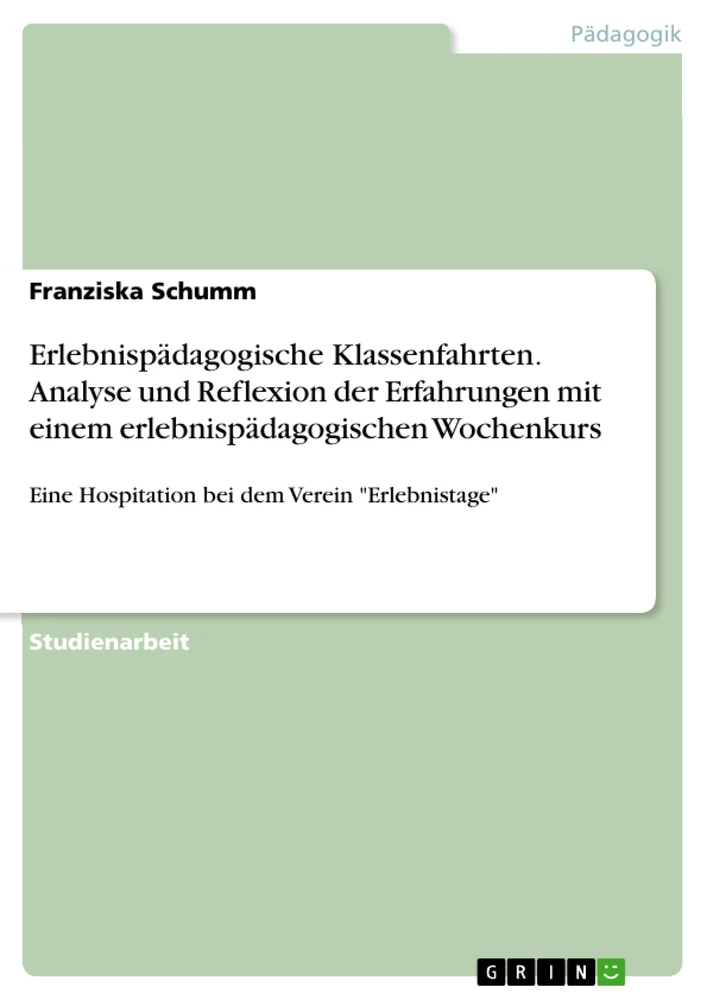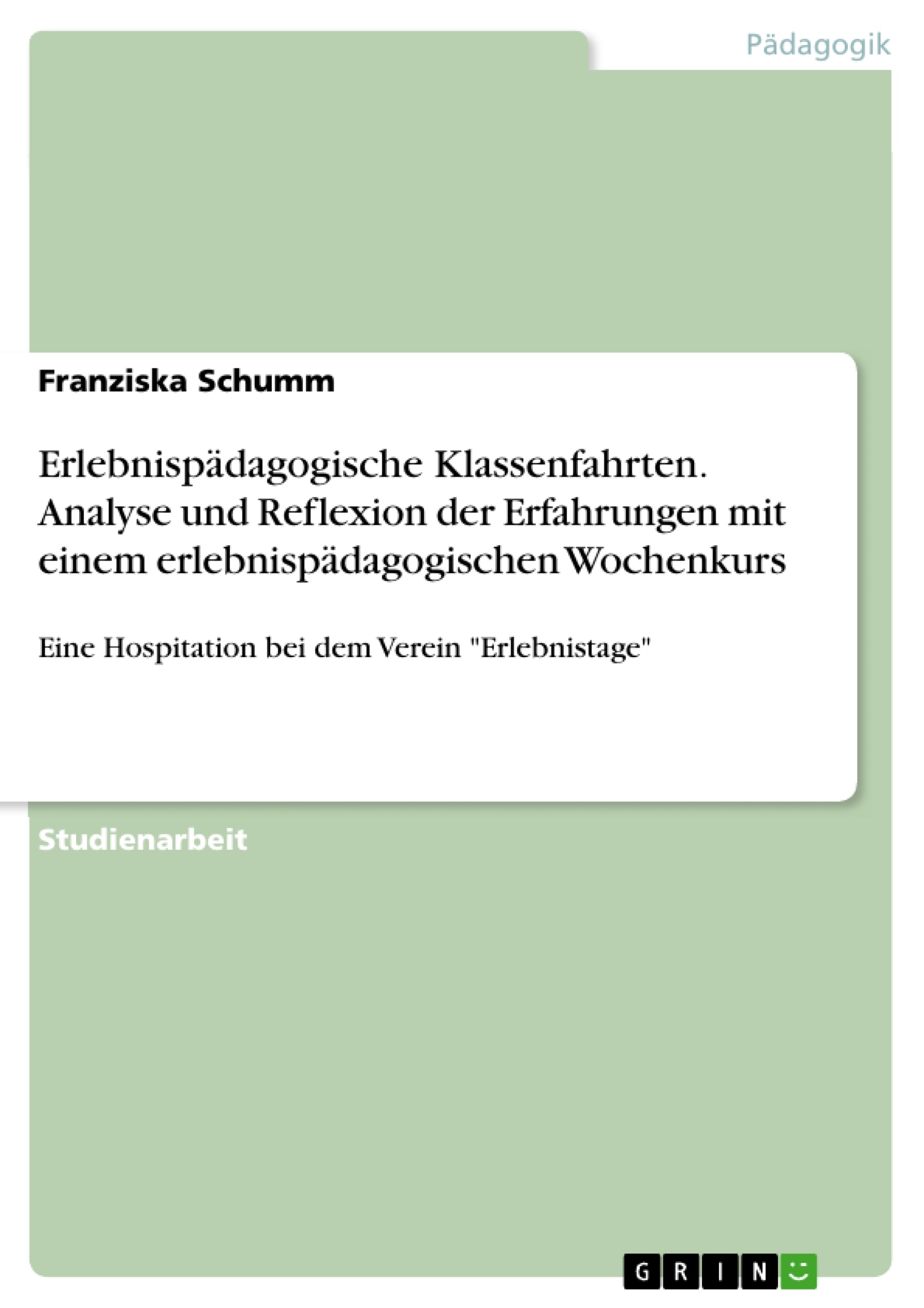Die vorliegende Arbeit lässt sich in insgesamt drei Teile untergliedern: In einem ersten, theoretischen Teil werden Merkmale, Ziele und Methoden der Erlebnispädagogik erläutert. Darüber hinaus befasst sich ein Kapitel mit der Theorie erlebnispädagogischer Schulfahrten. Die beiden nachfolgenden Kapitel widmen sich der praktischen Erlebnispädagogik, exemplarisch vollzogen anhand der Erfahrungen während der Hospitationswoche.
Hierfür wird in einem ersten Arbeitsschritt der Verein "Erlebnistage" sowie dessen pädagogisches Angebot vorgestellt. Anschließend folgt die Beschreibung des im Rahmen der Hospitation durchgeführten Kursprogramms. Den abschließenden, dritten Teil der Arbeit bildet die kritische Betrachtung des Wochenprogramms im Hinblick auf gruppendynamische Veränderungsprozesse, die Zusammenarbeit im Team sowie das eigene pädagogische Handeln. Ferner werden, auch unter Einbezug der Wissenschaftstheorie, allgemeine Überlegungen zur Wirksamkeit erlebnispädagogischer Schulfahrten angestellt werden. Hierbei wird es auch um die Beantwortung der Frage gehen, inwiefern erlebnispädagogische Schulfahrten als spezifische Form der Kurzzeitpädagogik Wirkung entfalten können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen der Erlebnispädagogik
- Merkmale und Ziele erlebnispädagogischen Handelns
- Methoden der Erlebnispädagogik
- Erlebnispädagogische Schulfahrten
- Merkmale und Besonderheiten erlebnispädagogischer Schulfahrten
- Chancen erlebnispädagogischer Schulfahrten
- Die Institution ERLEBNISTAGE
- Pädagogisches Profil und Selbstverständnis
- Pädagogisches Angebot der ERLEBNISTAGE
- Praktische Durchführung einer erlebnispädagogischen Schulfahrt
- Zielgruppenbeschreibung und Erwartungen seitens der TeilnehmerInnen an das Kursprogramm
- Vorstellung des Wochenprogramms
- Die Elemente des Kursprogramms: Erläuterung und Intention
- Ablauf
- Reflexion
- Gruppendynamische Veränderungsprozesse – Ergebnisse der Teilnehmenden Beobachtung
- Aspekte zur Handlungsfähigkeit im Team
- Auseinandersetzung mit dem eigenen pädagogischen Handeln
- Abschließende Überlegungen zur Wirksamkeit erlebnispädagogischer Schulfahrten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wirksamkeit von erlebnispädagogischen Klassenfahrten, die im Rahmen der Kurzzeitpädagogik zur Förderung der Selbst- und Sozialkompetenz von Jugendlichen eingesetzt werden. Sie basiert auf einer Hospitationswoche bei dem Verein ERLEBNISTAGE und analysiert die beobachteten Veränderungen im Klassengefüge sowie die Erfahrungen mit dem erlebnispädagogischen Programm. Die Arbeit ist keine wissenschaftliche Evaluation, sondern soll ein kritisches Referat und eine Reflexion der erlebten Erfahrungen liefern.
- Merkmale und Ziele der Erlebnispädagogik
- Methoden der Erlebnispädagogik und ihre Anwendung in der Praxis
- Die Bedeutung von erlebnispädagogischen Schulfahrten für die Entwicklung der Persönlichkeit
- Analyse der gruppendynamischen Veränderungen während der Hospitationswoche
- Bewertung der Wirksamkeit erlebnispädagogischer Methoden in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung führt in die Thematik der Erlebnispädagogik ein und stellt die Zielsetzung der Arbeit sowie die Forschungsfrage dar.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen der Erlebnispädagogik. Es werden die Merkmale und Ziele sowie die Methoden der Erlebnispädagogik erläutert. Außerdem wird das Konzept der erlebnispädagogischen Schulfahrten im Detail beleuchtet.
- Kapitel 3: Hier wird die Institution ERLEBNISTAGE vorgestellt, die sich seit 20 Jahren auf erlebnispädagogische Klassenfahrten spezialisiert hat. Die Kapitel beschreiben das pädagogische Profil und Selbstverständnis sowie das Angebot der ERLEBNISTAGE.
- Kapitel 4: In diesem Kapitel wird die praktische Durchführung einer erlebnispädagogischen Schulfahrt beschrieben, die während der Hospitationswoche beobachtet wurde. Es werden die Zielgruppe, die Erwartungen der Teilnehmer und das detaillierte Wochenprogramm vorgestellt.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel beinhaltet die Reflexion der Erfahrungen mit der erlebnispädagogischen Schulfahrt. Es werden die beobachteten Veränderungen im Klassengefüge, die Aspekte zur Handlungsfähigkeit im Team und die Auseinandersetzung mit dem eigenen pädagogischen Handeln analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Erlebnispädagogik im Kontext der Kurzzeitpädagogik. Im Fokus stehen die Förderung von Selbst- und Sozialkompetenz bei Jugendlichen, die Anwendung von erlebnispädagogischen Methoden und die Analyse der Wirkungen auf die Entwicklung der Persönlichkeit. Die Arbeit veranschaulicht diese Themen anhand der Erfahrungen einer Hospitation bei dem Verein ERLEBNISTAGE, der erlebnispädagogische Klassenfahrten für verschiedene Zielgruppen anbietet.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Ziele der Erlebnispädagogik auf Klassenfahrten?
Primäre Ziele sind die Förderung der Selbst- und Sozialkompetenz, die Stärkung des Klassengefüges und die persönliche Entwicklung durch Herausforderungen in der Natur.
Welche Methoden nutzt die Erlebnispädagogik?
Dazu gehören Kooperationsspiele, Problemlöseaufgaben in der Gruppe, Klettern oder Outdoor-Aktivitäten, die Reflexionsphasen beinhalten.
Was versteht man unter „Kurzzeitpädagogik“?
Es beschreibt pädagogische Interventionen über einen kurzen Zeitraum (z. B. eine Woche), die dennoch intensive Lernprozesse und Veränderungen anstoßen sollen.
Wie wirken erlebnispädagogische Wochenkurse auf die Gruppendynamik?
Die Arbeit analysiert, wie durch gemeinsame Grenz- und Erfolgserlebnisse Vorurteile abgebaut und die Zusammenarbeit im Team verbessert werden können.
Welche Rolle spielt die Reflexion nach einer Aktivität?
Die Reflexion ist entscheidend, um das Erlebte zu verarbeiten, Lerneffekte bewusst zu machen und den Transfer in den Schulalltag zu ermöglichen.
- Arbeit zitieren
- Franziska Schumm (Autor:in), 2009, Erlebnispädagogische Klassenfahrten. Analyse und Reflexion der Erfahrungen mit einem erlebnispädagogischen Wochenkurs, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159219