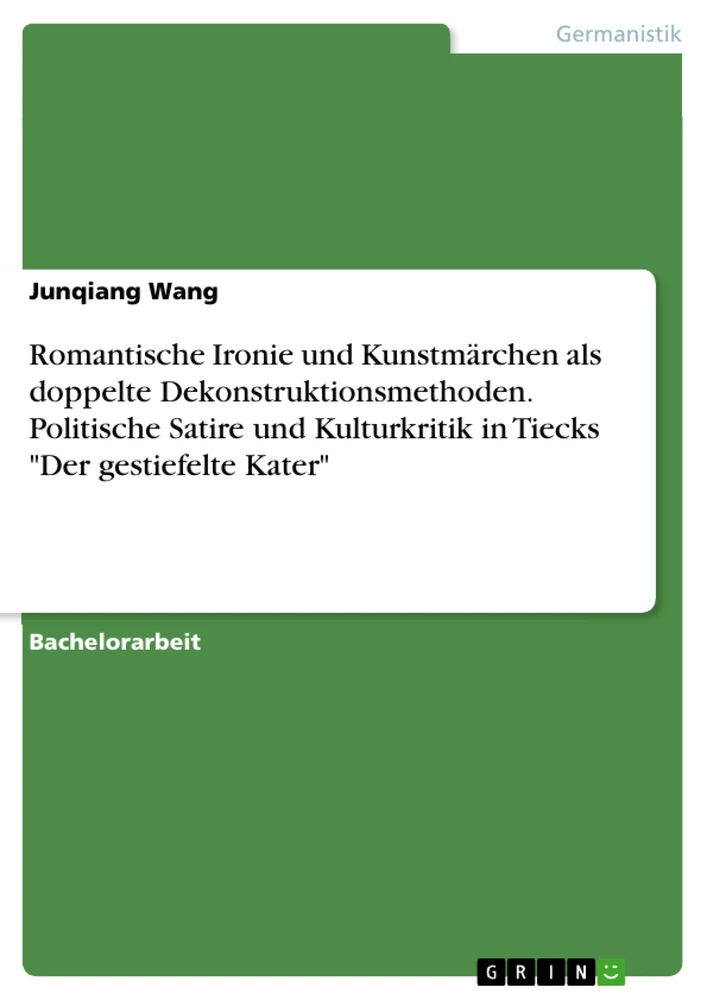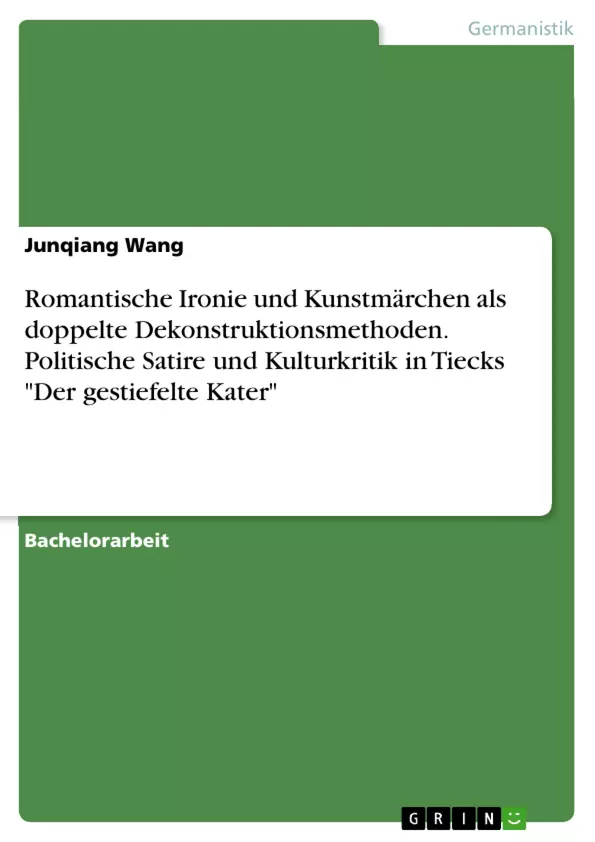Ludwig Tiecks Komödie "Der gestiefelte Kater" (1797) stellt ein Schlüsseldokument der deutschen Frühromantik dar – ein Werk, das zugleich poetisch verspielt, metadramatisch reflektiert und politisch brisant ist. In der vorliegenden Studie wird das komplexe Lustspiel nicht lediglich als bloße Märchenadaption betrachtet, sondern zunächst als ein vielschichtiges Werk eingeordnet, das auf bekannte Motive zurückgreift und zugleich deren Konventionen bewusst unterläuft. Im Fokus steht dabei seine Funktion als raffiniert konstruiertes ästhetisches Experiment, das zentrale Merkmale der romantischen Poetik wie Ironie, Fragmentarität, Selbstreflexivität und Gattungsüberschreitung verkörpert.
Im Mittelpunkt steht die These, dass Tieck eine doppelte Dekonstruktionsstrategie verfolgt – durch die Verbindung von Friedrich Schlegels Konzept der romantischen Ironie mit der Gattungsstruktur des Kunstmärchens. Diese doppelte Strategie erlaubt es dem Autor, sowohl traditionelle Erzähl- und Theaterkonventionen als auch die rationalistische Ideologie der Aufklärung auf vielschichtige Weise zu hinterfragen. Besonders durch die Einbindung eines fiktiven Publikums, das das Geschehen kommentiert, sowie durch ironische Brechungen auf mehreren Erzählebenen, gelingt es Tieck, die dramatische Illusion gezielt zu unterlaufen und dem Werk eine kritische Tiefenschärfe zu verleihen.
Auf Grundlage eines interdisziplinären Zugangs – literaturtheoretisch, kulturhistorisch und textanalytisch – untersucht die Arbeit sowohl die ästhetischen Verfahren als auch deren gesellschaftskritische Funktion. Im Zentrum stehen dabei die satirische Auseinandersetzung mit höfischer Machtpolitik, die Kritik an bürgerlich-trivialem Geschmack und die ironische Demontage der sentimentalischen Theaterkonventionen der Zeit. Darüber hinaus wird gezeigt, wie Tieck das Märchenhafte bewusst instrumentalisiert, um in Form eines Kunstmärchens radikale kulturkritische Impulse zu formulieren.
Die Studie versteht sich nicht nur als Beitrag zur Tieck-Forschung, sondern auch zur Theoriebildung romantischer Literatur, zur Gattungsforschung des Kunstmärchens sowie zur deutsch-chinesischen Rezeption der Frühromantik. Sie richtet sich an Literaturwissenschaftler:innen, Studierende der Germanistik sowie alle Leser:innen, die ein vertieftes Verständnis für die politische und poetologische Sprengkraft der Romantik gewinnen möchten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Forschungshintergrund
- 1.2 Literaturüberblick
- 1.2.1 Inhaltsangabe zu Ludwig Tiecks Version von Der gestiefelte Kater
- 1.2.2 Der gestiefelte Kater und Forschungsstand des Werks im In- und Ausland
- 1.2.3 Romantische Ironie und Kunstmärchen: Forschungsstand und dessen Entwicklung
- 1.3 Bedeutung und Zielsetzung
- 2. Theoretischer Rahmen: Romantische Ironie und Kunstmärchen als doppelte Dekonstruktionsmethoden
- 2.1 Konzeption der romantischen Ironie
- 2.1.1 Einleitung
- 2.1.2 Friedrich Schlegels Theorie der romantischen Ironie
- 2.1.3 Entwicklung der Theorie der romantischen Ironie und Tiecks praktische Neugestaltung
- 2.2 Konzeption des Kunstmärchens
- 2.2.1 Ursprung und Merkmale des Kunstmärchens
- 2.2.2 Ludwig Tiecks Der gestiefelte Kater als Praxis des Kunstmärchens
- 2.3 Doppelte Dekonstruktion: Die kritische Verbindung von romantischer Ironie und Kunstmärchen
- 3. Romantische Ironie und Kunstmärchen als Werkzeuge der Tieckschen Kulturkritik
- 3.1 Dekonstruktion der Empfindsamkeit: Tiecks Parodie der populären Gefühlskultur
- 3.2 Tiecks Kritik an trivialliterarischen Konventionen im Gestiefelten Kater
- 3.2.1 Jenseits der Formel: Tiecks Dekonstruktion trivialliterarischer Konventionen am Beispiel der „Geistergeschichte“
- 3.2.2 Tiecks Kritik am oberflächlichen Exotismus im zeitgenössischen Drama
- 3.3 Ironische Brechungen: Tiecks Dialog mit literarischen Autoritäten
- 4. Machtspiegel und Zeitkritik: Die vielschichtige politische Satire in Tiecks Der gestiefelte Kater
- 4.1 Verspottung der Monarchie und höfische Zustände: Preußische Spiegelungen im Schatten Friedrich Wilhelms II
- 4.1.1 Die Satire auf die Königsfigur – Anspielung auf die Verblendung und Ohnmächtigkeit Friedrich Wilhelms II
- 4.1.2 Die Satire auf das höfische Milieu – Ein Nährboden für Verstellung, Gefühlsschwelgerei und intellektuelle Armut
- 4.2 Literaturparodie und Zensurumgehung: Die doppelte Satire auf Kotzebues Possen und den Prinzen von Malsinki
- 4.2.1 Die politische Anspielungsebene des Prinzen von Malsinki – Hinweis auf den russischen Zaren Paul I
- 4.2.2 Satirische Kunst unter Zensurbedingungen: Literaturkritik als „Rauchvorhang“
- 4.3 Der Mythos des „Dritten Standes“ und das Wesen des Machtspiels: Eine satirische Allegorie auf Revolutionsdesillusionierung und Neuordnung
- 4.3.1 Die satirische Darstellung der Herrschaft des „Dritten Standes“: Die Aushöhlung revolutionärer Ideale
- 4.3.2 Das Wesen des Machtwechsels - Hinzes Manipulation und Gottliebs Marionettendasein: Eine allegorische Dekonstruktion der „Realpolitik“
- 4.4 Fazit
- 5. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Ludwig Tiecks "Der gestiefelte Kater" unter dem Aspekt der romantischen Ironie und des Kunstmärchens. Ziel ist es, die komplexen künstlerischen Techniken und die tiefgründige Kritik des Werkes zu analysieren und dessen kulturellen und politischen Wert aufzuzeigen. Die Arbeit trägt zur Erforschung der deutschen Frühromantik und ihrer dramatischen Schöpfungen bei.
- Analyse der romantischen Ironie in Tiecks "Der gestiefelte Kater"
- Untersuchung der gattungsspezifischen Merkmale des Kunstmärchens im Stück
- Interpretation der politischen Satire und Kulturkritik des Werkes
- Erforschung des Zusammenspiels von künstlerischer Form und gesellschaftskritischer Funktion
- Beitrag zur Erforschung der deutschen Frühromantik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel legt den Forschungshintergrund, die Bedeutung, Ziele und Fragestellungen der Arbeit dar und gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Tiecks "Der gestiefelte Kater", der romantischen Ironie und dem Kunstmärchen. Es wird die Relevanz der gewählten Forschungsmethode und des gewählten Gegenstandes herausgestellt und die Struktur der Arbeit skizziert.
2. Theoretischer Rahmen: Romantische Ironie und Kunstmärchen als doppelte Dekonstruktionsmethoden: Dieses Kapitel erläutert die zentralen theoretischen Konzepte der romantischen Ironie und des Kunstmärchens. Es beschreibt die Entwicklung der Theorie der romantischen Ironie, insbesondere die Beiträge Friedrich Schlegels, und beleuchtet die gattungsspezifischen Merkmale des Kunstmärchens. Im Mittelpunkt steht die Verbindung beider Konzepte als "doppelte Dekonstruktion" zur Analyse von Tiecks Werk.
3. Romantische Ironie und Kunstmärchen als Werkzeuge der Tieckschen Kulturkritik: Dieses Kapitel analysiert die Kulturkritik in Tiecks "Der gestiefelte Kater". Es untersucht, wie die romantische Ironie und die Kunstmärchenstruktur dazu verwendet werden, die Empfindsamkeit, trivialliterarische Konventionen und den oberflächlichen Exotismus des zeitgenössischen Dramas zu dekonstruieren und zu kritisieren. Der Dialog Tiecks mit literarischen Autoritäten wird ebenfalls beleuchtet.
4. Machtspiegel und Zeitkritik: Die vielschichtige politische Satire in Tiecks Der gestiefelte Kater: Dieses Kapitel befasst sich mit der politischen Satire des Stückes. Es analysiert die Verspottung der Monarchie und der höfischen Zustände, insbesondere die Anspielungen auf Friedrich Wilhelm II. Die Literaturparodie und die Zensurumgehung werden untersucht, ebenso die satirische Darstellung der Herrschaft des "Dritten Standes" und die Dekonstruktion der "Realpolitik".
Schlüsselwörter
Tieck, romantische Ironie, Kunstmärchen, politische Satire, Kulturkritik, "Der gestiefelte Kater", Frühromantik, Dekonstruktion, Aufklärung, Rationalismus.
Häufig gestellte Fragen zu Ludwig Tiecks "Der gestiefelte Kater"
Was ist das Hauptthema der Analyse zu Ludwig Tiecks "Der gestiefelte Kater"?
Die vorliegende Arbeit untersucht Ludwig Tiecks "Der gestiefelte Kater" unter dem Aspekt der romantischen Ironie und des Kunstmärchens. Ziel ist es, die komplexen künstlerischen Techniken und die tiefgründige Kritik des Werkes zu analysieren und dessen kulturellen und politischen Wert aufzuzeigen.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Analyse behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen die Analyse der romantischen Ironie, die Untersuchung der gattungsspezifischen Merkmale des Kunstmärchens, die Interpretation der politischen Satire und Kulturkritik, die Erforschung des Zusammenspiels von künstlerischer Form und gesellschaftskritischer Funktion sowie einen Beitrag zur Erforschung der deutschen Frühromantik.
Was behandelt das erste Kapitel der Analyse?
Das erste Kapitel legt den Forschungshintergrund, die Bedeutung, Ziele und Fragestellungen der Arbeit dar und gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Tiecks "Der gestiefelte Kater", der romantischen Ironie und dem Kunstmärchen.
Was ist der Inhalt des zweiten Kapitels?
Das zweite Kapitel erläutert die zentralen theoretischen Konzepte der romantischen Ironie und des Kunstmärchens. Es beschreibt die Entwicklung der Theorie der romantischen Ironie, insbesondere die Beiträge Friedrich Schlegels, und beleuchtet die gattungsspezifischen Merkmale des Kunstmärchens. Im Mittelpunkt steht die Verbindung beider Konzepte als "doppelte Dekonstruktion" zur Analyse von Tiecks Werk.
Was analysiert das dritte Kapitel?
Das dritte Kapitel analysiert die Kulturkritik in Tiecks "Der gestiefelte Kater". Es untersucht, wie die romantische Ironie und die Kunstmärchenstruktur dazu verwendet werden, die Empfindsamkeit, trivialliterarische Konventionen und den oberflächlichen Exotismus des zeitgenössischen Dramas zu dekonstruieren und zu kritisieren.
Womit beschäftigt sich das vierte Kapitel?
Das vierte Kapitel befasst sich mit der politischen Satire des Stückes. Es analysiert die Verspottung der Monarchie und der höfischen Zustände, insbesondere die Anspielungen auf Friedrich Wilhelm II. Die Literaturparodie und die Zensurumgehung werden untersucht, ebenso die satirische Darstellung der Herrschaft des "Dritten Standes" und die Dekonstruktion der "Realpolitik".
Welche Schlüsselwörter sind mit der Analyse verbunden?
Zu den Schlüsselwörtern gehören: Tieck, romantische Ironie, Kunstmärchen, politische Satire, Kulturkritik, "Der gestiefelte Kater", Frühromantik, Dekonstruktion, Aufklärung, Rationalismus.
Was ist die "doppelte Dekonstruktion" im Kontext der Analyse?
Die "doppelte Dekonstruktion" bezieht sich auf die Verbindung von romantischer Ironie und Kunstmärchen als analytische Werkzeuge, um Tiecks Werk zu interpretieren und seine tiefere Bedeutungsebenen aufzudecken.
- Quote paper
- Junqiang Wang (Author), 2025, Romantische Ironie und Kunstmärchen als doppelte Dekonstruktionsmethoden. Politische Satire und Kulturkritik in Tiecks "Der gestiefelte Kater", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1592713