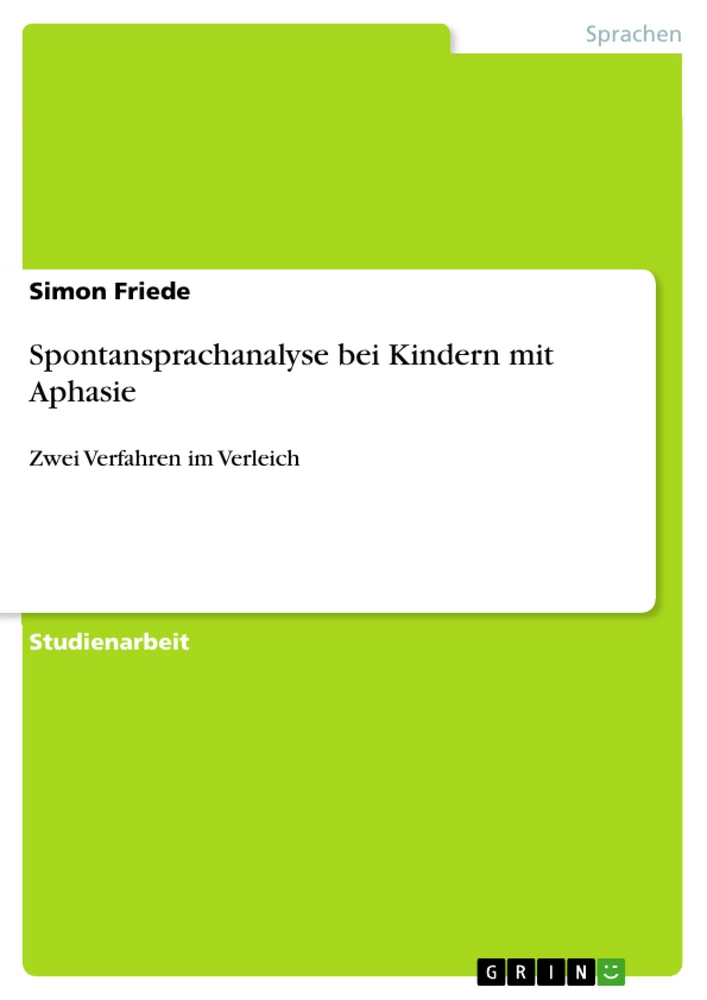Die Spontansprachanalyse ist in der Aphasieforschung eine weit verbreitete Methode. Es finden sich einige Studien über verschiedene Verfahren mit unterschiedlichen Schwerpunkten bzw. Forschungsfragen. Generell kann man diese Verfahren jedoch in zwei Gruppen unterteilen. Auf der einen Seite finden sich die qualitativen Verfahren und auf der anderen Seite die quantitativen Verfahren (vgl. Prins & Bastiaanse, 2004).
In dieser Arbeit werden nun zwei Studien zur Spontansprachanalyse bei Kindern mit Aphasie kurz vorgestellt und miteinander bzgl. ihrer Ziele, Methode und Ergebnisse verglichen und bewertet.
In Kapitel und 1 und 2 werden die beiden ausgewählten Artikel vorgestellt.
"Clinical evaluation of conversational speech fluency in the acute phase of acquired childhood aphasia: Does a fluency/nonfluency dichotomy exist?" van Dongen HR, Paquier PF, Creten WL, van Borsel J, Catsman-Berrevoets CE, (2001): Journal of child neurology. 16:5; 345-351.
"An Analysis of Spontaneous Conversational Speech Fluency in Children with Acquired Aphasia." Van Dongen HR, Paquier PF, Raes J, Creten WL, (1994): Cortex. 30:4; 619-633.
Die Gliederung folgt dem jeweiligen Aufbau der beiden Artikel. In Kapitel 3 werden die Artikel hinsichtlich ihrer Ziele, Methode und Ergebnisse verglichen und bewertet. Die Arbeit endet mit einer abschließenden Bemerkung in Kapitel 4.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Clinical evaluation of conversational speech fluency in the acute phase of acquired childhood aphasia: Does a fluency/nonfluency dichotomy exist?
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Patienten und Methode
- 1.3 Ergebnisse
- 1.4 Diskussion
- 2 An Analysis of Spontaneous Conversational Speech Fluency in Children with Acquired Aphasia.
- 2.1 Einleitung
- 2.2 Material und Methode
- 2.3 Ergebnisse
- 2.4 Diskussion
- 3 Kritische Gegenüberstellung der beiden Artikel
- 3.1 Ziele im Vergleich
- 3.2 Methoden im Vergleich
- 3.3 Ergebnisse im Vergleich
- 4 Abschließende Bemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Spontansprachanalyse bei Kindern mit Aphasie und vergleicht zwei Verfahren zur Analyse der Sprachflüssigkeit. Ziel ist es, die beiden Verfahren in Bezug auf ihre Ziele, Methoden und Ergebnisse zu analysieren und zu bewerten.
- Untersuchung der Sprachflüssigkeit bei Kindern mit Aphasie
- Vergleich zweier Verfahren zur Spontansprachanalyse
- Bewertung der Ziele, Methoden und Ergebnisse der beiden Verfahren
- Analyse der Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Verfahren
- Diskussion der Relevanz der Ergebnisse für die klinische Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt den Artikel "Clinical evaluation of conversational speech fluency in the acute phase of acquired childhood aphasia: Does a fluency/nonfluency dichotomy exist?" von van Dongen et al. (2001) vor und behandelt die Frage, ob sich eine Trennung zwischen flüssiger und unflüssiger Aphasie bei Kindern nachweisen lässt.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Artikel "An Analysis of Spontaneous Conversational Speech Fluency in Children with Acquired Aphasia." von van Dongen et al. (1994) und beleuchtet die Analyse der Spontansprachanalyse bei Kindern mit Aphasie anhand eines anderen Verfahrens.
Kapitel 3 stellt einen Vergleich der beiden Artikel dar und analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Ziele, Methoden und Ergebnisse der beiden Verfahren.
Schlüsselwörter
Spontansprachanalyse, kindliche Aphasie, Sprachflüssigkeit, Verfahren, Vergleich, Ziele, Methoden, Ergebnisse, klinische Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Spontansprachanalyse bei Aphasie?
Ziel ist die Untersuchung der Sprachflüssigkeit und Kommunikationsfähigkeit von Patienten, um Therapieerfolge messbar zu machen und Diagnosen zu präzisieren.
Welche zwei Arten von Verfahren werden unterschieden?
In der Forschung wird generell zwischen qualitativen und quantitativen Verfahren der Spontansprachanalyse unterschieden.
Gibt es bei Kindern eine klare Trennung zwischen flüssiger und unflüssiger Aphasie?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage (Dichotomie) anhand der Studien von van Dongen et al., um festzustellen, ob dieses Modell bei Kindern anwendbar ist.
Welche Studien werden in diesem Dokument verglichen?
Verglichen werden zwei Artikel von van Dongen et al. aus den Jahren 1994 und 2001, die sich mit Sprachflüssigkeit bei erworbener kindlicher Aphasie befassen.
Warum ist die Spontansprache in der Diagnostik so wichtig?
Sie spiegelt die tatsächliche Kommunikationsfähigkeit im Alltag besser wider als standardisierte Einzelworttests.
Was wird im Kapitel 3 der Arbeit analysiert?
In Kapitel 3 erfolgt eine kritische Gegenüberstellung der Ziele, Methoden und Ergebnisse der beiden vorgestellten wissenschaftlichen Artikel.
- Quote paper
- B.Sc. Simon Friede (Author), 2009, Spontansprachanalyse bei Kindern mit Aphasie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159280