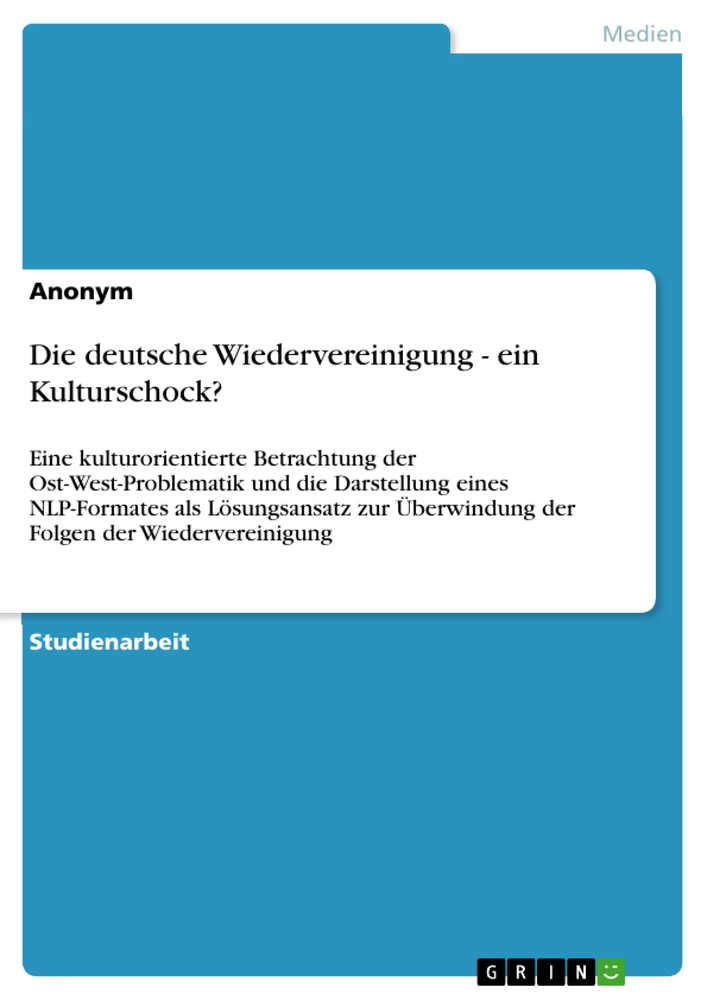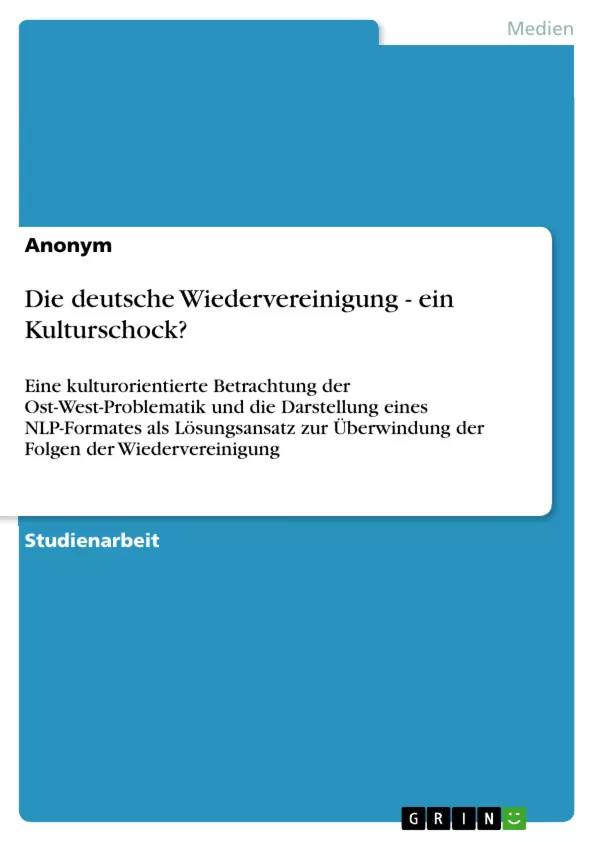„Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört.“, sagte Willy Brandt, damals regierender Bürgermeister West-Berlins, kurz nach dem Fall der Berliner Mauer. Nach 40 Jahren, in denen zwei politisch und wirtschaftlich gegensätzlich orientierte Staaten nebeneinander existiert hatten, kam die Wiedervereinigung Deutschlands plötzlich und unverhofft. Voller Zuversicht und Optimismus blickte die deutsche Bevölkerung der gemeinsamen Zukunft damals entgegen. Doch ist die Wiedervereinigung auf allen Ebenen gelungen, sind die beiden deutschen Teilstaaten tatsächlich nahtlos zu einer Einheit zusammengewachsen? Die vorliegende Arbeit beleuchtet die deutsche Wiedervereinigungsgeschichte aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive und versucht so herauszuarbeiten, welche Folgen die Wende insbesondere für die ostdeutsche Bevölkerung mit sich gebracht hat. Für die BüergerInnen der DDR bedeutete die Wende nicht nur eine Integration in ein neues wirtschaftliches und politisches System, sie mussten sich zudem in einer anders geprägten Kultur orientieren. Um herauszuarbeiten, welchen kulturellen Schwierigkeiten sich die Ostdeutschen gegenübersahen, bietet im Rahmen dieser Arbeit das Kulturschockmodell Wolf Wagners eine theoretische Basis. Mithilfe dieses Modells wird aufgezeigt, ob und in welcher Form bezüglich der Wendezeit von einem zu verarbeitenden Kulturschock gesprochen werden kann. Anschließend wird dargestellt, welche Folgen dieser Kulturschock mit sich gebracht hat und welche Präsenz diese Folgen auch heute noch im Alltag vieler Ostdeutschen haben. In einem letzten Schritt wird ein Format aus dem Bereich des Neurolinguistischen Programmierens (NLP) vorgestellt, welches einen möglichen Lösungsansatz bietet, die Folgen des innerdeutschen Kulturschocks, die im Leben vieler Ostdeutschen auch heute, 20 Jahre nach dem Fall der Mauer, noch präsent sind, zu verarbeiten und den Integrationsprozess so endgültig abzuschließen. Diese Arbeit versucht, die Ost-West Problematik aus einer Perspektive zu betrachten, die die Dringlichkeit, der diese Thematik auch heute noch unterliegt, verdeutlicht. Gleichzeitig wird ein Lösungsansatz angeboten, der eine endgültige Verarbeitung der Folgen der Wiedervereinigung ermöglichen könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Kulturschocktheorie
- Ein Kulturkonzept
- Das Kulturschockmodell
- Die einzelnen Phasen des Kulturschocks nach Wagner
- Der innerdeutsche Kulturschock
- Ein historischer Abriss zur deutschen Teilungsgeschichte
- Ein Land – zwei Kulturen
- Der Verlauf des innerdeutschen Kulturschocks
- Die Euphorie
- Die Entfremdung
- Die Eskalation
- Ein Ansatz zur Lösung des Ost- Westkonflikts mithilfe des NLP
- Neurolinguistisches Programmieren
- Die Möglichkeiten des NLP
- Ein NLP- Format als Lösungsansatz zur Überwindung des Konfliktes
- Die Grenzen des NLP bei der Überwindung des NLP
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der deutschen Wiedervereinigung und ihren Folgen, insbesondere für die ostdeutsche Bevölkerung, aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive. Sie untersucht, ob die Wiedervereinigung als Kulturschock verstanden werden kann und welche kulturellen Schwierigkeiten die Ostdeutschen durchleben mussten.
- Die Anwendung der Kulturschocktheorie auf die deutsche Wiedervereinigung
- Analyse der Auswirkungen des innerdeutschen Kulturschocks auf die ostdeutsche Gesellschaft
- Bewertung des NLP als möglichen Lösungsansatz zur Bewältigung der Folgen des Kulturschocks
- Die Bedeutung von Kultur und Orientierungssystem im Kontext der deutschen Wiedervereinigung
- Die Herausforderungen der Integration und die langfristigen Folgen des innerdeutschen Kulturschocks
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert die Ausgangssituation und die Forschungsfrage der Arbeit. Sie beleuchtet die deutsche Wiedervereinigung als ein historisches Ereignis, das sowohl mit Hoffnungen als auch mit Unsicherheiten verbunden war. Der Fokus liegt auf den kulturellen Auswirkungen der Wiedervereinigung und der Frage, ob ein Kulturschock für die Ostdeutsche Bevölkerung zu verzeichnen war.
Kapitel 2 widmet sich der Kulturschocktheorie. Es wird zunächst ein Kulturkonzept vorgestellt, das als Grundlage für die Analyse des Kulturschocks dient. Das Modell von Wolf Wagner wird erläutert und die einzelnen Phasen des Kulturschocks werden beschrieben. Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die spätere Analyse der deutschen Wiedervereinigung im Kontext der Kulturschocktheorie.
Kapitel 3 widmet sich dem innerdeutschen Kulturschock. Es erfolgt eine historische Darstellung der deutschen Teilungsgeschichte, die den Kontext für die Wiedervereinigung beleuchtet. Im Anschluss wird die Situation der Ostdeutschen nach der Wende analysiert, wobei die Einführung in ein neues politisches und wirtschaftliches System im Vordergrund steht. Die unterschiedlichen kulturellen Prägungen beider Teile Deutschlands werden beleuchtet und der Verlauf des innerdeutschen Kulturschocks in seinen verschiedenen Phasen – Euphorie, Entfremdung und Eskalation – wird dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die deutsche Wiedervereinigung aus der Perspektive des Kulturschocks. Sie untersucht die kulturellen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland sowie die Auswirkungen des innerdeutschen Kulturschocks auf die ostdeutsche Bevölkerung. Zu den zentralen Begriffen der Arbeit gehören: Kulturschocktheorie, innerdeutscher Kulturschock, Kulturkonflikt, Integration, Ost-West Problematik, NLP (Neurolinguistisches Programmieren), Orientierungssystem und Wertesystem.
Häufig gestellte Fragen
War die deutsche Wiedervereinigung ein Kulturschock für die Ostdeutschen?
Die Arbeit nutzt das Kulturschockmodell von Wolf Wagner, um aufzuzeigen, dass die plötzliche Integration in ein neues System für viele DDR-Bürger tatsächlich einen Kulturschock darstellte.
Welche Phasen des Kulturschocks werden in der Arbeit beschrieben?
Es werden die Phasen der Euphorie (nach dem Mauerfall), der Entfremdung und schließlich der Eskalation bzw. Ernüchterung analysiert.
Welche kulturellen Unterschiede erschwerten das Zusammenwachsen?
Unterschiedliche politische Prägungen, wirtschaftliche Systeme und Orientierungswerte führten zu Schwierigkeiten bei der Identitätsfindung im vereinten Deutschland.
Wie kann NLP bei der Bewältigung der Wiedervereinigungsfolgen helfen?
Die Arbeit stellt ein Format des Neurolinguistischen Programmierens vor, das als Lösungsansatz dienen kann, um verinnerlichte Konflikte und Folgen des Kulturschocks zu verarbeiten.
Warum ist das Thema 20 Jahre nach der Wende immer noch aktuell?
Die Arbeit argumentiert, dass die kulturellen Folgen und Entfremdungserfahrungen im Alltag vieler Menschen weiterhin präsent sind und den Integrationsprozess verzögern.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2010, Die deutsche Wiedervereinigung - ein Kulturschock?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159316