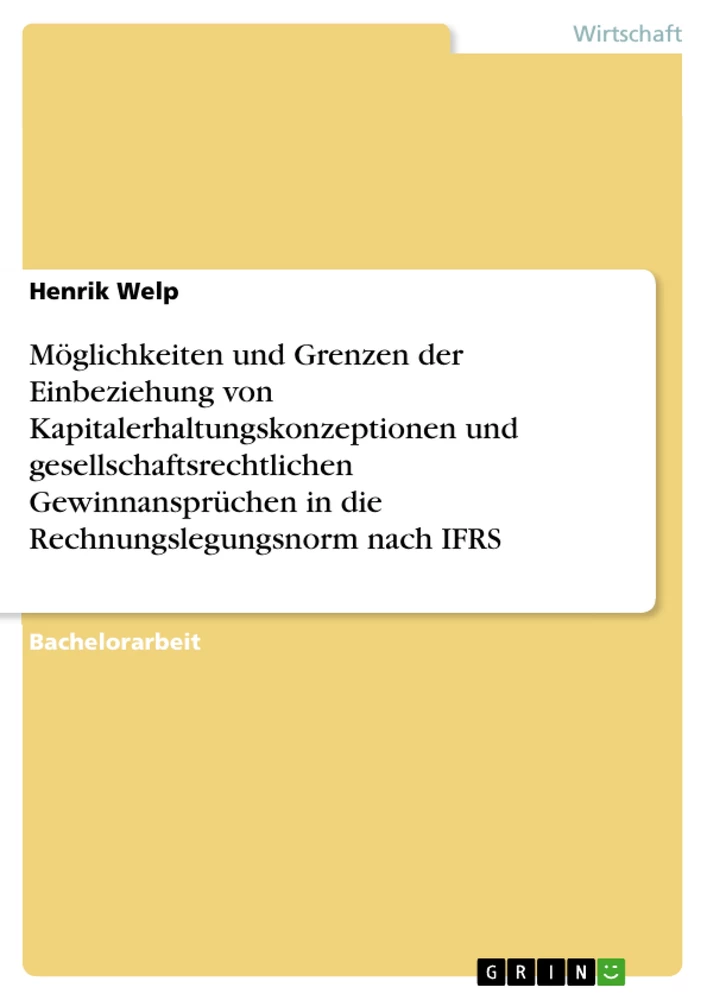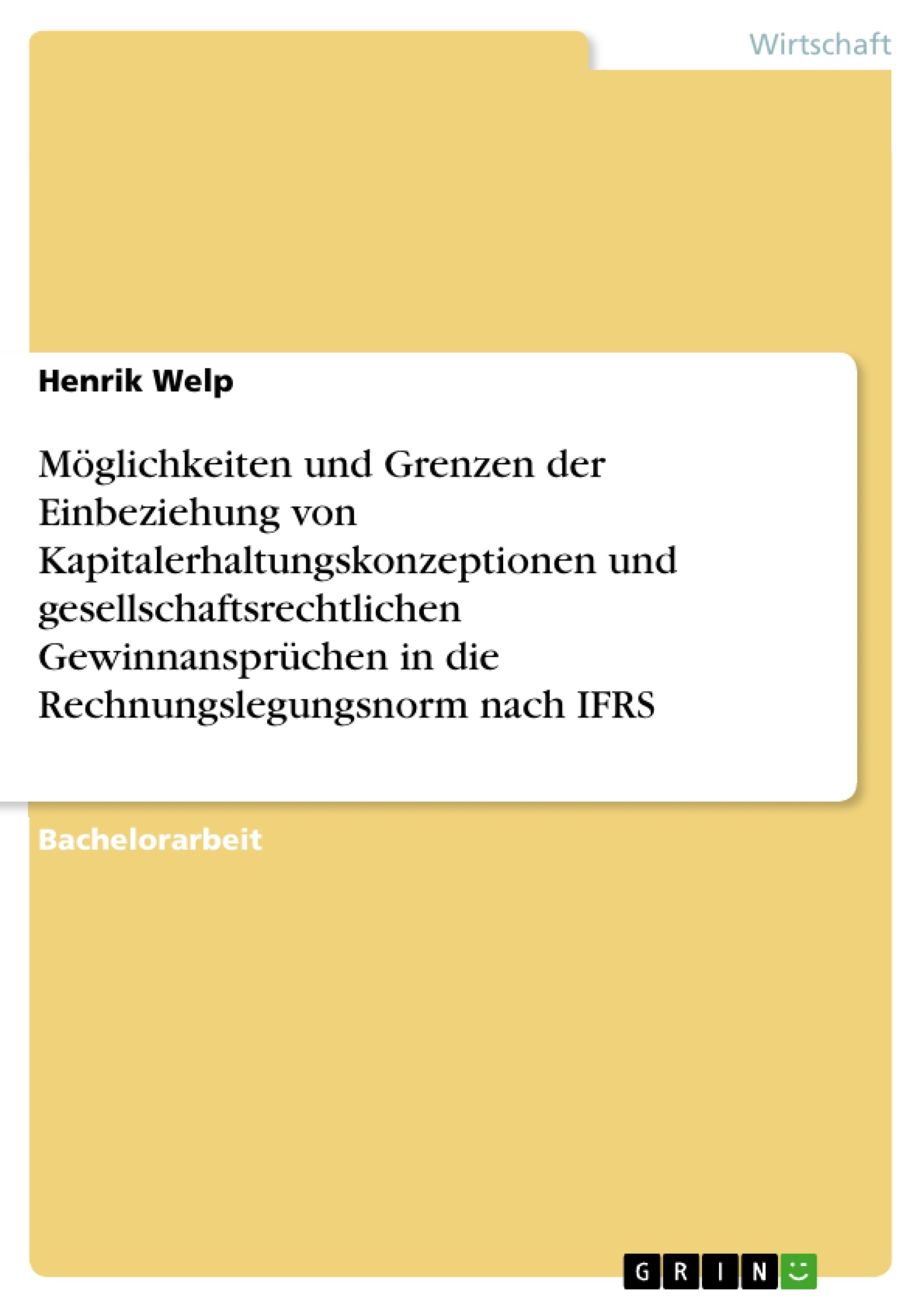Innerhalb des Bilanzrechts bestehen Zusammenhänge zwischen Bilanz- und Gesellschaftsrecht sowie zwischen Bilanz- und Steuerrecht.16 Die EG-Bilanzrichtlinie stellt eine gesellschaftsrechtliche Richtlinie dar. Diese ist eng verknüpft mit der sog. Kapitalrichtlinie.17 Innerhalb der Kapitalrichtlinie flankieren die Bilanzvorschriften dabei das System des gesetzlichen Kapitalschutzes für Kapitalgesellschaften. Daher wirft die Modernisierung des Bilanzrechts zwangsläufig auch eine entscheidende, gesellschaftsrechtliche Folgefragestellung auf: Kann im Rahmen der Umstellung auf ein gänzlich anderes Bilanzsystem und dem damit verbundenen Entzug der bilanzrechtlichen Grundlage am bisherigen Kapitalschutzsystem festgehalten werden und wie sähen entsprechende Alternativen aus?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Ursprüngliche Bilanztheorien
- 1. Bilanztheoretische Ansätze
- 2. Jahresabschluss
- 2.1. Ziele
- 2.2. Aufgaben
- 2.3. Anforderungen
- 3. Statische Bilanzinterpretation
- 4. Dynamische Bilanzinterpretation
- III. Moderne Bilanztheorien
- 1. Funktionsanalytische Bilanzlehre
- 2. Shareholder-Theorie
- 3. Stakeholder-Theorie
- 4. Stockholder Theorie
- IV. Kapitalerhaltung
- 1. Gewinnermittlung
- 2. Nominale Kapitalerhaltung
- 3. Reale Kapitalerhaltung
- V. Gläubigerschutz
- 1. Notwendigkeit des Gläubigerschutzes
- 2. Ziele des Gläubigerschutzes
- 2.1. Ausmaß des unangemessenen Insolvenzrisikos
- 2.2. Ursachen des unangemessenen Insolvenzrisikos
- 3. Europäische Kapitalrichtlinie von 1976
- 4. Änderungsrichtlinie von 2006
- 5. Kapitalschutz
- 6. Ausschüttungsbegrenzung auf Basis des informationellen Gläubigerschutzes
- VI. Solvenztests
- 1. Idee
- 2. Anforderungen
- 3. Ausgestaltung
- 4. Kritik
- VII. Gläubigerschutzalternativen
- 1. Reform-Modelle
- 1.1. Konzeption der High-Level-Group
- 1.2. Konzeption der Lutter-Gruppe
- 1.3. Konzeption der Rickford-Gruppe
- 1.4. Konzeption der Niederländischen-Gruppe
- 1.5. Konzeption des IDW
- 2. Kritische Würdigung der Modelle
- 1. Reform-Modelle
- VIII. Überleitungsrechnungen
- IX. Machbarkeitsstudie von KPMG
- 1. Hintergrund
- 2. Durchführung
- 3. Ergebnisse
- 4. Eignung der IFRS für Ausschüttung
- 5. Kapitalerhaltungssystem
- 6. Gläubigerschutz
- X. Vergleiche von Rechtssystemen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Kapitalerhaltungskonzeptionen und gesellschaftsrechtlichen Gewinnansprüchen in die Rechnungslegungsnorm nach IFRS. Sie analysiert bestehende Bilanztheorien und setzt diese in Bezug zu den Anforderungen des Gläubigerschutzes. Die Arbeit bewertet verschiedene Reformmodelle und untersucht deren Praxistauglichkeit.
- Analyse verschiedener Bilanztheorien (ursprüngliche und moderne Ansätze)
- Untersuchung von Kapitalerhaltungskonzeptionen (nominale und reale Kapitalerhaltung)
- Bewertung des Gläubigerschutzes im Kontext der IFRS
- Analyse von Reformmodellen zur Verbesserung des Gläubigerschutzes
- Bewertung der Machbarkeit der Integration der Konzepte in die IFRS
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt den Hintergrund der Modernisierung des Bilanzrechts auf europäischer Ebene. Sie erläutert die Relevanz der Untersuchung von Kapitalerhaltungskonzeptionen und gesellschaftsrechtlichen Gewinnansprüchen im Kontext der IFRS.
II. Ursprüngliche Bilanztheorien: Dieses Kapitel behandelt klassische bilanztheoretische Ansätze, die Ziele, Aufgaben und Anforderungen des Jahresabschlusses sowie statische und dynamische Bilanzinterpretationen. Es legt die Grundlagen für das Verständnis der späteren Kapitel, indem es die Entwicklung bilanztheoretischer Denkansätze aufzeigt.
III. Moderne Bilanztheorien: Hier werden moderne Bilanztheorien wie die funktionsanalytische Bilanzlehre, die Shareholder-Theorie, die Stakeholder-Theorie und die Stockholder-Theorie vorgestellt und miteinander verglichen. Die unterschiedlichen Perspektiven auf den Jahresabschluss und die Rolle des Unternehmens werden beleuchtet, um einen umfassenden Kontext für die Analyse der Kapitalerhaltung und des Gläubigerschutzes zu schaffen.
IV. Kapitalerhaltung: Dieses Kapitel definiert Kapitalerhaltung und differenziert zwischen nominaler und realer Kapitalerhaltung. Es untersucht die verschiedenen Methoden der Gewinnermittlung und deren Auswirkungen auf die Kapitalerhaltung. Die Diskussion bildet die Basis für die spätere Analyse der Ausschüttungsbegrenzungen und des Gläubigerschutzes.
V. Gläubigerschutz: Das Kapitel beleuchtet die Notwendigkeit und die Ziele des Gläubigerschutzes, inklusive der Analyse des Ausmaßes und der Ursachen unangemessener Insolvenzrisiken. Es untersucht die europäische Kapitalrichtlinie von 1976 und die Änderungsrichtlinie von 2006 sowie verschiedene Mechanismen des Kapitalschutzes und der Ausschüttungsbegrenzung.
VI. Solvenztests: Dieses Kapitel beschreibt die Idee, Anforderungen und Ausgestaltung von Solvenztests sowie die Kritik an diesen. Die Diskussion der Solvenztests liefert weitere Aspekte für die Bewertung der Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Kapitalerhaltung und Gläubigerschutz in die IFRS.
VII. Gläubigerschutzalternativen: Das Kapitel analysiert verschiedene Reformmodelle (High-Level-Group, Lutter-Gruppe, Rickford-Gruppe, Niederländische-Gruppe, IDW) und deren kritische Würdigung. Es vergleicht die verschiedenen Ansätze und bewertet deren Potenzial zur Verbesserung des Gläubigerschutzes unter IFRS.
VIII. Überleitungsrechnungen: Dieses Kapitel behandelt kurz Überleitungsrechnungen, die für einen Vergleich der verschiedenen Kapitalerhaltungskonzepte relevant sind.
IX. Machbarkeitsstudie von KPMG: Die Zusammenfassung der KPMG-Machbarkeitsstudie beleuchtet die Untersuchung der Eignung der IFRS für Ausschüttungen, Kapitalerhaltungssysteme und den Gläubigerschutz. Die Ergebnisse der Studie werden im Kontext der Gesamtproblematik diskutiert.
X. Vergleiche von Rechtssystemen: Das Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Rechtssysteme und deren Behandlung von Kapitalerhaltung und Gläubigerschutz. Dieser Vergleich liefert einen umfassenden Kontext für die Bewertung der IFRS.
Schlüsselwörter
IFRS, Kapitalerhaltung, Nominale Kapitalerhaltung, Reale Kapitalerhaltung, Gläubigerschutz, Solvenztests, Bilanztheorien, Shareholder-Theorie, Stakeholder-Theorie, Jahresabschluss, Ausschüttungsbegrenzung, Reformmodelle, Rechnungslegung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Integration von Kapitalerhaltungskonzeptionen und gesellschaftsrechtlichen Gewinnansprüchen in die Rechnungslegungsnorm nach IFRS
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Kapitalerhaltungskonzeptionen und gesellschaftsrechtlichen Gewinnansprüchen in die Rechnungslegungsnorm nach IFRS. Sie analysiert bestehende Bilanztheorien und deren Bezug zu den Anforderungen des Gläubigerschutzes, bewertet verschiedene Reformmodelle und deren Praxistauglichkeit.
Welche Bilanztheorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt sowohl ursprüngliche Bilanztheorien (einschließlich Ansätze, Jahresabschlussziele, -aufgaben und -anforderungen, statische und dynamische Bilanzinterpretation) als auch moderne Bilanztheorien wie die funktionsanalytische Bilanzlehre, die Shareholder-Theorie, die Stakeholder-Theorie und die Stockholder-Theorie.
Wie wird Kapitalerhaltung definiert und behandelt?
Kapitalerhaltung wird definiert und zwischen nominaler und realer Kapitalerhaltung unterschieden. Die Arbeit untersucht verschiedene Methoden der Gewinnermittlung und deren Auswirkungen auf die Kapitalerhaltung.
Welcher Aspekt des Gläubigerschutzes wird untersucht?
Die Arbeit beleuchtet die Notwendigkeit und Ziele des Gläubigerschutzes, analysiert das Ausmaß und die Ursachen unangemessener Insolvenzrisiken, untersucht die europäische Kapitalrichtlinie von 1976 und die Änderungsrichtlinie von 2006, sowie Mechanismen des Kapitalschutzes und der Ausschüttungsbegrenzung.
Welche Rolle spielen Solvenztests?
Die Arbeit beschreibt die Idee, Anforderungen und Ausgestaltung von Solvenztests sowie deren Kritik. Die Diskussion der Solvenztests liefert weitere Aspekte für die Bewertung der Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Kapitalerhaltung und Gläubigerschutz in die IFRS.
Welche Reformmodelle werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Reformmodelle (High-Level-Group, Lutter-Gruppe, Rickford-Gruppe, Niederländische-Gruppe, IDW), vergleicht die Ansätze und bewertet deren Potenzial zur Verbesserung des Gläubigerschutzes unter IFRS.
Welche weiteren Aspekte werden behandelt?
Zusätzlich werden Überleitungsrechnungen und eine Machbarkeitsstudie von KPMG (Hintergrund, Durchführung, Ergebnisse, Eignung der IFRS für Ausschüttungen, Kapitalerhaltungssysteme und Gläubigerschutz) sowie Vergleiche verschiedener Rechtssysteme behandelt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
IFRS, Kapitalerhaltung, Nominale Kapitalerhaltung, Reale Kapitalerhaltung, Gläubigerschutz, Solvenztests, Bilanztheorien, Shareholder-Theorie, Stakeholder-Theorie, Jahresabschluss, Ausschüttungsbegrenzung, Reformmodelle, Rechnungslegung.
- Citation du texte
- Henrik Welp (Auteur), 2010, Möglichkeiten und Grenzen der Einbeziehung von Kapitalerhaltungskonzeptionen und gesellschaftsrechtlichen Gewinnansprüchen in die Rechnungslegungsnorm nach IFRS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159342