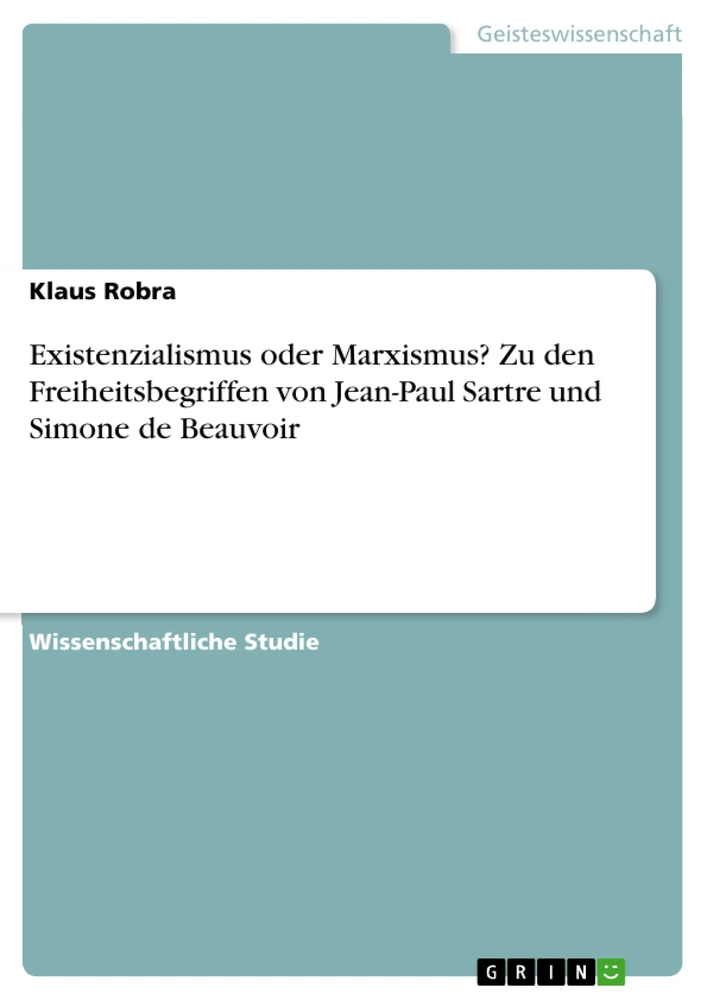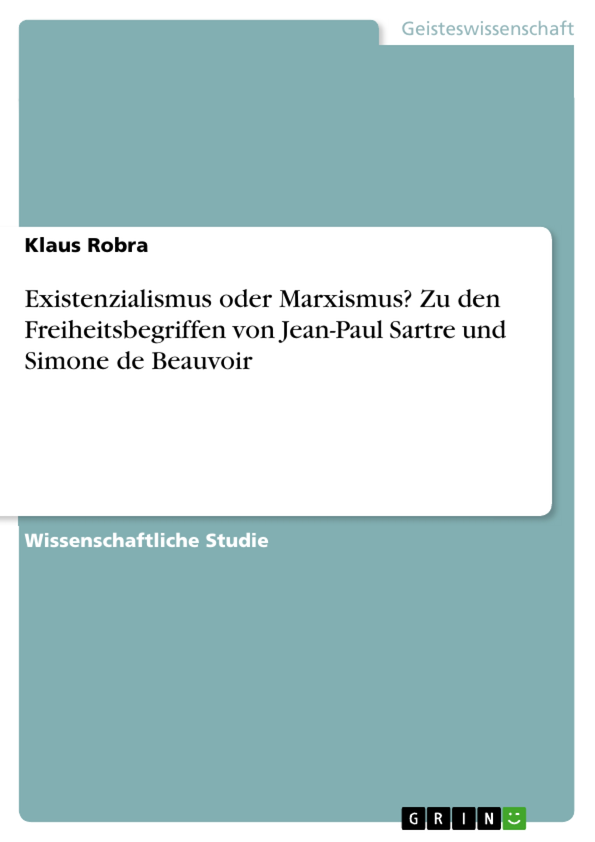Sind wir nun frei oder unfrei, determiniert oder ungebunden? Wie frei können wir sein, können wir uns fühlen? Das sind Fragen, an denen anscheinend niemand vorbeikommt, am wenigsten wohl Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, die glühenden Propagandisten der Freiheit im 20. Jahrhundert. Darin übertroffen allenfalls vom Grundgesetz der BR Deutschland, in dem die „Freiheit der Person“ und „die freie Entfaltung der Persönlichkeit“ garantiert werden (GG Art. 2). Wobei sich die Frage stellt, ob solche Garantie in Klassengesellschaften mit zunehmender sozialer Ungleichheit überhaupt möglich bzw. glaubwürdig ist. – Die Geschichte des Freiheitsbegriffs nachzuzeichnen, würde den vorliegenden Rahmen sprengen. Stattdessen kann versucht werden, den Kern des Problems wenigstens erkennbar werden zu lassen, wie dies auch Sartre und Beauvoir immer wieder unternommen haben.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Zu Sartres Werdegang
Sartres Existenzialismus und Marxismus
Die Freiheit und das Unbewusste: Sartre und Freud
Zur Kritik der dialektischen Vernunft
Zu Sartres politischem Engagement
Sartre und „der real existierende Sozialismus“
Sartres erneute Wende: vom Marxismus zum Anarchismus (1972-1980)
Zum Werdegang von Simone de Beauvoir
Simone de Beauvoirs Existenzphilosophie und Freiheitsbegriff
Marxismus-Kritik
Freiheit und Moral – zum gegenwärtigen Forschungsstand44
Zum Forschungsstand von Entwicklungs-Psychologie und - Neurologie
Willensfreiheit und Moral im Kindes- und Jugendalter
Kann es eine allgemein verbindliche Ethik bzw. Moral geben?
Vom Selbst zur Demokratie
Kritische Anmerkungen zu Sartre und Beauvoir
Literaturverzeichnis
Einleitung
Sind wir nun frei oder unfrei, determiniert oder ungebunden? Wie frei können wir sein, können wir uns fühlen? Das sind Fragen, an denen anscheinend niemand vorbeikommt, am wenigsten wohl Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, die glühenden Propagandisten der Freiheit im 20. Jahrhundert. Darin übertroffen allenfalls vom Grundgesetz der BR Deutsch-land, in dem die „Freiheit der Person“ und „die freie Entfaltung der Persönlichkeit“ garantiert werden (GG Art. 2). Wobei sich die Frage stellt, ob solche Garantie in Klassengesellschaften mit zunehmender sozialer Ungleichheit überhaupt möglich bzw. glaubwürdig ist.
Die Geschichte des Freiheitsbegriffs nachzuzeichnen, würde den vorliegenden Rahmen spren-gen. Stattdessen kann versucht werden, den Kern des Problems wenigstens erkennbar werden zu lassen, wie dies auch Sartre und Beauvoir immer wieder unternommen haben. Rousseau schreibt: „Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten.“ Und Schiller antwortet ihm: „Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei – und wär‘ er in Ketten geboren.“ Rousseau setzt der konstatierten Unfreiheit Émiles Erziehung, einen sinnvollen Gesellschaftsvertrag und Naturnähe entgegen. Schiller nennt als Prototypen vollkommener Freiheit das Kunstschöne und verbindet dieses Konzept mit der Forderung nach individueller Selbstbestimmung, ohne die real-gesellschaftlichen Implikationen des Problems adäquat zu behandeln.
Dies blieb Karl Marx vorbehalten, der allerdings, teilweise ähnlich wie Rousseau, überall Unfreiheit konstatierte, und zwar durch Klassenkampf, Herrschaftsverhältnisse und Ideo-logien bedingte Unfreiheit, der er u.a. mit der revolutionären, konkreten Utopie des Reichs der Freiheit in Klassenloser Gesellschaft entgegentrat.
Wohingegen Sartre und Beauvoir an ihrer Überzeugung festhielten, dass sich für jede Einzel-person trotz aller Widrigkeiten immer wieder Möglichkeiten eröffnen, von der eigenen Frei-heit aktiven Gebrauch zu machen. Um die Einzelheiten dieses Konzeptes geht es im Folgen-den, wobei zu beachten ist, dass Sartre und Beauvoir schon seit den 1930er Jahren das Problem ‚Freiheit und Sozialismus‘ im Blick hatten, für das sie schließlich umfangreiche phi-losophische Lösungen mit Hilfe des Versuchs vorschlugen, Existenzialismus und Marxismus in Einklang zu bringen.
Zu Sartres Werdegang
In einer im GRIN-Verlag (München) erschienenen Abhandlung heißt es dazu:
„Sartre wurde am 21. Juni 1905 in Paris geboren. Er studierte in Paris und La Rochelle und erhielt 1929 sein Diplom für Philosophie. Er wirkte dann als Gymnasiallehrer in Le Havre, wurde 1939 zum Militär einberufen, aber schon ein Jahr darauf von den Deutschen gefangengenommen. Er wurde nach seiner Freilassung im März 1941 Professor am Lycée Condorcet in Paris. Sartre hat seine Lehre, die er selbst „Existentialismus“ nannte, nicht nur in philosophischen Werken, sondern noch weitaus wirksamer in ausgezeichneten Romanen, Dramen und Kritiken dargelegt. Sartre erreichte damit eine große Breitenwirkung, er war nämlich außerdem noch Journalist und Herausgeber der wichtigsten französischen philo-sophischen Zeitung: Les temps modernes (Seit 1945).
Er ist in seiner Philosophie, wie er selbst zugibt, von Hegel, Heidegger und Jaspers abhängig. Er erreicht darum an eigentlicher Schöpferkraft nicht mehr seine Vorgänger, überragt sie aber alle an dichterischer Begabung. Sartre sagt von sich selbst, dass er stets von sehr zarter Gesundheit gewesen sei, dass er oft und lange krank war, dass er nahezu krankhaft empfindlich sei, dass er eine überaus rege Phantasie habe und darum der Angst in starkem Maße ausgesetzt sei. Er habe sich schon als Kind vor dem Einschlafen selbst gruselige Geschichten erzählt, bis er endlich vor Müdigkeit einschlief. Sartre verrät in seinen Werken ein starkes politisches Interesse und zeigt darin ein „Liebeswerben“ für die Sozialisten und Kommunisten. Er hat sich in der Gestalt des „Hugo“ der „Schmutzigen Hände“ selbst gezeichnet: als einen Intellektuellen der alten Bürgerklasse, der sich doktrinär (von einer Lehre besessen und dabei die Wirklichkeit übersehend) zum Kommunismus bekennt, aber trotzdem nicht recht ernst genommen wird. Sartre starb am 15. April 1980 in Paris.
Sartres philosophisches Hauptwerk heißt „Das Sein und das Nichts“; es ist das Grundbuch der spezifischen französischen Form des Existentialismus. Wichtige Grundbegriffe für den Existentialismus sind: Freiheit, Entwurf, Situation und Verantwortung. Sie werden im letzten Teil des Werkes ausgeführt, wo Sartre über Haben, Machen und das Sein als Grundkategorien der menschlichen Wirklichkeit schreibt.“1
Und in einem Lexikon-Artikel ist ergänzend zu lesen:
„Während der deutschen Besatzung veröffentlicht Jean-Paul Sartre (* 1905, † 1980), Mitglied der Résistance, in Paris sein philosophisches Hauptwerk »Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie«. Es ist die bedeutendste Darstellung der atheistischen Existenzphilosophie. Die Maxime des Existentialismus lautet: »Die Existenz geht dem Wesen voraus«, d.h. die Existenz des Menschen ist zunächst etwas überflüssiges, Wesenloses, durch nichts Gerechtfertigtes; erst durch das Tun des Menschen entsteht das Wesen des Menschen: »Der Mensch ist allein das, was er tut... Alles ist Handlung, und nichts ist hinter der Handlung.« Der Gegensatz von Sein und Schein wird aufgehoben. Der Mensch muss sich selbst in seiner Freiheit verwirklichen. In der Verbindung existenzialistischen und ontologischen Denkens gelingt es Sartre damit, »den negativen Gedanken mit der Möglichkeit positiven Handelns« zu vereinbaren, wie es sein Freund Albert Camus gefordert hatte. Sartre versteht seine Philosophie zugleich als Ausdruck politischen Widerstands: »Da das Nazigift sich bis in unsere Gedanken einschlich, war jeder richtige Gedanke eine Eroberung.«“2
Sartres Existenzialismus und Marxismus
Jean-Paul Sartre (1905-80) will – ähnlich wie Heidegger – das Sein erklären, und zwar immanent, d.h. rein innerweltlich, ohne Gottesbezug. Im Unterschied zu Heidegger bekennt Sartre sich dabei ausdrücklich zum Atheismus, indem er z.B. feststellt: „Der atheistische Existentialismus, für den ich stehe. … erklärt, daß, wenn Gott nicht existiert, es mindestens ein Wesen gibt, bei dem die Existenz der Essenz vorausgeht, ein Wesen, das existiert, bevor es durch irgendeinen Begriff definiert werden kann, und daß dieses Wesen der Mensch oder wie Heidegger sagt, die menschliche Wirklichkeit ist. Was bedeutet hier, daß die Existenz der Essenz vorausgeht? Es bedeutet, daß der Mensch zuerst existiert, sich begegnet, in der Welt auftaucht und sich danach definiert.“3
Was aber dieses In-der-Welt-sein bedeutet, analysiert Sartre u.a. an Hand zweier Grund-begriffe, deren Herkunft u.a. von Kant und Hegel er nicht leugnet, der Begriffe An-sich und Für-sich.
Das An-sich (‚En-soi‘)
Die Frage nach dem Sein stellt und beantwortet Sartre anders als Heidegger. Für Sartre ist das Sein „überall“ (EN S. 29).4 Bezieht das menschliche Bewusstsein sich auf dieses all-gegenwärtige Sein, wird es Bewusstsein von Etwas, das auch in der Außenwelt, d.h. außerhalb des Bewusstseins, liegen kann. Erst durch dieses Andere seiner selbst wird es als Bewusstsein erkennbar. (Dies in deutlicher Parallele zu Sartres Ich-Begriff: Ich werde ich erst in der Mitwelt, im – keineswegs immer unproblematischen – Mit-sein mit den anderen Menschen.)
Dieses Andere ist nur dann bestimmbar und erklärbar, wenn es zur Welt der Erscheinungen gehört, was für das von Kant so genannte „Ding an sich“ nicht zutrifft. Sartre nennt es „transphénoménal“, außerhalb der Erscheinungen liegend, oder auch: „l‘être en soi“, das Sein an sich. Das Sein an sich „ ist das, was es ist“, d.h. es ist identisch mit sich selbst und insofern „undurchsichtig“, absolut dunkel (‚opaque‘), Synthese nur mit sich selbst, reines Sein, nicht Möglichkeit (EN 33 f.).
Das Für-sich (‚Pour-soi‘)
Wenn das An-sich nur auf sich selbst bezogen werden kann, ist es unmöglich, vom An-sich zum Bewusstsein, dem „Für-sich“, zu gelangen. Zwischen An-sich und Für-sich vollzieht Sartre somit eine klare Trennung, einen Dualismus. Zumal er das Für-sich für die eigentliche Seinsweise des Bewusstseins hält, und zwar als Grundlage jeglichen Verstehens. (Wobei er durchaus auch auf Descartes‘ Cogito, das „ich denke“, zurückgreift, um dann jedoch – in deutlicher Abgrenzung von Descartes – jegliches Ich nicht als bloßen Bewusstseinsinhalt, sondern als existenzielles Mit-sein mit den anderen Menschen aufzufassen, s.o.)
Das Sein des Bewusstseins, das Für-sich, ist, im Unterschied zum An-sich, nicht identisch mit sich selbst. Vielmehr ist es ein Sein, „das nicht ist, was es ist und das ist, was es nicht ist“ (EN 121). Denn es existiert als Negation – und insofern wesentlich in der Dialektik von Sein und Nichts: Das Bewusstsein negiert jeden Augenblicks-Inhalt (Moment) durch den nächsten – und ist dabei wesentlich Subjekt, folglich zeitgebunden und kontingent, d.h. es „ereignet“ sich, aber nicht als Notwendigkeit, sondern „zufällig“. Im Für-sich der Negation verliert sich das mit sich selbst identische An-sich (EN 124). Das Für-sich ist das „reflektierte Reflektierende“ (‚reflété-reflétant‘), das immer schon in einer Beziehung, auch zur Welt der Objekte, steht. Es begründet sich selbst, und zwar u.a. dadurch, dass es sich – in Freiheit – vom An-sich abgrenzt. Bleibt aber nicht abstrakt, sondern konkretisiert sich – individuell und singulär – „in Situation“, also in bestimmtem In-der-Welt-sein (EN 134).
Das Für-Andere-Sein (‚l’Etre-Pour-Autrui‘)
Dem Sein der Anderen – und dem Für-andere-sein – widmet Sartre in EN auf den Seiten 275 bis 503 ausführliche Analysen, so zur Existenz und zum Körper des Anderen sowie zu konkreten Beziehungen zwischen dem Für-sich-Sein und dem Sein-für-Andere.
Wie begegnet mir der andere Mensch? Zunächst als Leib, jedoch nicht in purer Leiblichkeit. Denn der Andere ist nicht nur Körper, sondern auch Gestalt, Figur, Person mit typischen Merkmalen wie Mimik, Gestik, Haltung und Verhalten. Der Andere tritt mir als etwas Reales entgegen. Ihn zu „begreifen“ (‚concevoir‘) sei aber, so Sartre, nicht ohne weiteres möglich; man sei gezwungen, den Anderen „als Objekt“ zu konstruieren. Der Andere ist Subjekt, aber man macht ihn zum Objekt (EN 283). Der Andere ist ein Ich und zugleich – für mich – ein Nicht-Ich, eine Form der Negation, des Getrennt-Seins.
Sartre verdeutlicht diese komplizierte (Nicht-)Beziehung – er nennt sie auch ein „Néant“, ein Nichts – am Phänomen des Blickes. Ich nehme den Anderen optisch wahr; und wenn er mich ebenfalls anschaut, weiß ich, dass er mich sieht, aber anders, als ich ihn sehe. Damit beschäftigt sich Sartre auf mehr als 50 (!) Seiten (EN 310-367). Dabei geht er zunächst rein phänomenologisch vor, das heißt, er beschreibt, was er sieht, z.B. Passanten auf der Straße, eine Frau, einen Mann, einen Bettler. Und diese sind für ihn zunächst zweifellos Objekte. Doch er geht einen Schritt weiter: Es handelt sich um Personen, um Menschen in ihrer „persönlichen Anwesenheit“ (‚présence en personne‘ EN 310). Der Mensch, der zugleich „Objekt“ ist, kann nicht einfach wie ein Sachobjekt räumlich-zeitlich bestimmt werden. Er ist Objekt „für mich“ – und umgekehrt: Ich kann von dem Anderen gesehen werden.
Daher ist der Blick des Anderen näher zu erklären. Welchen Sinn hat dieser Blick? Er gehört zweifellos zum Leib, erschöpft sich aber nicht in dieser Eigenschaft: Der Blick ist nicht identisch mit den Augen, scheint diese eher zu „maskieren“, von ihnen aus „vor ihnen her“ zu gehen (EN 316). Aber ich bin es, der gesehen wird … Also handelt es sich um etwas typisch Situatives, eine Situation. So auch, wenn ich – zunächst unbemerkt – irgendwo mein Ohr oder mein Auge an ein Schlüsselloch hefte. Erspäht und ertappt mich dann jemand dabei, empfinde ich Scham. Und der Andere? Er bricht in meine Welt ein, sorgt dafür, dass ich die Situation nicht mehr allein beherrsche, denn ich bin nunmehr Objekt unbekannter Einschätzungen, Wert -Bestimmungen, die mich förmlich „versklaven“, für mich zur Gefahr (!) werden können.
Dabei ist der Andere zugleich „unfassbare Subjektivität“; ich kenne ihn vielleicht nicht, weiß aber um sein Subjekt-Sein und damit um seine „unendliche Freiheit“, die aber meine eigene Freiheit negiert, festsetzt (sozusagen „zunagelt“), objektiviert. So dass ich sogar Scham und Angst empfinde.
Dennoch weiß Sartre auch um die Gefühle der Anderen. Wie er selbst können sie Wut, Freude, Sympathie, Abneigung und vieles andere empfinden. Dennoch thematisiert er das Mitgefühl, die Empathie, nicht. Der Andere bleibt – nicht nur in EN – im Wesentlichen ein Faktor der Unsicherheit, der Gefahr, der Objektivierung, der Distanz. Wohl nicht zufällig heißt es in dem Theaterstück Huis Clos (‚Bei geschlossenen Türen‘, 1944): „L’autre, c’est l’enfer“, der Andere, das ist die Hölle. So dass es mit ihm ein harmonisches Mit-Sein „eigentlich“ nicht geben kann. – Hierauf wird zurückzukommen sein.
Liebe und Sexualität
Phänomene der Abgrenzung, Distanzierung und wechselseitigen Negation erkennt Sartre auch in nahezu allen Formen von Liebe und Sexualität (vgl. EN S. 431 ff.). Auch in der Liebe überwiegt das Scheitern, gibt es Harmonie eher selten. „Die Liebe bleibt Konflikt, Täuschung, Scheitern und tödliche Beziehung der Menschen untereinander.“5
In der Sexualität werde der Leib des Anderen objektiviert, sei nur noch „Gegenstand“, während die Freiheit des Anderen vergeblich erstrebt werde. „ … die sexuelle Begierde ist, genauso wie die Liebe, zum Scheitern verurteilt, und zwar deshalb, weil im Erreichen der Lust im sexuellen Akt das Verfangensein der Freiheit im Leib seine Vollkommenheit findet.“ (Michelini a.a.O. S. 166.) – Letztlich bleibt jede Person Individuum, d.h. einsam und allein mit der Freiheit des Für-sich-Seins.
„En-soi-pour-soi“: Synthese im „An-und-für-sich“?
Hegel will das Problem der Differenz zwischen An-sich und Für-sich auf erkennt-nis-theoretischem Wege lösen: im „An-und-für-sich“, einem Konstrukt, das es dem Denken ermöglichen soll, das – anscheinend unergründliche – An-sich-Sein der Dinge durch die Arbeit des für-sich-seienden Bewusstseins im An-und-für-sich „aufzuheben“, d.h. die Dinge so erkennen zu können, wie sie tatsächlich sind, zumal er fragt: „Wie sollen die Dinge anders erscheinen als ihrem Wesen gemäß?“ – Damit will Hegel die von Kant etablierte Differenz zwischen Ding an sich und Erscheinung beseitigen.
Sartre akzeptiert diesen Lösungsvorschlag nicht, sondern hält strikt an der Kantischen Unterscheidung fest. Daher kann er An-sich und Für-sich zunächst nur in einem „en-soi-pour-soi“ nebeneinander stellen. Denn das Pour-soi ermöglicht dies durch sein Wissen (die ‚connaissance‘). Es bleibt jedoch eine rein gedankliche Brücke, keine Überwindung des realen Gegensatzes zwischen zeitlichem Für-sich und zwangsläufig nicht-zeitlichem, unbestimmbarem An-sich.
Eine solche Vermittlung hält Sartre nur dann für möglich, wenn es ein Drittes, ein tertium comparationis, gäbe, das beide Seinsbereiche übergreifen und miteinander vergleichbar machen würde. Diese „höhere Instanz“ müsste eine „causa sui“ sein, ein Wesen, das seinen Grund in sich selbst trüge – wie der Gott der Religionen und der Religionsphilosophie. Diesen Gott leugnet Sartre jedoch, so dass er den Dualismus, die Aufspaltung des Seins in An-sich und Für-sich, nicht überwinden kann. – Nichtsdestoweniger gibt er die Suche nach einem „être total“, einem ganzheitlichen Sein, nicht auf – und findet dieses schließlich – man sehe und staune! – in einem umfassenden „en-soi-pour-soi“, einem „An-und-für-sich“, das er auch als Wert (‚la valeur‘) bezeichnet (EN 664, 700 f.); wobei zu beachten ist, dass ‚valeur‘ auch so viel wie ‚sens‘, d.h. ‚Wortsinn‘ und ‚Bedeutung’, bedeuten kann, womit dann die Bedeutung(en) eines bestimmten Wortes im Unterschied zu denen allen anderen Wörter gemeint sind.
Wert (‚la valeur‘): ein Schlüssel zum Ganzen?
Das Sein und das Nichts. Das Nichts ängstigt uns (normalerweise), zumal unser Sein nicht nur durch die Negation im Für-sich bestimmt ist, sondern ständig vom Nichts im Tod bedroht zu sein scheint. In ständiger Angst vor dem Nichts können wir aber ebenso wenig leben wie in dauerndem Scheitern – oder dauernder Angst vor dem Scheitern. „Das Nichts nichtet“, sagt Heidegger. Und Sartre: Jede Frage kann mit einem Nein beantwortet werden. Das Nichts begründet die Möglichkeit der Negation. Das Nichts „wird genichtet“ und: „Das Nichts ist nicht “ (EN 58).
Dagegen erkennt Roquentin in Sartres Der Ekel (1938): „Nichts. Existiert.“ – Hieraus schließt Ludger Lütkehaus, der dem Nichts ein dickes Buch mit bemerkenswerten Kapiteln über Nietzsche, Heidegger und Sartre gewidmet hat, auf einen „fatalen Doppelsinn: Noch das Nichts existiert. Just in dem Augenblick, wo das Daseinsgefühl zum Ekel eskaliert, wird noch die befreiende Leere des Nichts vom unseligen Überfluß an Existenz okkupiert. Wahrhaftig, wenn es nicht einmal mehr die Gegenmöglichkeit des Nichts gäbe; wenn alles von Existenz >verdreckt< wäre, weil die Gegenidee zu ihr zweifellos >eine existierende Idee< ist, dann gäbe es kein Entkommen mehr; dann wäre die Welt die Ewigkeit der Hölle, in der die Existenz zur Existenz verdammt ist: Nietzsche und Bahnsen hatten das Dasein in der Tat mit dieser größten Last beschwert. Ist der Existenzialismus ein Nihilismus? Ja, wenn man letzteren im Sinn von Nietzsches >extremster Form<: der Ewigkeit des Sinnlosen, versteht; nein: wenn man eine Möglichkeit der Befreiung in ihm sucht. >Die Hölle, das sind die Andern<: damit kann man zur Not leben. >Die Hölle – es gibt nichts anderes<: damit lebt und stirbt es sich ziemlich schlecht.“ (L. Lütkehaus: Nichts. Abschied vom Sein. Ende der Angst; Zürich 1999, S. 443.) – Und: Besser lässt sich die Dialektik von Sinn, Sein und Nichts kaum veranschaulichen!
Jedenfalls ist die Dauer-Hölle kein Ausweg, auch nicht für Sartre, obwohl in seiner Philosophie das Negative – in Form von Hölle, Angst, Ekel, Nichts, Negation, Knappheit, Scheitern usw. – eine wichtige Rolle spielt. Denn von entscheidender Bedeutung scheint nicht die Negativität, sondern die Art und Weise zu sein, in der er das Wert -Problem behandelt, und zwar, scheinbar unvermittelt, im Zusammenhang mit den Problemen des Für-sich-Seins, das er in doppelter Hinsicht mit dem Nichts konfrontiert: als stets drohende (Ver-)Nichtung des Seins und als Negation in der Arbeit des zeitgebundenen Für-sich. Nur negativ, nur orientierungslos kann das Für-sich aber nicht standhalten, auch nicht gegen-über dem Problem des An-sich.
Kein Nihilist würde behaupten:
1. Mit der Realität des Menschen kommen die Werte in die Welt (EN 137) und: „ … zu sagen, daß wir die Werte erfinden, bedeutet nichts anderes als dies: das Leben hat a priori keinen Sinn. Ehe Sie leben, ist das Leben nichts; es liegt bei Ihnen, ihm einen Sinn zu verleihen, und der Wert ist nichts anderes als der Sinn, den Sie wählen“ (Ist der Existentialismus ein Humanismus? a.a.O. S. 34). Womit Sartre den Begriff Wert – anscheinend – der Kategorie Sinn unterwirft. Es zeigt sich jedoch, dass er ‚Wert‘ vor allem als Selbstentwurf des Menschen auf die eigenen Möglichkeiten versteht.6
2. Die Angst ist die Quelle aller Werte (EN 722).
3. Dennoch übersteigen (transzendieren) die Werte das Sein: „La valeur est par delà l‘être“, der Wert ist jenseits des Seins (EN 136). Die Werte verleihen dem Für-sich-sein eine ins Unendliche reichende Struktur. (Eben den Sinn ?)
4. Die Werte selbst haben gegenüber dem Bewusstsein (dem Für-sich) nicht die Qualität eines Seins, sondern eines Sollens (EN 137).
5. Es gibt ein absolutes Selbst, in dem jegliche „Aufhebung“ (‚dépassement‘) des Für-sich-Seins sich aufhebt. Als Absolutes ist dies eine umfassende Einheit, aus dem tatsächlich jeglicher Sinn von Sein hervorgehen müsste (EN 137, 148).
6. Das absolute Selbst besteht in Identität, Reinheit, Beharrung (‚permanence‘) und Begründung des Selbst. Was dazu führt, dass auch die Werte dem Doppelsinn (der Janus-Köpfigkeit) von Sein und Nichts unterliegen: Das Absolute ist nicht realisierbar.
7. Als höchster „Sinn“ begründet der Wert auch jegliche Freiheit: „ … elle hante la liberté“, er, der Wert, lässt der Freiheit keine Ruhe (EN 137). Und dennoch sind Wert und Sinn zugleich Hervorbringungen, Ausgeburten der Freiheit (EN 138) – und daher erst dann weiter begründbar, wenn das „Sein der anderen“ Menschen zum Vorschein kommt.
Gerhard Seel schließt aus all diesem, „das ganzheitliche Sein, nach dem Sartre fragt“, sei „nichts anderes als der verwirklichte Wert “7, wenn auch der Wert selbst für Sartre vornehmlich ein „regulatives Prinzip“ bedeute. Was durchaus einleuchtet, sobald man Seels weitergehende Folgerung erfährt: „Es kann kein Zweifel mehr bestehen, daß Sartre den Wertbegriff nicht nur für seine Theorie des konkreten menschlichen Handelns, sondern darüber hinaus auch für den Abschluss seines philosophischen Systems fruchtbar macht.“ (A.a.O. S. 250.)
Es überrascht daher nicht, dass Sartre die „Totalität“ – und damit den Wert – in seinem zweiten Hauptwerk, der Kritik der dialektischen Vernunft, als „regulatives Prinzip“ der Totalisierung 8 bezeichnet; wobei zu beachten ist, dass es sich bei der Totalisierung (‚totalisation‘) um einen weiteren Schlüsselbegriff handelt, durch den Sartre – dialektisch – das Einzelne in Beziehung zu einer Ganzheit (z.B. der Freiheit, der Geschichte) setzt, so dass Allgemeines im Besonderen – und umgekehrt – sichtbar wird.
Die (tatsächlichen und möglichen) Folgerungen aus Sartres Wertbegriff im Einzelnen darzustellen, käme einer Herkules-Arbeit gleich. Daher beschränke ich mich im Wesentlichen auf zwei Leit-Werte:
Freiheit und Verantwortung
Der Wert begründet, wie gesagt, die Freiheit. Aber umgekehrt bezeichnet Sartre auch die Freiheit als „Grundlage aller Werte“ (in: Ist der Existentialismus ein Humanismus? a.a.O. S. 31 bzw. in EN 138, s.o.), so dass die Freiheit nunmehr der höchste Wert überhaupt zu sein scheint. In der Tat setzt Sartre die Freiheit absolut: Sie hat keine anderen Grenzen als die eigenen (EN 515). Und „fundiert“ damit auch das Für-sich-Sein des Menschen, ohne deshalb lediglich ein Bewusstseinsinhalt unter vielen anderen (möglichen) zu sein. Freiheit ist Frei-heit des Ichs im Mit-sein mit den anderen Menschen und somit – zumindest als „Ziel“ – Freiheit aller, Freiheit jeglichen Ichs. Mit den Worten Sartres: „ … ich kann meine Freiheit nicht zum Ziel nehmen, wenn ich nicht zugleich die Freiheit der andern zum Ziel nehme.“ (In: Ist der Existentialismus …? a.a.O. S. 32.)
Zu dieser Freiheit ist der Mensch „verurteilt“, weil für Sartre Gott ebenso wenig existiert wie irgendeine andere metaphysische Instanz, die das Wesen des Menschen im voraus, a prori, bestimmen könnte. Immer wieder zitiert Sartre hierzu Hegel, wonach das Wesen das „Gewesene“ ist: „Wesen ist was gewesen ist“ (u.a. EN 515, deutsch im Zitat!). Das bedeutet: Der Mensch macht sich selbst zu dem, was er ist, durch das, was er tut. So dass er nicht nicht handeln kann und daher nicht nur zur Freiheit, sondern auch zur Wahl, zum Entwurf (seiner selbst) verurteilt ist: „Der Mensch ist nichts anderes als sein Entwurf, er existiert nur in dem Maße, in welchem er sich verwirklicht, er ist also nichts anderes als die Gesamtheit seiner Handlungen, nichts anderes als sein Leben.“ (In: Ist der Existentialismus ein Humanismus? a.a.O. S. 22).
Mit der schwerwiegenden Folge, dass die Menschen selbst für alles, was sie tun, verantwortlich sind. Freiheit als Ziel für alle kann nur in gemeinsamer Verantwortung angestrebt werden. Denn der in, durch und für die Freiheit handelnde Mensch, bindet sich – durch sein Engagement – an die Gestaltung des Ganzen: „Somit ist unsere Verantwortlichkeit viel größer, als wir es etwa voraussetzen könnten, denn sie bindet die ganze Menschheit.“ (a.a.O. S. 12). Durch meine Wahl „bin ich für mich selbst und für alle verantwortlich, und ich schaffe ein bestimmtes Bild des Menschen, den ich wähle; indem ich mich wähle, wähle ich den Menschen.“ (ebd. S. 13.) Schon deshalb kann Freiheit sich nicht in Abstraktionen verlieren: „ ... Freiheit will sich im Konkreten“ (ebd. S. 32), d.h. auch: in konkreter, gemein-samer Verantwortung. Der Mensch ist frei, d.h. er darf tun, was er vor sich und den anderen Menschen verantworten kann.
Freiheit, Materialismus und Revolution
Schon früh beschäftigt sich Sartre mit der Sozialen Frage, erkennt er die Unterdrückung der Lohnarbeiter durch die Kapitalisten. Dennoch übernimmt er nicht einfach die kommu-nistische Ideologie, sondern konfrontiert schon früh, d.h. spätestens seit den 1940er Jahren, seinen Freiheitsbegriff mit dem Marxismus bzw. mit dem dialektischen und historischen Materialismus. Im Jahre 1946 veröffentlicht er dazu seine Abhandlung Materialismus und Revolution (in: Drei Essays a.a.O. S. 52-107, Abkürzung im Folgenden: MuR). Darin kritisiert er den dialektischen Materialismus vor allem in der von Engels vorgelegten Form. Für widersinnig hält er es, dass Engels von einer angeblich dialektisch erklärbaren „Naturgeschichte“ ausgeht. Geschichte ist, so Sartre, „bestimmt durch die absichtliche Wiederaufnahme der Vergangenheit durch die Gegenwart“ (MuR a.a.O. S. 60), so dass es nur eine „Geschichte des Menschen “ geben könne (ebd.).
Das von Engels behauptete „Umschlagen von Quantität in Qualität“ könne nicht stattfinden, weil die Wissenschaft, wie Sartre erklärt, grundsätzlich Qualitäten auf Quantitäten zurückführe (a.a.O. S. 61). Quantität könne aber nur wieder Quantität hervorbringen. Überhaupt lassen sich Dialektik und Wissenschaft nicht in Einklang bringen, wenn Dialektik wesentlich auf einem „Spiel der Begriffe “, Wissenschaft aber auf der Analyse von Vorstellungen beruht (S. 63) und daher vornehmlich tatsächliche „funktionelle Beziehungen zwischen den Erscheinungen“ untersucht (65). – In der Dialektik sieht Sartre dagegen ein Mittel, neue Synthesen zu finden, die mehr enthalten als These und Antithese zuvor. Auch deshalb hält Sartre – im Gegensatz zu Engels – Dialektik und Naturwissenschaft für nicht vereinbar.
Nicht weniger problematisch erscheint Sartre der Anspruch des Historischen Materialis-mus, dialektisch ein „Sinngesetz“ der Geschichte zu begründen. Wie auch Lenin und Stalin bekräftigen, geht der Kapitalismus gemäß diesem „Gesetz“ zwangsläufig an seinen inneren Widersprüchen zugrunde. Wenn das zutrifft, bedarf es gar keines revolutionären Subjekts mehr, um die Revolution voranzubringen. Sartre geht noch weiter: Die materialistische Teleologie der Geschichte würdigt den Menschen zu einem „Ding“ herab. „Widersinnig“ sei es, „die Freiheit alles in allem in die Dinge und nicht in den Menschen zu legen“ (MuR S. 89). Mit solcher Verdinglichung spiele der Marxismus den Kapitalisten in die Hände, die nur darauf bedacht seien, den Arbeiter „gleich dem Sklaven in ein Ding zu verwandeln“ (96), so im Taylorsystem der Arbeitsteilung und anderen kapitalistischen Produktionsverfahren.
Dagegen sieht Sartre in der Freiheit das Gegenteil jeglicher Verdinglichung. Freiheit erfährt der Arbeiter u.a. im Umgang mit den Dingen. Er gewinnt – durch planvolle Arbeit – Macht über die Dinge, d.h. die Fähigkeit, die Dinge in seinem Sinne zu verändern. Kausaldenken und Teleologie, ursächliches und zweckgerichtetes Handeln kommen darin überein. Genau dies bedeutet aber Freiheit als höchsten, stets auf die Zukunft bezogenen Wert: „Somit erfährt der Arbeiter in der Tat seine Freiheit durch die Dinge; aber gerade weil die Dinge ihn die Freiheit lehren, ist er alles in der Welt, nur kein Ding“ (95).
Erkenntnisse dieser Art beflügeln Sartre erst recht, über die Beziehunggen zwischen Freiheit und Revolution neu nachzudenken, wobei er an den in EN entwickelten Bestim-mungen der Freiheit als eines absoluten Werts durchweg festhält, so dass er mit Marxisten in Konflikt gerät, die ihm zu bedenken geben, dass der Mensch, wenn er von Geburt an grundsätzlich schon frei ist, nicht mehr befreit zu werden braucht, so dass das marxistische Ziel einer freien Assoziation freier Individuen seinen Sinn verliert. Darauf Sartre: „Ist der Mensch nicht ursprünglich frei, sondern ein für allemal determiniert, so vermag man nicht einmal zu begreifen, worin denn seine Befreiung bestehen könne“ (MuR 96). Falsch sei es, zwischen der Freiheit des Menschen und der Bedingtheit (Determiniertheit) der Welt Gegensätze aufzubauen. Gehört kapitalistische Unterdrückung zu diesen Bedingungen, könne der Proletarier ohne ein Freiheitsbewusstsein sich nicht einmal seiner Lage bewusst werden. Selbst wenn die Unterdrückung ihm „keine andere Wahl als Resignation oder Revolution“ lasse, trete Freiheit zum Vorschein, nämlich als Wahlfreiheit (97).
In dieser Situation befinde sich der sozialistische Revolutionär, werde aber durch einen zur Verdinglichung verfälschten Materialismus daran gehindert, sich wirklich zu emanzipieren, wirklich frei zu handeln und nicht – wie bei Hegel – mit dem bloßen Bewusstsein von Freiheit als Idee zu leben (98 f.). Es bedürfe einer auf Solidarität gegründeten „Philosophie der Freiheit“ als Voraussetzung und Stützung revolutionären Handelns.
Konflikte entstehen allerdings durch die Pluralität von Freiheiten. Nicht jede Freiheit wird anerkannt; aber was unterdrückt wird, sei stets eine Form von Freiheit. Gegen die Unterdrückung bedarf es einer freiheitlichen Theorie der Gewalt, wozu weder der (platte) Materialismus noch der Idealismus in der Lage sei. Der Revolutionär will aber – durch Gegengewalt – jeder Form von Gewalterzeugung langfristig entgegenwirken und die Gewalt schließlich durch eine gewaltfreie, harmonische, klassenlose Gesellschaft ersetzen. Erst durch solche Veränderung könne die Welt erkannt werden, wie sie wirklich ist: „Der Mensch schreitet also über die Welt hinaus gegen einen zukünftigen Zustand hin, von dem aus er sie betrachten kann. Denn indem man die Welt verändert, vermag man sie zu erkennen“ (104).
Dem Revolutionär soll dazu ein neues Bewusstsein der „Situation“ und des „In-der-Welt-Seins“ (im Sinne von EN) verhelfen. Siegt der Sozialismus, siegt die Freiheit. Aber dieser Sieg ist durch nichts garantiert, „gerade weil der Mensch frei ist“ (105). Eine Philosophie von Revolution und Freiheit soll es daher nur als umfassende „Philosophie des Menschen“ geben (ebd.). Was jedoch auf dem Weg über den herkömmlichen Materialismus nicht erreichbar sei. Vielmehr bestehe die Gefahr, dass dieser „Materialismus den revolutionären Entwurf erstickt“ (107).9
Es scheint, als ob Sartre mit dieser Befürchtung den tatsächlichen, tragischen Gang der Geschichte des herkömmlichen Marxismus vorausgeahnt hätte.
Die Freiheit und das Unbewusste: Sartre und Freud
Laut Freud ist das menschliche Verhalten oft nur das Resultat unbewusster Konflikte und ver-drängter Triebregungen. Diesen Determinismus lehnt Sartre entschieden ab, weil er jedem In-dividuum zubilligt, sich über Bedingtheiten hinwegzusetzen und seinen eigenen Weg zu wäh-len. Wohingegen diese grundsätzliche Freiheit geleugnet würde, wenn man das Mensch-Sein auf eine Ansammlung psychologischer Mechanismen reduziert. Ebenso scharf kritisiert Sartre die Vorstellung, das Unbewusste sei eine autonome Wesenheit, die unsere Handlungen steu-ert. Diese Vorstellung führe dazu, die Eigenverantwortung jedes Einzelmenschen zu negieren. Der Mensch ist keineswegs nur das Resultat seiner Vergangenheit und seiner verdrängten Wünsche.
Die Freiheit ist das Herz von Sartres Denken. Für Sartre ist der Mensch „zur Freiheit verdammt“, d.h. es bleibt dem Menschen nichts anderes übrig, als von seiner Freiheit Gebrauch zu machen, und zwar in einer Welt, die ihm keinerlei vorgängige Essenz auferlegt. Sartres Freiheit steht in diametraler Opposition zum Freudschen Determinismus, der das Indi-viduum unbewussten, undurchschauten Mächten unterwirft.
Dagegen betont Sartre, das Individuum sei Herr über den eigenen Willen und könne daher diesem gemäß handeln. Wodurch eine ethische Dimension dieser Philosophie aufscheint: Das Individuum ist frei und daher verantwortlich nicht nur für die eigenen Entscheidungen und Handlungen, sondern – jedenfalls großenteils – auch für deren Auswirkungen auf die Mitmen-schen. – Diese Verantwortlichkeit kann, wie Sartre erklärt, auch zu einer Quelle der Angst werden, sobald der/die Einzelne für die – zuweilen undurchschaubaren – Folgen des eigenen Handelns mitverantwortlich wird.
Die Psychoanalyse verleite nicht selten dazu, mit ihren rein psychologischen Analysen die In-dividuen zu entschuldigen bzw. aus ihrer Verantwortung zu entlassen. Dagegen plädiert Sartre für bewusst verantwortliches, aktives, authentisches Engagement in der Welt.10
Was man darüber hinaus mit Sartre der Freudschen Psychoanalyse entgegensetzen kann, ist Sartres Theorie der Emotionen aus dem Jahr 1938. Zu dieser heißt es in einer Besprechung:
„Emotionen sind absichtliche und strategische Mittel, um mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Wir entscheiden uns, sie zu nutzen, wir kontrollieren sie, und nicht umgekehrt, wie anderswo behauptet wird. Emotionen sind nicht fixiert, sie haben keine Essenz und sind in der Tat raschen Schwankungen und Kehrtwendungen unterworfen.“11 (So laut Sartre.)
Womit erneut klar wird, dass das Bewusstsein in der Lage ist, auch die Gefühle und die Emotionen zu kontrollieren, so dass die Freiheit der Person gewahrt bleibt.
Zur Kritik der dialektischen Vernunft
Mit der 1960 in Paris erschienenen Critique de la raison dialectique (CRD) vollzieht Sartre einen weiteren Schritt in der Entwicklung seines Denkens und seiner Weltanschauung. Denn er bekennt sich nunmehr nahezu uneingeschränkt, wenn auch nicht unkritisch, zum Marxismus, den er als „la philosophie de notre temps“, die „Philosophie unserer Zeit“, bezeichnet (CRD S. 29). Diese Philosophie sei „indépassable“, unüberschreitbar, unüber-holbar (unaufhebbar?), weil die Umstände, die sie hervorgebracht haben, keineswegs aufgehoben („dépassées“) seien. Auf die Gefahr hin, sich im Leeren zu verlieren oder rückständig zu werden, könne unser Denken nur auf dem Boden des Marxismus wirklich gedeihen (ebd.).
Vom Sinn der Dialektik zur Dialektik des Sinns: ein Wert-Problem?
Dass Sartre seine zuvor entwickelte kritische Haltung keineswegs aufgibt, zeigt sich u.a. daran, dass er seine Kritik an Engels‘ „dialektischem Materialismus“ in CRD erneut bekräftigt (insbesondere S. 125-128). Darüber hinaus will Sartre den Marxismus nicht nur neu fundieren, sondern auch dessen Mängel korrigieren . Grundübel sieht er nach wie vor darin, den Menschen materialistisch zu verdinglichen und ebenso dadurch zu entmündigen, dass man ihn einem angeblich historischen, in Wirklichkeit ökonomistischen „Sinngesetz“ unter-wirft.
Dialektik will er stattdessen mit Freiheit, d.h. mit einer als Praxis verstandenen Subjektivität (Für-sich-Sein), verbinden. Dialektik kann insofern nicht als Selbstzweck, nicht aus eigener „Logik“, sondern nur als Instrument begrifflichen Denkens zur Geltung kommen. Für-sich-sein bestimmt sich einerseits in dialektischer Negation, andererseits im dialektischen Bezug zu Anderem. Dieser Bezug vollzieht sich u.a. in der Totalisierung als Herstellung von konkreten Einheiten und Ganzheiten (s.o.). Erst unter solchen Voraussetzungen lässt sich die Dialektik umfassend, d.h. auch auf die Gebiete der Arbeit, des Sozialen und der Geschichte als solcher anwenden. Wobei stets ein Vorrang des Verstehens zu beachten ist.
Was Sartre sich hier als Aufgabe vornimmt, ist nicht weniger als eine Kritik (auch im Kantischen Sinne) an dogmatischem dialektischem und historischem Materialismus („Diamat“ und „Histomat“). Klaus Hartmann nennt dieses Ansinnen „Distanzierung … von der dialektisch-materialistischen Metaphysik, die von Sartre gerade als losgelöstes Denken begriffen wird“. Darüber hinaus wolle Sartre das undialektische Denken des Positivismus kritisieren und einen Beitrag zur „Selbsterkenntnis der praktischen Vernunft“ leisten. (K. Hartmann: Sartres Sozialphilosophie, Berlin 1966, S. 48, Abkürzung: HS.))
Schon in EN war Sartre auf die Sinnfrage eingegangen , wenn auch eher beiläufig Diese Frage beantwortete er nicht marxistisch mit dem „Sinngesetz“, aber auch nicht wie Heidegger in der Verkürzung auf „Zeitlichkeit“ und „Sorge“. Vielmehr erklärte er: „ … le sens même du pour-soi est dehors dans l‘être, mais c’est par le pour-soi que le sens de l‘être apparaît.“ (EN S. 230): Der eigentliche Sinn des Für-sich liegt draußen im Sein, aber erst durch das Für-sich kommt der Sinn des Seins zum Vorschein! Auch dem Gegenstand seiner Arbeit vermag der Mensch daher Sinn zu verleihen, stößt dabei jedoch zuweilen auf (vorhergegangene) „fremde Sinnverleihungen“ (HS S. 101).Wenn aber – wie in CRD – dem Für-sich die Dialektik zuzuordnen ist, kommt erneut die Freiheit als höchster Wert ins Spiel. Somit erschließt sich ein Sinn des Seins aus dem Wert des freien Für-sich-Seins, aus dem Menschen selbst. Diese Botschaft Sartres sollte nicht ungehört verhallen, nicht unbeachtet bleiben!
Gemäß dem Untertitel von CRD: Théorie des ensembles pratiques versteht Sartre den Menschen als Praxis und Freiheit im Für-sich-Sein, so dass auch zur Sozialen Freiheit ein Weg zu finden sein müsste. Sowohl seinsbezogen (ontologisch) als auch anthropologisch entspricht diese Zielsetzung durchaus derjenigen der Marxschen Theorie, einschließlich der Entfremdungstheorie. Der Gefahr des Ökonomismus entgeht Sartre allerdings dadurch, dass er dem Menschen statt Fremdsteuerung Freiheit und somit Eigensteuerung zubilligt.
Bedürfnis und Knappheit
Grundsätzlich versteht Sartre in CRD den Menschen als materielles Wesen, d.h. als Teil der Materie selbst. Was ihn jedoch nicht daran hindert, die „Materie Mensch“ in einen totalisierenden Bezug zum materiellen Ganzen treten zu lassen, wie er es exemplarisch u.a. an Hand des Phänomens Bedürfnis (‚le besoin‘) verdeutlicht.
Wessen wir bedürfen, wird uns zunächst als ein Fehlen, ein Mangel (‚manque‘) bewusst, also innerlich und subjektiv, dabei zugleich jedoch als ein Negatives, das sich auf Äußerliches bezieht, z.B. auf (fehlende) Nahrung. Insofern gehört das Bedürfnis zum Subjekt-Sein, ist nicht Eigenschaft der Materie. Diesen Gegensatz von Innerem und Äußerem erklärt Sartre dialektisch als Negation der Negation und zugleich als Position, nämlich als Mittel zum Zweck der Erhaltung des Organismus. Der biologische Zweck überlagert die (chemo-physische) Materialität des (An-)Organischen. (Vgl. CRD 166 f., HS 70 f.).
Allerdings verkennt Sartre hier keineswegs die Tatsache, dass der Organismus den Natur-kräften unterworfen ist, d.h. nicht nur dem Umstand, dass die organische Materie auf Anorganisches angewiesen ist.
Was dem organischen Bedürfnis fehlt, ist aber, so Sartre, nicht im Überfluss vorhanden, sondern als Mangel, als Knappheit (‚rareté‘) (CRD 168). Dabei stellt er das Prinzip Knappheit in einen höchst bedeutsamen Zusammenhang mit dem Marxismus. Er glaubt z.B., mit der Knappheit Marx‘ und Engels‘ Analysen der Entstehung von Klassen(kämpfen) um Wesent-liches ergänzen zu können. Zu beantworten sei nämlich die Frage, wie im Grunde Positives – „Materie, Überproduktion, bessere Bedürfnisbefriedigung, Freistellung von Bevölkerungs-gruppen usw.“ zu schwerwiegenden negativen Folgen führen kann (HS 91).
Knappheit deutet Sartre zunächst als geschichtliches Faktum: Es gab sie immer schon; alle bisherige Geschichte ist die eines Kampfes gegen die Knappheit (CRD 201).Heute noch existierende Grund-Mängel – Hunger, Unter-, Mangel- und Fehlernährung und andere gravierende Missstände – zeigen, dass dieser Kampf weitergeht, keineswegs schon gewonnen ist. Knappheit erscheint somit als geschichtsmächtiger Faktor, ohne dass man damit die Geschichte selbst hinreichend erklären könnte. In der Knappheit erscheint Geschichte als Möglichkeit, nicht schon als Realität. (Vgl. CRD 201, 203.)
Insofern präsentiert Sartre die Knappheit als „dialektisches Verstehensprinzip“ (HS 94). Entfremdung und Elend entstehen demnach nicht erst durch bestimmte Formen der Produktion, sondern diese sind ihrerseits durch die Knappheit und den Kampf gegen sie bedingt. Was dann natürlich auch für sämtliche Konkurrenz-Erscheinungen im Wirtschafts- und Arbeitsleben gilt. Sartre erkennt anscheinend eine Tiefendimension der Entfremdung, die Marx entgangen war.
Aber er begnügt sich nicht mit diesem neuen – wohl auch für die Öko- Diskussion wichtigen – Erklärungsprinzip, sondern schließt daran tiefschürfende Analysen an, z.B. der Materie selbst, die er u.a. als „träge“ (bzw. ‚pratico-inerte‘) auffasst. (Näheres hierzu in CRD 225-377 bzw. HS 95-106.) Es folgen Analysen der „individuellen Praxis“ sowie von Strukturen der Entfremdung in Arbeit, Eigentum und Klassen-Situation (HS 107-134).
Die Gruppe
Wie aber kann – trotz aller Entfremdung – Sozialität als Synthese aus Freiheit und Gleich-heit gelingen? Möglichkeiten hierzu sieht Sartre in der Gruppe, die er nicht als statisches Gebilde, sondern als dynamisches „Ereignis“ versteht, in der plurale Freiheit und Solidarität erreichbar sind (vgl. HS S. 135). Insofern überwindet der Autor hier die eher pessimistische Sicht des anderen Menschen in EN, wo gegenseitige Objektivierung – z.B. durch den Blick des Anderen – zu Rivalität, Abgrenzung und Feindseligkeit geführt hat. Stattdessen findet Sartre jetzt zum Wir, nämlich durch die Vermittlung des Dritten, d.h. durch Dreier-beziehungen – wie sie in der Gruppe tatsächlich stattfinden: als Vermittlung zwischen dem Ich und jedem anderen Dritten, wobei Gegenseitigkeit („Reziprozität“) und nicht nur objektiviert-objektivierendes Anders-Sein vorherrscht, so dass die Subjektivität jeder Einzel-person in der subjektiven Objektivität der Gruppe erhalten bleibt. Das bedeutet: „Die Gruppe ist ein Objekt für mich als Subjekt, aber ich bin auch Teil; sie ist eine Art Subjekt, deren Objekt ich bin. Ich habe eine Gruppenexistenz, nicht hat die Gruppe eine überichliche Existenz“ (HS S. 137).
Klaus Hartmann sieht übrigens in diesem „Modell einer gelingenden Einheit von Freiheiten … ein Novum der Theorie “ (a.a.O. S. 138). Die in ständiger Entwicklung befindliche Gruppe entwirft sich ständig neu u.a. durch „totalisation tournante“, rotierende Totalisierung, d.h. dadurch, dass sie in der Bewältigung gemeinsamer Aufgaben praktisch wird und bleibt. Nicht im Sein, sondern im Handeln gelingt die plurale Einheit der Einzel-Freiheiten. „Handlung, Ziel, Situation und Struktur“ werden immer wieder neu gestalthaft miteinander verbunden (a.a.O. 142).
Für wenig problematisch hält Sartre die Tatsache, dass es eine Vielzahl teils höchst verschiedenartiger Gruppen gibt, so z.B. in Form von Gewerkschaften, Parteien, Armeen und Staaten, obwohl hier Rivalitäten und Konflikte unvermeidlich zu sein scheinen und gerade die Besonderheiten und Unterschiede in ihrer Bedeutung nicht zu verkennen sind. Dabei analysiert Sartre den Staat als „Grenzfall“ im Verhältnis zu allen anderen Gruppen. Wie Marx sieht er im Staat einerseits ein Instrument der herrschenden Klasse, andererseits eine sozusagen über den Klassen schwebende Instanz, zumal der Staat auch „national“ sein und insofern vermittelnd wirken will, und zwar auch bei Konflikten innerhalb der herrschenden Klasse. Wobei das Recht vor allem dazu diene, die Macht der Herrschenden über die Beherrschten zu sichern, folglich als eine Art von Klassenjustiz. Hierzu Hartmann: „ … die Hierarchie ist absolut in der Form der Bürokratie. Dem Willen der Spitze steht die Ohnmacht der Beherrschten gegen-über; die Polizei als Allmacht basiert ihrerseits auf der Ohnmacht der Bevölkerung“ (HS S. 164-166).
Insgesamt verkörpert der Staat somit das Gegenteil von Freiheit, zumal im Kapitalismus. Dagegen setzt Sartre den Klassenkampf als Mittel der Emanzipation, schließlich der sozialistischen Revolution, die durch eine besondere Gruppe, die proletarisch-sozialistische Avant-Garde, herbeigeführt werden soll. Allerdings nicht mit dem Ziel einer Diktatur des Proletariats, die Sartre ausdrücklich als „absurd“ zurückweist, zumal die historische Erfahrung gezeigt habe, dass es nie gelungen sei, aus einer „Totalisierung der Arbeiterklasse“ tatsächliche politische Macht abzuleiten. Eine Gruppe könne sich niemals als „Hyperorganismus“ organisieren. (Vgl. CRD S. 630.)
Hieraus wird verständlich, warum Sartre die Marxsche Utopie eines „Reichs der Freiheit“ bzw. einer gesamtgesellschaftlichen „freien Assoziation freier Individuen“ nicht übernimmt. Einen solchen „Hyperorganismus“ lässt das Gruppen-Konzept nicht zu.
Stattdessen plädiert Sartre – wie Marx und Engels – für ein allmähliches Absterben des Staates (natürlich auch der nachrevolutionären sozialistischen Staatsmacht!), z.B. durch die Gründung von Arbeiterkomitees, „Entbürokratisierung, Dezentralisierung und Demo-kratisierung“ (HS S. 172).
Reelle Chancen hierfür sieht er durchaus in der Verwirklichung des Gruppen-Konzepts. In einem Interview des Jahres 1979 erklärt er: „Wenn … eine Gesellschaft sich auf die wirkliche Freiheit des Menschen stützen will, kann sie sich nicht im Rahmen des Staates, im Rahmen der bürgerlichen Demokratie – wie sie sich konstituiert hat – organisieren, die Freiheitsbeschränkungen vorsieht, weil Gesetze respektiert werden müssen. Die Menschen müssen sich in Gruppen an ihrem Arbeitsplatz oder ihren Wohnorten zusammentun; sie müssen sich einig werden über eine bestimmte Anzahl von Praktiken, die andere Gruppen der Gesellschaft gleichermaßen akzeptieren können. Diese Abstimmungsergebnisse sind keine Gesetze, sondern die Bestimmungen, die freie Menschen ihrem Handeln geben. Dabei gibt es keine kleine Gruppe, die diese Aktionen über-wacht, damit man konform zu den Institutionen handelt, wie es heute die Praxis ist. In Wahrheit gibt es dann keine Regierung mehr, sondern nur noch Entscheidungen, die aus den einzelnen Gruppen kommen und die Gruppe respektieren.“ (Zitiert von Rupert Neudeck in: Martin Suhr: Sartre zur Einführung, Hamburg 1989, S. 108 f.) – Ziel ist eine „Demokratie der lokalen Verantwortung“, in der wirkliche Freiheit in gemeinsamer Verantwortung erreicht werden soll, und zwar sowohl für die Einzelpersonen als auch für die Gruppen der Einzelpersonen.
Zu Sartres politischem Engagement
Unter dem Titel Radikaler Sozialist oder Radikalsozialist? hat Alfred Betschart im Internet eine Abhandlung veröffentlicht, in der er Sartres politische Orientierungen und Aktivitäten untersucht. Sein erstaunliches Ergebnis lautet: „Sartre war … letztlich nicht Kommunist oder Sozialist oder Gauchist oder Anarchist oder Radikalsozialist, sondern Sartre war Sartre.“12 Womit sich scheinbar die ganze Abhandlung erübrigt hätte, nicht wahr? Weiter zu fragen ist aber: Und wer war Sartre? Ist er tatsächlich mit sich identisch? Und welcher Sartre? Der von EN 1943 oder der von CRD 1960?
Mit EN war Sartre in späteren Jahren nicht mehr zufrieden. Es sei ein Fehler gewesen, vom einzelnen Für-sich-Sein in einer „solipsistischen Moral“ auszugehen. Stattdessen müsse man den Anderen ins Zentrum rücken. Indes: Unterliegt nicht der Andere ebenso wie jedes einzelne Ich dem Für-sich-Sein? Zweifellos! Niemand entgeht der Negation 1. durch das An-sich-Sein, 2. durch das Nicht-Ich des Anderen, 3. durch die Nichtung des Augenblicks, 4. durch den Tod. Das Für-sich „ist, was es nicht ist“. Sartre ist zugleich, was er nicht ist. Er ist nicht (nur) Sartre. Er ist schon lange tot. –
Und doch ist er – dem Wesen nach – auch das, was er ge-wesen ist: Ein „großer Intellektueller“ (B.-H. Lévy13 ), ein herausragender Philosoph der Freiheit, ein brillanter, äußerst vielseitiger Schriftsteller und Journalist, ein Liebhaber, Globetrotter und Abenteurer, ein unerschrockener, unbeugsamer politisch Engagierter. – Dieses vielfach belegtes Engagement gibt sich in doppelter Hinsicht zu erkennen: im Pro und Contra, d.h. in dem, was Sartre bekämpft und in dem, was er aktiv unterstützt hat. Sartre war
1. gegen Festlegungen des Menschen durch Religion und Metaphysik. Es gibt Theologen, die dem Menschen eine „perfekte Schöpfung“ vorgaukeln und jegliches Unglück unter Hinweis auf das „endgültige Glück im Jenseits“ leugnen. – Es gibt Philosophen, die dem Menschen empfehlen, lieber die eigenen Erwartungshaltungen zu ändern, statt Elend und Ungerechtigkeiten und damit die angebliche „Ordnung der Welt“ zu bekämpfen. Der Mensch soll sich jeglichem Bestehenden unterwerfen und auf jegliche Rebellion verzichten.– Gemeinsam ist solchen Theologen und solchen Philosophen, dass sie den Menschen um seine Freiheit betrügen, ihm nicht einmal Wahlfreiheit zubilligen, indem sie behaupten, seine seit jeher festgelegte „Natur“ zu kennen. – Alles dies lehnt Sartre entschieden – und mit guten Gründen – ab (s.o., vgl. Lévy a.a.O. S. 349 f.).
2. gegen Faschismus und Totalitarismus. Als typisch faschistisch kennzeichnet Sartre drei „portraits-repoussoirs“ (Anti-Typen): 1. den des ‚esprit de sérieux‘, der den „tierischen Ernst“ verkörpert, 2. den ‚salaud‘, den Dreckskerl, „das Schwein“, und 3. den ‚Bourgeois‘.
Der „tierisch Ernste“ identifiziert sich uneingeschränkt und völlig kritiklos mit seiner Situation in der Gesellschaft und im Ganzen des Seins, glaubt an die Wohlgeordnetheit der Welt und der Gesellschaft und hält sich selbst für eine unentbehrliche „Triebkraft“ in dieser „guten und schönen Maschine“ (Lévy a.a.O. S. 339).
Der ‚Salaud‘ zweifelt ebenfalls an nichts, weder an der Gesellschaftsordnung der Herrschenden noch an seiner eigenen Stellung darin bzw. Beteiligung daran, so dass er seine Privilegien für „absolut notwendig“ hält und sich gegebenenfalls das Recht herausnimmt, jeden zu vernichten, der diese Privilegien ablehnt.
Der Bourgeios schließlich ist „unpolitisch“, d.h. nicht politisch zu verorten. Vielmehr vereint er in sich sämtliche Untugenden des tierisch Ernsten und des Salaud, verteidigt beharr-lich das Bestehende unter Hinweis auf die Vergangenheit („es war schon immer so und nicht anders!“), so dass er schon auf Grund seiner Herkunft einen „Platz an der Sonne“ verdient habe. Er ist durch und durch konservativ, will das Bestehende, ihn Privilegierende möglichst verewigen (vgl. Lévy a.a.O. S. 341).
Von all diesem setzt Sartre sich entschieden ab. Er beachtet – im Unterschied zum tierisch ernsten, bourgeoisen Faschisten – durchaus auch die negativen Seiten der Existenz: Das Böse existiert, und es gibt keine dialektische Vermittlung zwischen Gut und Böse. Es gibt Böses, das – unheilbar, unaufhebbar und nicht „zu managen“ – in jedem Menschen steckt (Lévy 337). Und genau diese Erkenntnis hat – wie Lévy (a.a.O. 343) feststellt, entscheidend dazu beigetragen, dass Sartre gegen jede Form von Faschismus und/oder Totalitarismus immun war.
3. Sartre wendet sich gegen den Militarismus. Er billigt Gewalt nur als Gegengewalt gegen Unrecht, z.B. in der Résistance (der er selbst angehörte) oder in den Kämpfen gegen den Kolonialismus. Als Absolvent der Pariser Elite-Hochschule ‚Ecole Normale Supérieure‘ weigerte er sich, eine ihm angebotene Offizierskarriere einzuschlagen. Schon seit Ende der 1940er Jahre beteiligte er sich aktiv an Friedensbewegungen.
4. Er war gegen den Kolonialismus, und zwar schon Ende der 1920er Jahre, nach dem kolonialistischen Rif-Krieg, verstärkt dann nach 1945 im Kampf für die Unabhängigkeit der Kolonien, vor allem während des Algerien-Kriegs (1954-62) und gegen den Vietnam-Krieg (1956-75). 1967 war einer der Organisatoren und Hauptredner des Russell-Tribunals gegen die US-Kriegsführung.
5. Er war gegen Rassismus und Antisemitismus. Spätestens seit dem 2. Weltkrieg sympathisierte er mit Israel und den Juden in aller Welt. Er verurteilte die Diskriminierung Farbiger, z.B. in dem Theaterstück Die ehrbare Dirne (1946), und unterstützte mehrfach schwarze Autoren wie Frantz Fanon (Vorwort zu Die Verdammten dieser Erde 1961). Unbeschadet seiner Juden-Freundlichkeit zeigte er 1972 Verständnis für die palästinensischen Olympia-Attentäter.
6. Er war gegen die bürgerliche (Sexual-)Moral. Und zwar sowohl in seinem eigenen Leben als auch in seinem literarischen Werk. Während des Krieges hätte ihn seine offene Konkubinats-Beziehung mit Simone de Beauvoir fast, wie seine Gefährtin, die berufliche Existenz als Gymnasiallehrer gekostet. Aktiv unterstützte er Beauvoirs Forderungen nach Gleichberechtigung und sexueller Emanzipation.14 –
Nicht weniger bedeutsam ist Sartres positives politisches Engagement. Alfred Betschart beschreibt dieses Engagement als das eines überzeugten Sozialisten, ja Radikalsozialisten – was Sartre allerdings nie dazu veranlasst hat, einer der linken Parteien beizutreten. Zumal er von politischen Parteien überhaupt wenig hielt – was verständlich ist, weil keine der – entweder dem Kapitalismus oder dem Sowjetkommunismus verpflichteten – etablierten Parteien seinem Freiheits-Ideal entsprachen. Von den überaus zahlreichen Stationen seines jahrzehntelangen politischen Engagements seien nur die folgenden, besonders markanten herausgestellt15: 1941 gründete er die Widerstandsbewegung ‚Socialisme et liberté‘. 1944 half er bewaffnet bei der Befreiung von Paris. Seit 1945 veröffentlichte er in der von ihm gegründeten Zeit-schrift ‚Les Temps modernes‘ immer wieder Aufrufe zum Kampf gegen Kolonialismus, Rassismus und Militarismus. 1949 verurteilte er die sowjetischen Gulags. Dennoch vertei-digte er häufig die UdSSR gegenüber Anti-Kommunisten und kritisierte heftig den US-amerikanischen Kommunisten-Jäger McCarthy. – 1952 kam es zum Bruch mit Albert Camus. Es war die Zeit, in der Sartre gelegentlich sogar den Stalinismus gegenüber eifernden Anti-Kommunisten verteidigte. Camus hielt ihm entgegen, dass dieses Eintreten für den Kommunismus einen Verrat an den Freiheits-Idealen des Existenzialismus bedeute. Die marxistische Utopie habe schließlich zu dem stalinistischen Staats-Terror geführt, der durchaus mit dem der Faschisten vergleichbar sei. – Sartre wies diese Kritik als unzulänglich zurück. Wer wie Marx und die Kommunisten letztlich wirklich umfassende Befreiung – und zwar der ganzen Menschheit – anstrebe, dürfe sich dieses Ziel nicht durch unzureichend begründete Kritik verdunkeln lassen. Camus wirft er vor, er sehe „nur noch das Absurde des menschlichen Tuns“.16 – Ähnlich verletzende Töne von beiden Seiten besiegelten schließlich den endgültigen Bruch zwischen den Kontrahenten.
Nach dem Ungarn-Aufstand von 1956 und erneut nach dem niedergeschlagenen „Prager Frühling“ 1968 distanziert Sartre sich vom Sowjetkommunismus. Seit 1958 tritt er öffentlich als Gegner De Gaulles auf. – In den 1960er und -70er Jahren verurteilt er immer wieder die Dikaturen in Spanien, Portugal und Griechenland. – Im Mai 1968 unterstützt er die revoltierenden Studenten und kritisiert scharf die abwartende, nicht-revolutionäre Haltung der linken Parteien und Gewerkschaften. Immer wieder verteidigt er das Recht auf freie Meinungsäußerung auch gegenüber den französischen Maoisten, die er zeitweise (ca. 1970) aktiv unterstützt. Seit 1971 unterstützt er aktiv die Neuen Sozialen Bewegungen zu Gunsten von Frauen, Jugendlichen, Kriegsdienstverweigerern, Regionalisten, politischen Gefangenen u.a. 1971 kommt es wegen eines Justizskandals zum Bruch mit Castros Kuba, das er und Simone de Beauvoir zuvor seit ihrem ersten Besuch auf der Insel (1960) stets begeistert gelobt hatten. – 1974 besucht er A. Baader in Stuttgart-Stammheim und protestiert gegen die Haftbedingungen der RAF-Häftlinge. – Obwohl ihn spezielle Themen der Arbeiter-Bewegung wenig interessieren, unterstützt Sartre stets die Initiativen zu Gunsten einer Politik von unten. Den Staat verurteilt er als Machtinstrument des Kapitals und der Bourgeoisie, aber auch der „realsozialistischen“ Staaten.
Gegen Ende seines Lebens bezeichnet er sich selbst als „Anarchisten“, obwohl er die Organisationen des offiziellen Anarchismus nie aktiv unterstützt hat.
All dies veranlasst A. Betschart zu der Schlussfolgerung, dass Sartre „radikaler Radikal-sozialist“ und radikal-libertärer „Egalitarist“ war, der die Freiheit – für die Einzelperson wie auch für die Gruppe – für den höchsten Wert hielt, ohne daraus parteipolitisch Kapital zu schlagen. Treu blieb Sartre nur sich selbst, d.h. der Freiheit seines Für-sich-Seins. Er war, wie Betschart sagt, „letztlich nicht Kommunist oder Sozialist oder Gauchist oder Anarchist oder Radikalsozialist, sondern Sartre war Sartre.“
Sartre und „der real existierende Sozialismus“
Hierzu schreibt Betschart:
„Zu einem ersten Bruch mit den Kommunisten kam es 1956 nach der Niederschlagung des Ungarnaufstands durch Sowjettruppen. Nur vorsichtig vollzog sich die Wieder-annäherung zwischen Sartre und der UdSSR anfangs der 1960er Jahre. Der Hinter-grund war wiederum eine literarische Tauperiode, die zu Veröffentlichungen von kritischen Schriftstellern wie Solschenizyn und Jewtuschenko führte. Sartre besuchte die UdSSR zwischen 1962 und 66 acht Mal. Obwohl jeweils offiziell vom Schriftstellerverband eingeladen, besuchte er vor allem kritische Literatur- und Kunstschaffende. Ende 63 war ihm schon klar, dass die zweite Tauwetterperiode sich einem Ende näherte. Dass er dennoch bis 1966 die UdSSR weiterbesuchte, hat seinen Grund in Sartres Freundin Lena Zonina. Zum weiteren Rahmen von Sartres Beziehungen zu den Kommunisten zählt auch der Besuch auf Kuba 1960, obwohl Fidel Castro sich damals noch nicht als Kommunist verstand.
Dem offiziellen Bruch mit der Sowjetunion 1968 nach dem Einmarsch in die Tschechoslowakei und mit Kuba 1971 nach dem Schauprozess gegen Heberto Padilla ging jedoch jeweils schon eine innere Distanzierung voraus. Im Falle der UdSSR war dies die Verurteilungen der Dissidenten Brodskij 1965, für den sich Sartre in einem Brief an den sowjetischen Staatspräsidenten Mikojan einsetzte, und Sinjawksij/Daniel 1966. Dem offiziellen Bruch mit Kuba gingen wiederum die Verfolgungen der Homosexuellen auf Kuba 1961 und 1965 mit Arbeitslagern voraus. Gemäß Heberto Padilla sagte Sartre unter Anspielung auf das Dritte Reich, dass es auf Kuba keine Juden, aber dafür Homosexuelle gebe.
Dass auch Sartres Begeisterung für die chinesische Variante des Kommunismus und dessen Kulturrevolution begrenzt war, lässt sich am besten daran erkennen, dass sich Sartre nicht darum bemühte, in den 1960/70er Jahren China zu besuchen (und selbst auch nichts über seinen Chinabesuch 1955 schrieb). Als Maoisten verstand sich Sartre nie. Im Vorwort zu Les Maos en France hielt er klar und deutlich fest: „Ich bin kein Maoist“ (MIF 449). Die Herausgeberschaft für mehrere linksextreme Zeitungen (nicht nur maoistische) übernahm Sartre, weil diese von der gaullistischen Regierung verfolgt wurden. Wie die Diskussion in On a raison de se révolter zeigt, lagen Sartres Sympathien nicht bei der (pseudo-)maoistischen Gauche Prolétarienne mit Benny Lévy (Pierre Victor), sondern bei Gavi und dessen Spontex-Gruppierung Vive la révolution. Gegenüber dem Trotzkisten Krivine soll Sartre sogar vorgeschlagen haben, dass sich Trotzkisten und „Maoisten“ zusammentun sollten, weil erstere über eine bessere Theorie und letztere über die besseren Aktionen verfügten. Sartres Engagement für eine Vereinigung der Linksextremen zeigte sich bei der Gründung des Secours Rouge, einer Hilfsorganisation für verfolgte Linksextreme, Mitte 1970. Mit der Gauche Prolétarienne kam es zu wiederholtem Male zu Differenzen, was anfangs 71 schon zu Sartres Austritt aus dem Secours Rouge führte. Dass Sartre trotzdem der Gauche Prolétarienne bis zu deren Auflösung im Herbst 73 die Stange hielt, war wohl einerseits auf seine Freundschaft mit Benny Lévy zurückzuführen, andererseits darauf, dass er der Rechten keinen Anlass zur Freude bieten wollte, indem er Linken in den Rücken fiel. Dies war eine Haltung, die ihn schon 1954 zu unehrlichen Aussagen über seine Erfahrungen während der Reise in die UdSSR veranlasste. Aus demselben Grund erfolgte auch der Bruch mit Castros Kuba sehr spät. 1968 zog er es vor, seine Abwesenheit am Kulturkongress in Havanna mit Krankheit zu entschuldigen.“ (Betschart a.a.O., s. Fußnote Nr. 13)
Theoretisch fundierter, auch z.B. im Zusammenhang mit der Kritik der dialektischen Ver-nunft, analysiert Arno Münster Sartres Verhältnis zum Sowjetkommunismus, und zwar fol-gendermaßen:
„Mit dem 1948 zur Zeit des Koreakriegs und des Ausbruchs des „Kalten Krieges“ gegründeten „Rassemblement Démocratique Révolutionnaire“ (R.D.R.) versuchte Sartre, damals noch unterstützt von David Rousset, einem Überlebenden des Konzen-trationslagers Buchenwald, seinen revolutionären Humanismus auch parteipolitisch umzusetzen. Der Versuch zielte darauf, jenseits von Stalinismus und dem sozial-demokratischen Reformismus der SFIO in Frankreich eine dritte linke Kraft und Partei zu begründen, die zugleich demokratisch und revolutionär war und die sich den Wählern als eine überzeugende Alternative zum stalinistischen Bürokratismus der KPF und zum kompromisslerischen Reformismus der Sozialisten anbot. Das Scheitern dieser Bewegung – nicht zuletzt an den ewigen internen politischen Auseinanderset-zungen zwischen Sartre und David Rousset - war für Sartre keineswegs ein zureichender Grund, sein politisches Engagement aufzugeben. Im Gegenteil: Trotz gewisser theoretischer und politischer Vorbehalte suchte er nun eine Annäherung zu den Kommunisten. Dabei war die antikommunistische Hysterie in den USA unter McCarthy, die auch auf Westeuropa überschwappte, der Korea-Krieg und die merkwürdig zwiespältige Politik der französischen Sozialisten gegenüber den antikolonialen Befreiungsbewegungen im ehemaligen französischen Kolonialreich in Indochina, Nord- und Westafrika für das Umschwenken des existentialistischen Philosophen der Freiheit ins kommunistische Lager ausschlaggebend. Dieser „Flirt“ mit der KPF und der kommunistischen Weltfriedensbewegung dauerte jedoch nur vier Jahre (von 1952 – 1956) und endete spektakulär mit Sartres äußerst kritischen Äußerungen zur Niederschlagung des ungarischen Volksaufstandes im Oktober/November 1956 in einem Interview mit der Pariser Wochenzeitschrift „Express“, in dem er die blutige Niederwalzung des Volksaufstands in Budapest durch sowjetische Panzer scharf verurteilte. In der danach in den „Temps Modernes“ veröffentlichten Artikelserie „Le Phantôme de Staline“ hat Sartre diese Kritik an den Strukturen und bürokratisch-repressiven Perversionen des „real existierenden Sozialismus“ innerhalb des sowjet-russischen Imperiums noch erheblich vertieft, mit Kritik an Rakocsi und den ungarischen Statthaltern dieses Systems nicht gespart und gleichzeitig auch auf die Tatsache hingewiesen, dass es während der dramatischen Ereignisse in Budapest im Oktober/November 1956 spontan auch zur Bildung von Arbeiterräten kam, die in diesem Aufstand eine relativ große Rolle spielten. So wurde für Sartre der Bruch mit der KPF und dem Sowjetmarxismus definitiv und unwiderrufbar.
Die „Kritik der dialektischen Vernunft“ (1960) war nichts anderes als der groß angete Versuch, die politische Abrechnung mit dem Stalinismus durch eine philosophische Abrechnung zu ergänzen, die v.a. das Ziel verfolgte, der erstarrten, verknöcherten und schrecklich dogmatischen Dialektik des Sowjetmarxismus das Konzept einer erneuer- ten materialistischen Dialektik entgegenzusetzen, die sich jeglichem Schematismus versagt und die sich gleichzeitig als lebendige Methode einer Theorie der gesellschaft- lichen Praxis bewährt. Sartre will damit endgültig den Eindruck aus der Welt schaf- fen, er habe sich mit der Veröffentlichung des Buches „Les Communistes et la Paix“ (1952) eindeutig auf die Seite des Sowjetmarxismus und seiner französischen Nach-beter in den Reihen der KPF und der CGT geschlagen. Mit bewusstem Rückgriff auf Marx stellt Sartre die Dialektik uneingeschränkt wieder her als unerlässliche Erkennt-nismethode für den Bereich der menschlichen Praxis, den das geschichtliche Handeln darstellt.
Insofern stellt es den wichtigsten theoretischen Beitrag zur Neubegründung einer kritischen, undogmatischen und auf weiten Strecken neomarxistischen Praxis-philosophie im 20. Jahrhundert – nach Antonio Gramsci, nach Ernst Blochs „Prinzip Hoffnung“ und praxisphilosophischen Arbeiten aus dem Umkreis der Frankfurter Schule – dar.
So eindeutig damit belegt wird, dass Sartres Bruch mit dem Stalinismus keineswegs ein Bruch mit dem Marxismus war, sondern vielmehr mit dem ernsthaften Bemühen einherging, die wahre Dialektik Marxens wiederzuentdecken und bewusst gegen die verengte Perspektive und Praxis der stalinistischen Dogmatiker ins Feld zu führen, so unleugbar ist auch die Tatsache, dass er damit keineswegs bereit war, sein exi-stentialistisches Philosophieren vollständig aufzugeben. Es geht ihm vielmehr um den Versuch einer Synthese von Existentialismus und Marxismus, die in dieser Form noch nie unternommen worden war. Sartre war dabei von vornherein darauf bedacht, die Zugeständnisse, die er an den Marxismus zu machen bereit war, in gewissen Grenzen zu halten. Hatte er in seinem bereits 1946 erschienenen Essay „Matérialisme et Rélution“ seinen prinzipiellen Vorbehalt gegenüber dem Materialismus in der Form erneuert, dass er aus der Sicht des Existenzialismus jegliche Bestimmung des subjektiven Bewusstseins durch objektive externe Faktoren ablehnte, so wird diese negative Haltung zur Marx’schen These der letztendlichen Determinierung des Klassenbe- wusstseins durch das objektive gesellschaftliche Sein in der „Kritik der dialektischen Vernunft“ in allerdings stark abgeschwächter Form erneuert: Sartre hält auch nach seiner Annäherung an den historischen und dialektischen Materialismus in seiner Praxisphilosophie, in der er einen Kompromiss zwischen Existenzialismus und Marxismus anstrebt, an der Prävalenz des subjektiven Faktors im geschichtlichen Handeln fest. Damit wird die Praxis von Individuen und Gruppen eindeutig aufgewertet gegenüber der geschichtlichen Praxis der sozialen Klassen. So entsteht der Eindruck, Sartre strebe im Grunde genommen nichts anderes an als eine anthropolo- gische Erweiterung der Geschichtsdialektik des historischen Materialismus unter gleichzeitiger Auf- bzw. Überbewertung des subjektiven Faktors. So gesehen bezweckt die „Kritik der dialektischen Vernunft“ eigentlich nichts anderes als den Nachweis, dass die kollektive Praxis letztendlich immer nur auf die Praxis der in sie verwobenen Individuen zurückzuführen ist. Wie Hadi Rizk diesbezüglich zurecht bemerkt hat, wird in dieser Perspektive das Individuum, d.h. das handelnde menschliche Subjekt, nicht in seiner Funktion des fortlaufenden Beharrens im Sein definiert, sondern als ein vom Mangel getriebener lebendiger Organismus, der auf ständiger Suche nach dem Sein ist.“17
Sartres letzte Wende: vom Marxismus zum Anarchismus (1972-1980)
Hierzu stellt Alfred Betschart fest:
„Zu Beginn der 1970er Jahre hätte kein Sartre-Kenner erwartet, dass Sartre sich als Anarchisten bekennen könnte, hatte Sartre doch in einem Interview mit Perry Anderson, Ronald Fraser und Quintin Hoare, das 1969 unter dem Titel Itinerary of a thought, (dt.: Sartre über Sartre. Interview mit Perry Anderson, Ronald Fraser und Quintin Hoare) ausgesagt: „Heute gilt ebenso wie gestern, daß der Anarchismus zu nichts führt.“ (SÜS 162). Wohl war Sartres Lob auf den Anarchosyndikalismus in Les Communistes et la paix, der Critique, Qu’est-ce que la subjectivité? und in Achever la gauche ou la guérir ? (LGK 78) bekannt: „1900 war der Anarchosyndikalismus auf der Höhe seiner Macht. Die französische Arbeiterklasse ist nie aggressiver und nie stärker gewesen als zu jenem Zeitpunkt.“ Doch dieses Lob galt einem Anarchismus, den Sartre in den 1950/60er Jahren für einen Anachronismus hielt. Der Anarcho-syndikalismus habe zwar die ersten Vereinigungsorgane der Arbeiterklasse ins Leben gerufen, doch letztlich sei er das Produkt einer Arbeiterelite gewesen, für deren Existenz die Universalität der Maschine eine historische Voraussetzung war. Mit dem Aufkommen spezialisierter Maschinen und der Massenproduktion war nach Sartre die Existenzgrundlage des Anarchosyndikalismus entfallen (KUF 260-5; KDVI 257-263; LGK 78).
Bekannt waren auch Sartres Aussagen über seine politische Haltung in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. In Merleau-Ponty vivant (dt.: Freundschaft und Wider-sprüche. Über Merleau-Ponty, 1961) bezeichnete er sich als einen verspäteten Anar-chisten: „Merleau bekehrte mich: im Grunde meines Herzens war ich ein verspäteter Anarchist“ (FUW 80). Dieselbe Aussage wiederholte er in einem Film, den Alexandre Astruc und Michel Contat wesentlich im Feb./Mrz. 72 drehten, der jedoch erst 1976 in den Kinos erschien. Dort sagte Sartre über seine politische Haltung in den 1930ern: „Wir waren Anarchisten, wenn Sie so wollen, aber unser Anarchismus war von besonderer Art. Wir waren gegen das Bürgertum, wir waren gegen die Nazis oder die Feuerkreuzler“[1] (SF 31). Doch dies waren Aussagen über eine ferne Vergangenheit, die letztlich immer implizierten, dass er heute als reifer Philosoph mit dem Anarchismus gebrochen hatte. 1972 vollzog sich allerdings ein Wandel, als Sartre sich als dem antihierarchisch-libertären Lager zugehörig bezeichnete. Libertaire ist auf Französisch jedoch weder ein unschuldiges Adjektiv zu liberté, Freiheit, noch bezieht sich dies auf die ameri-kanische Bezeichnung libertarian (franz.: libertarien). Sartre hat wenig mit Ayn Rand, Robert Nozick oder Murray Rothbard gemeinsam. Libertär ist seit den infamen lois scélérates aus den Jahren 1893/94 vielmehr ein französisches Codewort für anar-chistisch. Die meisten französischen Anarchisten bezeichneten sich als Libertäre. Aufmerksamen Beobachtern der politischen Szene Frankreichs war die neue Selbst-bezeichnung Sartres nicht entgangen. Entsprechend sprachen die Interviewer von Der Spiegel Sartre anfangs 1973 darauf an (VNBG 92):
SPIEGEL: Sie sind also nicht Anarchist? SARTRE: Nein […] Ich stehe einer Konzeption nahe, die man in Frankreich als „libertaire“ bezeichnet. Darunter verstehe ich, daß die Menschen Herren über ihr Leben und ihre Lebensbedingungen sind. Wenn ich über mein Leben entscheide, dann haben wir die Freiheit. Das setzt voraus, daß es keine Form von Zwang gibt. Mit andern Worten, das setzt eine vollständige Umwälzung der bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaftsordnung voraus. […] Ich bin Marxianer [marxien] und nicht Marxist. […] Wenn der Marxismus dialektisch ist, bin ich völlig einverstanden. Aber es gibt einen marxistischen Determinismus über die Wertung der individuellen oder kollektiven Aktion, den ich nicht akzeptiere, weil ich der Idee der Freiheit treu geblieben bin. Ich glaube, daß die Menschen frei sind.
Es sei dahingestellt, ob dies ein Akt der Lüge oder der Bösgläubigkeit war, die den Philosophen der mauvaise foi dazu verleitete, seine Nähe zum Anarchismus abzustreiten. Dass Sartre mit seiner Selbstpositionierung gelegentlich Probleme hatte, war wohl Folge seines intensiven politischen Engagements. So sehr er die Nähe zu den Kommunisten und Maoisten überschätzte, so unterschätzte er sie in Bezug auf Socialisme et barbarie, die Trotzkisten generell oder eben auch die Anarchisten. Ian H. Birchall hat dies in Bezug auf die Trotzkisten in seinem bemerkenswerten Buch Sartre against Stalinism[2] in hervorragender Weise aufgezeigt.
Sartres Versteckspiel um seine Nähe zu den Anarchisten fand zwei Jahre später in zwei Interviews sein Ende. Im Interview mit Michel Rybalka, Oreste Pucciani und Susan Gruenheck im Mai 75 für den (allerdings erst 1981 publizierten) Sartre-Band der von Paul Arthur Schilpp herausgegebenen Reihe The Library of Living Philosophers Series fielen folgende Aussagen (IJPS 21):
[Rybalka:] In neueren Interviews scheinen Sie den Begriff des „libertären Sozialismus“[3] akzeptiert zu haben. Sartre: Dies ist ein anarchistischer Begriff, und ich behalte ihn, weil ich an die anarchistischen Ursprünge meines Denkens erinnern möchte. R.: Sie sagten einmal zu mir: “Ich bin immer ein Anarchist gewesen” und Contat gegenüber erklärten Sie: „Durch die Philosophie habe ich den Anarchisten in mir entdeckt.“[4] Sartre: Dies ist ein bisschen voreilig; aber ich habe immer mit den Anarchisten übereingestimmt, die als einzige die Ansicht vertraten, den ganzen Menschen durch soziale Aktionen zu entwickeln, und deren Hauptmerkmal die Freiheit war. Andererseits sind die Anarchisten als politische Figuren etwas simpel. R: Vielleicht ebenfalls auf der theoretischen Ebene? Sartre: Ja, sofern man nur die Theorie betrachtet und gewisse ihrer Absichten auf der Seite lässt, die sehr gut sind, speziell jene über Freiheit und den ganzen Menschen. Gelegentlich wurden diese Absichten realisiert: So lebten sie zum Beispiel um 1910 in Korsika zusammen, bildeten Gemeinschaften. R: Haben Sie sich kürzlich für diese Gemeinschaften interessiert? Sartre: Ja, ich las das Buch von Maitron[5] über die Anarchisten. [Ü. A.B.]
Angesichts dieser veränderten politischen Positionierung erstaunt es nicht, dass Sartre auf die daraufhin gestellte Frage, ob er, um seine Position zu kennzeichnen, eher den Begriff Marxist oder Existentialist brauchen würde, klar antwortet: „Jene des Existentialisten“ (IJPS 22). Sartre, der sich zwanzig Jahre lang als Marxist, wenn auch existentialistischer Prägung, verstand, hatte innerhalb von drei Jahren den Wechsel vom Marxisten über Marxianer zurück zum Existentialisten vollzogen. Es galt wieder, was er 1952 in der Antwort an Albert Camus geschrieben hatte: er sei kein Marxist (AAC 39).[6]
Trotz weiterer Bestätigungen von Sartres Distanzierung vom Marxismus (TCBJ, LPNV), änderte sich weder bei den Sartrianern noch den Sartrophoben wenig am Bild Sartres als eines marxistischen Existentialisten. Selbst der (relativ) große Erfolg von Michel Contats Gespräch mit Sartre zu dessen siebzigstem Geburtstag 1975, das unter Titel Autoportrait à soixante-dix ans noch im selben Jahr im Nouvel Obs und ein Jahr später bei Gallimard als Buch veröffentlicht wurde, führte zu keiner grundlegenden Änderung in der politischen Wahrnehmung Sartres. In diesem bemerkenswert offenen Interview gab es folgenden für Sartres Beziehungen zum Anarchismus bemerkenswerten Dialog (SPSJ 196):
CONTAT: Nach dem Mai 68 sagten Sie: „Wenn man meine Bücher liest, alle, wird man merken, daß ich mich im Grunde nicht geändert habe und immer ein Anarchist geblieben bin ...“ Sartre: Das ist richtig. […] Aber ich habe mich insofern geändert, als ich damals, als ich den Ekel schrieb, Anarchist war, ohne es zu wissen […] Später entdeckte ich durch die Philosophie den Anarchisten in mir. Aber ich entdeckte ihn nicht unter dieser Bezeichnung, denn der Anarchismus von heute hat nichts mehr mit dem Anarchismus von 1890 zu tun. CONTAT: Sie haben sich aber nie mit der anarchistischen Bewegung identifiziert. Sartre: Niemals. Im Gegenteil, ich habe sehr ferngestanden. Aber ich habe nie eine Macht über mir geduldet und war immer der Meinung, daß die Anarchie, das heißt, eine Gesellschaft ohne Macht, verwirklicht werden muß. CONTAT: Sie sind, mit einem Wort, der Denker eines neuen Anarchismus, eines libertären Sozialismus.[7]
Sartres Aussagen gegenüber Contat und Rybalka lassen keinen Zweifel offen, die Phase des Anarchismus war nicht mehr nur eine Episode aus seiner Vergangenheit, sondern der Anarchismus hatte von Neuem wieder Bedeutung in Sartres politischem Denken erlangt. Mit Sartres pro-anarchistischen Äußerungen einher gingen weitere Distanzierungen von den marxistischen Vorstellungen bezüglich der Notwendigkeit einer sozialistischen Revolution und bezüglich deren Ergebnisse. In Autoportrait à soixante-dix ans stellte er fest (SPSJ 241):
Deshalb ist auch der Sozialismus keine Gewissheit, sondern ein Wert: er ist die Freiheit, die sich selbst zum Zweck erhebt.
Und auf Rybalkas Frage, ob im Sozialismus die Knappheit zu existieren aufhöre, antwortete er (IJPS 32):
[Der Sozialismus] würde die Knappheit nicht zum Verschwinden bringen. Jedoch ist es offensichtlich, dass zu diesem Zeitpunkt Wege gesucht und gefunden würden, um mit der Knappheit umzugehen.
Es dauerte noch zwei, drei weitere Jahre, bis sich bei Sartre klare Bekenntnisse zum Anarchismus fanden. Dass diese gegenüber spanischsprachigen Gesprächspartnern fielen, erstaunt angesichts der viel lebhafteren anarchistischen Traditionen in spanischsprachigen Ländern wenig. Im Interview mit Juan Goytisolo, der im stark von Anarchisten geprägten Barcelona aufwuchs, sagte Sartre 1978 (CCJPS VII):
Ich denke, dass der Anarchismus eine der Kräfte ist, die den Sozialismus von morgen bauen kann. Persönlich habe ich mich immer als Anarchisten verstanden; nicht genau so wie es die Anarchisten machen, die über ein Programm, eine Art zu denken verfügen und ihre Ideen innerhalb einer Organisation erarbeiten. Der Grund, durch den ich den Anarchismus erfasse, ist, dass ich schon immer Macht und insbesondere das Verfügen der staatlichen Macht über mich selbst ablehnte. Ich will nicht, dass es eine höhere Autorität gibt, die mich zwingt etwas zu denken oder gewisse Dinge zu tun. Ich denke, dass ich es bin, der bestimmen soll, was ich machen soll, womit ich es machen soll und wann ich es machen soll. Deshalb betrachte ich mich zutiefst als Anarchisten. Wenn ich versuche, meine politischen Ideen über Macht und Freiheit zusammenzufassen, gehen sie in diese Richtung. Ich habe immer mit den anarchi-stischen Denkern sympathisiert, auch wenn ich denke, dass sie die Probleme nicht immer so angingen, wie sie genau anfielen. [Ü. A.B.]
Dass es sich hierbei nicht um eine situationsbedingte Aussage handelt, wird durch das Interview bestätigt, das Sartre im November 79 Raúl Fornet-Betancourt, Mario Casañas und Alfredo Gómez-Muller gab und 1982 unter dem Titel Anarchie et Morale veröffentlicht wurde (AM 365):
Ich habe mich als einen Anarchisten bezeichnet, weil ich das Wort An-archie in seiner etymologischen Bedeutung benutze, also als eine Gesellschaft ohne Macht, ohne Staat.
Bemerkenswert sind die darauf folgenden zwei Sätze in diesem Interview:
Der traditionelle Anarchismus hat nie versucht, eine solche Gesellschaft zu errichten. Die anarchistische Bewegung hat versucht, eine Gesellschaft aufzubauen, die zu individualistisch ist.
Sie sind bemerkenswert, weil sie einen Hinweis auf Sartres Verständnis „seines“ Anarchismus geben. Mit dem Individualanarchismus, wie er sich insbesondere unter Philosophen findet, so bei Stirner und Thoreau, konnte er wenig anfangen. Der Mensch ist nicht nur ein Individuum mit seiner ontologischen Freiheit, sondern auch wesentlich auch ein animal sociale. Dies erklärt auch Sartres Vorliebe für den Anarchosyndikalismus, den er offensichtlich im Gegensatz zum philosophischen Individualanarchismus sieht.
Mit seinem Bekenntnis zum Anarchismus hatte sich Sartre vollständig vom Marxismus abgewandt. Dies geht auch klar aus dem Interview mit Macciocchi hervor (UV 86):
Ich denke, […] dass der Marxismus nicht ausreicht, um unsere Epoche zu verstehen. Ich denke, dass der Marxismus total versagt hat. […] Ich war einmal ein Marxist. Ich bin es nicht mehr, denn die Freiheit und die Moral des Menschen werden unaufhörlich als Kraft verfolgt, gegen die die Mächte der Welt kämpfen. Und für mich gilt es, Freiheit und Moral als einzige effektive und wirkliche Kräfte der geschichtlichen Welt wiederherzustellen. [Ü. A.B.]
Sartres Absage an den Marxismus, die sich erstmals im Spiegel-Interview von 1973 andeutete, war zu einer festen Größe in seinem politischen Selbstverständnis geworden. Nicht nur seine politische Spätphilosophie hatte klar anarchistische Züge angenommen, auch in seiner politischen Selbstpositionierung verstand er sich gegen Ende der 1970er Jahre als Anarchisten. Der Anarchismus, zu dem sich Sartre bekannte, war allerdings ein anarchisme à la Sartre. Sartre blieb auch am Schluss so eigenwillig, wie er immer war. Es war ein Anarchismus, der für eine Übergangszeit immer noch den Staat und Parteien forderte.[8]
Mit seiner neuen zwischen 1972 und 1980 entwickelten anarchistischen politischen Philosophie distanzierte sich Sartre nicht nur vom Marxismus, sondern legte er auch eine Skizze für eine neue politische Philosophie vor. Es war eine politische Philo-sophie, die vielmehr als seine vergangene aus der marxistischen Periode im Einklang mit seinen philosophischen Hauptwerken L’Être et le néant und Critique de la raison dialectique stand. Rückblickend erweisen sich die physischen Probleme, die ihn seit 1973 plagten, als Glücksfall, denn es bedurfte wohl des Schlaganfalls und der Blindheit, damit Sartre die Ruhe von der politischen Aktualität fand, um eine neue politische Philosophie zu entwickeln. Umso bedauerlicher ist es, dass die meisten Sartrianer diese Weiterentwicklung von Sartres politischem Denken nicht rezipiert haben.“18
Zum Werdegang von Simone de Beauvoir
schreiben Rainer Beaujean und Wolf Otto Bechstein:
„Die Pariser Adelstochter und Lehrerin entwickelte sich unter dem Einfluss ihres Lebensgefährten Jean-Paul Sartre zu der bedeutendsten existenzialistischen Schrift-stellerin Frankreichs. Mit ihren existentialistischen Romanen "L'Invitée" (1943) und "Le Sang des autres" (1945), 1984 von Claude Chabrol als "Das Blut der Anderen" verfilmt, erlangte sie erste Anerkennung als Schriftstellerin. Simone de Beauvoir legte 1949 mit ihrem feministischen Traktat "Das andere Geschlecht" eine Theorie der kulturellen und gesellschaftlichen Geschlechterkonstruktion vor, die bis in die 1980er Jahre hinein einen wegweisenden Einfluss auf die Entwicklung der internationalen Frauenbewegung behielt...
Simone de Beauvoir wurde am 9. Januar 1908 als Tochter eines Adelsgeschlechts in Paris geboren. Nach dem Ersten Weltkrieg erlitt die Familie finanzielle Einbußen. Beauvoir studierte nach dem Abitur Philosophie an der Pariser Sorbonne, mit dem Ziel, Lehrerin zu werden und zum Unterhalt der verarmten Familie beizutragen. Während ihrer Studienzeit begegnete Beauvoir 1929 dem Philosophie-Studenten Jean-Paul Sartre, mit dem sie künftig eine intensive intellektuelle und emotionale Bezie-hung verbinden sollte. Der junge Existenzialist beeinflusste das geistige und literari-sche Schaffen der Schriftstellerin nachhaltig. Das Paar führte in Einklang mit der Philosophie des Existenzialismus eine freie Beziehung, die durch keine Heirat abgesichert sein sollte und durch einen Partnerschaftsvertrag geregelt war, der alle zwei Jahre hinterfragt und erneuert werden musste.
Nach einer anfänglichen beruflichen Trennung, die durch die philosophische Unterrichtstätigkeit Sartres in Le Havre und eine ebensolche Anstellung Beauvoirs in Marseille hervorgerufen worden war, lebten beide in Paris, wo sie Philosophie unterrichteten. Das literarische Schaffen Beauvoirs, das in Novellen und Kurz-geschichten zum Ausdruck kam, blieb zunächst ohne Erfolg. Erst nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939, der die Beziehung zu Sartre durch dessen Kriegs-gefangenschaft unterbrach, schrieb Beauvoir ihre erste bedeutende Novelle "L’invitée", die 1943 publiziert wurde. Seit demselben Jahr arbeitete Simone als freie Schriftstellerin. In den folgenden vier Jahren veröffentlichte sie vier weitere Erzäh-lungen. 1947 unternahm Beauvoir eine USA-Reise, die sich ein Jahr später in ihrem Bericht über "L’Amérique au jour le jour" niederschlug. 1949 profilierte sich Beauvoir mit ihrem feministischen Traktat "Le deuxième sexe" (dt. "Das andere Geschlecht") als Wortführerin gesellschaftspolitischer Reformen.
In dem zweibändigen Werk entlarvte die Schriftstellerin die traditionell passive Rolle der Frau als gesellschaftliche Konstruktion des männlichen Patriarchismus, aus der es nur den Ausweg der Selbstverwirklichung der Frau gäbe. Beauvoir begriff ihr eigenes Leben als einen möglichen Weg zu einer solchen Selbstverwirklichung, den sie ihrer weiblichen Leserschaft in ihren mehrfach vorgelegten autobiographischen Texten, zuletzt 1981 in "La cérémonie des adieux", aufzeigte. Die französische Schriftstellerin war inzwischen im Zuge der ab den späten 1960er Jahren eingeleiteten Kultur- und Gesellschaftsrevolution zu einer der frühesten Theoretikerinnen der internationalen Frauenbewegung erhoben worden. Ihr Freund und Lebensgefährte Sartre starb 1980 in Paris.
Simone de Beauvoir starb dort am 14. April 1986.“19
Simone de Beauvoirs Existenzphilosophie und Freiheitsbegriff
In ihren Lebenserinnerungen La force de l‘ǎge (‚Zeit der Reife‘, wörtlich: ‚Die Macht der reifen Jahre‘) aus dem Jahre 1960 deutet die Autorin mehrfach an, was sie unter Freiheit versteht. Um dies zu nachzuzeichnen, können einige Zitate als Hinführung dienen. Auf S. 13 von La force de l‘ǎge schreibt Beuavoir, die schon 1929 mit ihrem Lebensgefährten Sartre statt offizieller Heirat eine Art Ehevertrag abschloss, der bis zu Sartres Tod 1980 seine Gültigkeit behielt:
„Ce qui me grisa lorsque je rentrai à Paris, en septembre 1929, ce fut d’abord ma liberté. J’y avais rêvé dès l’enfance, quand je jouais avec ma sœur à »la grande jeune fille«. Etudiante, j’ai dit avec quelle passion je l’appelai. Soudain, je l’avais; à chacun de mes gestes, je m’émerveillais de ma légèreté. Le matin, dès que je j’ouvrais les yeux, je m’ébrouais, je jubilais.“
Auf Deutsch:
„Was mich regelrecht berauschte, als ich im September 1929 nach Paris zurückkehrte, war erstmal meine Freiheit. Von ihr hatte ich schon als Kind geträumt, als ich mit meiner Schwester das Spiel „erwachsenes Mädchen“ spielte. Als Studentin sagte ich, mit welcher Leidenschaft ich sie beschwor. Plötzlich hatte ich sie; bei jeder meiner Gesten staunte ich über meine Schwerelosigkeit. Sobald ich morgens die Augen öffnete, schüttelte ich mich vor Freu-de, ich jubilierte.“
A.a.O. S. 19 schreibt Beauvoir:
„Aucun scrupule, aucun respect, aucune adhérence affective ne nous retenait de prendre nos decisions à la lumière de la raison et de nos désirs; nous n’apercevions en nous rien d’opaque ni de trouble: nous pensions être pure conscience et pure volonté. Cette conviction était fortifiée par l’emportement avec lequel nous misions sur l’avenir; nous n’étions aliénés à aucun intérêt défini puisque le présent et le passé devaient sans cesse se dépasser. Nous n’hésitions pas à contester toutes choses et nous mêmes chaque fois que l’occasion nous en sollicitait; nous nous critiquions, nous nous condamnions avec aisance car tout changement nous semblait un progrès.”
D.h.:
“Kein Skrupel, keine Rücksichtnahme, keine emotionale Bindung hinderte uns daran, unsere Entscheidungen im Licht der Vernunft und unserer Wünsche zu treffen; in uns selbst nahmen wir nichts Undurchdringliches, nichts Störendes wahr: wir dachten, pures Bewusstsein und purer Wille zu sein. Diese Überzeugung verstärkte sich durch den Elan, mit dem wir auf die Zukunft setzten; keinerlei definiertes Interesse war uns fremd, denn Gegenwart und Vergan- genheit unterlagen ständiger Revision. Ohne zu zögern stellten wir alles und uns selbst in Frage; und zwar bei jeder sich bietenden Gelegenheit; mit Leichtigkeit kritisierten und verur-teilten wir uns selbst, denn wir hielten jede Veränderung für einen Fortschritt.“
Auf S. 21:
„Rien donc ne nous limitait, rien ne nous définissait, rien ne nous assujettissait; nos liens avec le monde, c’est nous qui les créions; la liberté était notre substance même. Au jour le jour nous l’exercions par une activité qui tenait une grande place dans nos vies: le jeu.”
D.h.:
“Nichts grenzte uns also ein, nichts definierte uns, nichts unterdrückte uns; wir selbst waren diejenigen, die unsere Bindungen an die Welt schufen; die Freiheit war unsere wahre Substanz. Tag für Tag übten wir uns in ihr, und zwar in Form einer Aktivität, die in unseren Leben eine große Rolle spielte: das Spiel.“
Auf S. 32:
„Au moment où je me jetai dans la liberté, je retrouvai au-dessus de ma tête un ciel sans faille; j’échappais à toutes les contraintes, et cependant chacun de mes instants possédait une sorte de nécessité.“
D.h.:
„Jedesmal, wenn ich mich der Freiheit in die Arme warf, fand ich über mir einen makellosen Himmel wieder; ich entfloh jeglichem Zwang, und doch wohnte jedem der Augenblicke mei-nes Lebens eine Art Notwendigkeit inne.“
Auf S. 50 f.:
„La liberté était notre unique règle. Nous défendions qu’on s’aliénât à des rôles, à des droits, à de complaisantes représentations de soi. … Nous mesurions la valeur d’un homme d’après ce qu’il accomplissait: ces actes et ses œuvres. Ce réalisme avait du bon; mais notre erreur était de croire que la liberté de choisir et de faire se rencontre chez tout le monde; par là, notre morale demeurait idéaliste et bourgeoise; nous imagi-ons que nous saisissions en nous l’homme dans sa généralité: ainsi manifestions-nous, à notre insu, notre appartenance à cette classe privilégiée que nous pensions répudier.”
D.h.:
“Unsere einzige Regel war die Freiheit. Wir lehnten es ab, uns in bestimmten Rollen, Rechten, selbstgefälligen Vorstellungen von uns selbst zu entfremden. … Wir maßen den Wert eines Menschen auf Grund dessen, was er zustande brachte: seiner Taten und seiner Werke. Dieser Realismus hatte viel Gutes für sich; aber unser Irrtum bestand darin zu glauben, dass Wahl- und Handlungsfreiheit bei allen Menschen anzutreffen sei; so dass unsere Moral idealistisch und bürgerlich blieb; wir bildeten uns ein, in uns den Menschen in seiner Allgemeinheit zu erfassen: so bekundeten wir, unwissentlich, unsere Zugehörigkeit zu jener privilegierten Klasse, die wir abzulehnen vermeinten.“
Was Karl Marx kaum besser auszudrücken vermocht hätte. Auch bei Beauvoir werden Grenzen des Existenzialismus sichtbar, die Sartre 1960 in seiner Kritik der dialektischen Vernunft mit Hilfe des Marxismus überwinden wollte. Umso wichtiger wird es sein, Beauvoirs Freiheitsbegriff von 1947 mit ihrer Marxismus-Kritik des gleichen Jahres in Beziehung zu setzen.
Aus den zitierten Äußerungen Beauvoirs zum Thema Freiheit lässt sich Folgendes ableiten:
1. Im Jahr 1929, also mit 21 Jahren, glaubt die Autorin, endlich die Freiheit erlangt zu haben, von der sie schon als Kind und als Jugendliche geträumt hat.
2. Nur die eigene Vernunft und die eigenen Wünsche – bzw. Bewusstsein und Wille – sollen die Entscheidungen des Paars Sartre/Beauvoir bestimmen.
3. Da sie in jeder Veränderung einen Fortschritt sahen, konnten sie alles, und auch sich selbst, immer wieder in Frage stellen; und zwar im Namen der Zukunft, nicht in dem der für volatil gehaltenen Gegenwart und Vergangenheit.
4. Tagtäglich übten sie sich – spielerisch – in der Freiheit, die sie für die eigentliche Sub-stanz ihres Lebens hielten.
5. Freiheit verwirft jeglichen Zwang, verbindet sich aber mit der Notwendigkeit.
6. Ihr Irrtum: Sie nahmen an, dass auch alle ihre Mitmenschen von ihrer angeblichen Wahl- und Handlungsfreiheit Gebrauch machten. Gut marxistisch hielten sie ihre eigene Position für bürgerlich und idealistisch.
Unverkennbar verortet Beauvoir die Freiheit stärker als Sartre im eigenen Leben und folglich im eigenen Willen, ohne deshalb die Rolle des Bewusstseins bei allen Entscheidungen zu ver-nachlässigen. Dagegen behauptet Susanne Moser, für Beauvoir sei der Wille das einzig ent-scheidende Kriterium. Moser schreibt:
„Bei Beauvoir bestimmt sich die Freiheit nicht aus der ursprünglichen Transzendenz des Menschen, so wie bei Sartre, sondern aus dem Willen. Es bedarf einer Entscheidung, eines Willens, Subjekt sein zu wollen. Erst durch diese Setzung und die damit zusammenhängende Realisierung konkreter Entwürfe mache ich mich zu einem Subjekt, zu einer Transzendenz. Ansonsten verbleibe ich in der Immanenz, im An-sich, und verzichte auf meine Freiheit. Der eigene Verzicht auf die Freiheit stellt für Beauvoir eine moralische Verfehlung dar, wird er einem aufgezwungen, führt dies zu Frustration und Bedrückung. In beiden Fällen ist es ein absolutes Übel. Beauvoir versteht den Menschen demnach als Synthese von Freiheit und Notwendigkeit, Transzendenz und Faktizität, Für-sich-sein und An-sich-sein, wobei es jedoch möglich ist, dass der eine Teil, nämlich Freiheit-Transzendenz-Für-sich-sein, verloren geht.
Wird damit aber nicht der gesamte existentialistische Ansatz in Frage gestellt, der ja gerade die Unmöglichkeit der Vereinseitigung zugunsten eines Teiles des Bezuges aufzeigt? Kann man dann noch von Menschen sprechen, wenn ein Teil der Doppelsinnigkeit fehlt? Kann man von Frauen, die in der Immanenz leben, noch sagen, dass sie Menschen sind?“20
Diese Thesen lassen sich an Hand der Beauvoirschen Texte, insbesondere aus Pour une morale de l‘ambiguïté (‚Für eine Moral der Doppelsinnigkeit‘) von 1947, überprüfen. Wie Karl Marx ist Simone de Beauvoir überzeugt, dass die Menschen kraft ihres Willens über ihr eigenes Schicksal entscheiden sollen („seule la volonté des hommes décide“, a.a.O. S. 26), wobei dies stets auch im Rahmen bestimmter ökonomischer, sozialer und politischer Bedin-gungen vonstatten gehe. Revolutionäre Werte entstehen nicht naturwüchsig, sondern hängen sowohl von der jeweiligen Klassenlage als auch von deren korrekter Analyse ab, so dass Marxisten in dieser Hinsicht den bürgerlichen Intellektuellen wenig zutrauen.
Voraussetzung für jegliche Revolte sei aber, so Beauvoir, das Bewusstsein der Freiheit, und zwar nicht nur der eigenen Person, sondern auch aller anderen! Was nichts an der Aufgabe ändere, Freiheit und Determinierung miteinander in Einklang zu bringen. Wie aber sollen Freiheit und Wille kooperieren, ohne in die Ausweglosigkeit der Verzweiflung zu geraten? Beauvoir verweist hierzu auf Handlungsprinzipien, die angeblich unmittelbar aus der Freiheit hervorgehen: Moral darf nicht nur beliebig auf das Gelingen oder Scheitern jeglichen Handelns reflektieren, sondern muss auch Wege zum Gelingen aufzeigen. Sein und Wille sind nicht von Grund auf identisch. Vielmehr kommt alles darauf an, zunächst das Sein zu enthül-len („dévoiler l‘être“), um die Freiheit zu sichern, zumal auf ihr angeblich alle Bedeutungen und alle Werte beruhen. Ohne Freiheit gebe es keine Möglichkeit, die Existenz zu rechtferti-gen (a.a.O. S. 33). Freiheit ist keine Selbstläuferin; sie erscheine nicht auf der Ebene der Fak-ten, sondern auf der Ebene der Moral. Die Freiheit zu leugnen, würde bedeuten, jeglicher Be-gründbarkeit den Boden zu entziehen: „Sich moralisch und sich frei zu wollen, ist eine und dieselbe Entscheidung.“ (S. 34) Zumal menschliche Aktivität stets auf Ziele und Zwecke ge-richtet sei (S. 36).
Erst durch die Freiheit werde es möglich, die natürlicherweise kleinteilig zerstückelte Zeit mit einem Faktor der Vereinheitlichung zu versehen. Daher genüge es nicht, die Freiheit unter subjektiven und formalen Aspekten zu betrachten. Die Freiheit braucht Inhalte. Diese sind aber nicht im Dunkel des gelebten Augenblicks („in der Absurdität des reinen Augenblicks“) zu finden. Vielmehr muss man, um moralische Fragen zu lösen, sowohl die eigene Vergan-genheit als auch die eigenen Zukunftsmöglichkeiten zu Rate ziehen; wozu aber nicht schon Kinder und Jugendliche, sondern nur Erwachsene in der Lage seien.
Wie auch zu dem, was Beauvoir als „kreative Freiheit“ bezeichnet. Darin vertraue man darauf, dass das vergangene Schöpferische neue Kreationen ermögliche. Auch wenn der Mensch nicht der Schöpfer der Welt ist, sondern sein Schöpfertum an den Widerständen unter Beweis stellen muss, auf die er in eben dieser Welt stößt; wobei nicht alle Hindernisse über-wunden werden können.
Mit Descartes könne man festhalten, dass die Freiheit des Menschen grenzenlos ist, nicht aber seine Macht über die Dinge. Erst wenn wir erkennen, dass nicht alles machbar ist, können wir unsere Freiheit behalten und bewahren. Jedes einzelne Projekt konfrontiert sie mit speziellen Problemen, lässt sich aber auch vom Scheitern nicht entmutigen, vorausgesetzt, man verliert nicht den Blick auf künftige Möglichkeiten, den freien Blick auf die Zukunft. Vorausgesetzt auch, dass einem der Wille zum Leben erhalten bleibt, so dass Freiheit und Befreiung iden-tisch werden können, dies auch in Bezug auf die Freiheit der Mitmenschen. Wenn der Mensch seine Existenz retten will, braucht er diejenige moralische Freiheit, die es ihm ermöglicht, den jeweiligen speziellen Inhalt seines Tuns zu erkennen und ihm gerecht zu werden.
Anders als Kant sieht Beauvoir die Menschen in dauerndem Konflikt mit sich selbst. Da „schlechter Wille“ auftreten kann, macht es Sinn, unbedingt frei sein zu wollen („se vouloir libre“). Dadurch bekomme der Existenzialismus unter allen Philosophien sogar eine Vorzugs-stellung hinsichtlich der Moral: Nur in ihm sei Moral wirklich möglich und präsent. Das Böse lasse sich nicht humanistisch relativieren, nichts sei ein für allemal festgelegt, und nur, weil es wirkliches Scheitern gibt, könne der Existenzialismus auf dessen Überwindung und auf „Siege, Weisheit und Freude“ hoffen, auch wenn Irrtümer aller Art nie auszuschließen seien.
Kindern bleibe diese Art von Freiheit noch verschlossen, während ihnen vielerlei Rollenspiele stets offenstehen. Dies ähnlich wie in anderen Formen von Unfreiheit, wie in der Sklaverei oder im Patriarchat. (Was sicherlich ein weiteres Motiv dafür war, dass Beauvoir Le deuxième sexe (‚Das andere Geschlecht‘), das Grundbuch des modernen Feminismus, geschrieben hat.) Umso mehr fordert Beauvoir Selbstbestimmung ein, durch welche Auswege und Rettung auch bei noch so unglücklichen Entscheidungen immer möglich seien (S. 59).
Dabei könne für die Moral niemals absolute Gültigkeit beansprucht werden. Dagegen verrate der Tierisch-Ernste („l’homme sérieux“) die Freiheit, indem er sie angeblich absoluten Wer-ten unterwerfe und so unfrei, d.h. zum Sklaven dieser Werte werde. Dem stellt Beauvoir das Prinzip Freiheit entgegen, und zwar als das einzige, dem Letztgültigkeit zukomme, ohne dabei den Begriff Freiheit zu isolieren und damit zu verabsolutieren. Wohingegen der Tierisch-Ernste leicht dem Nihilismus verfalle; darin ähnlich den „Dämonischen“, die keine positive Freiheit kennen oder anerkennen. Der Nihilist überantwortet sich selbst und damit das Mensch-Sein dem Nichts.
Als weiteren Feind der Freiheit nennt Beauvoir den „Abenteurer“ (‚l’aventurier‘), der wie der Nihilist die Menschen verachte. Wille zur Macht (‚volonté de puissance‘) sei das Kains-zeichen des Abenteurers. Und schon hier zeigt sich, wie weit Beauvoir von der Überheb-lichkeit und Anmaßung Nietzsches entfernt ist. –
Ferner: Auch „der Leidenschaftliche“ (‚le passionné‘) verfehlt die Freiheit, indem er vermeint, durch bloße Subjektivität auch alles Objektive erfassen zu können. Bei ihm treten Stolz, Selbstgefälligkeit und Sturheit an die Stelle kreativer Freiheit. Statt Personen und Dinge zu respektieren, will der Passionné unbedingt von ihnen Besitz ergreifen. Was ihn aber in die Isolation und letztlich zur Tyrannei treibe. Wo die Leidenschaft allein herrscht, ist für Moral kein Platz mehr, werden Personen zu Sachen, tritt Fanatismus an die Stelle freiheitlicher Gesinnung, treten Dauerkonflikt und Unterdrückung an die Stelle von freiheitlicher Selbstfin-dung.
Dagegen betont Beauvoir den Wert der Freiheit, die stets die Freiheit aller Mitmenschen impliziert. Bloße Faktizität verkommt zur Absurdität. Auch hier erweise sich der Existenzia-lismus als wirksames Gegenmittel, und zwar erneut nicht als „Wille zur Macht“, den Nietz-sche auch allen Mitmenschen aufzwingen wolle. Solipsistische Subjektivität werde im Exi-stenzialismus nachhaltig überwunden durch die Anerkennung der Freiheit aller, wodurch jeg-liche Existenz erst einen Sinn bekomme. Die Beziehung moi-atrui (Ich-die Anderen) hält Beauvoir für ebenso unauflöslich wie die dialektische Subejekt-Objekt-Beziehung. Der Exi-stenzialismus versteht sich nicht als Formalismus, sondern als stete Aufforderung zu konkre-tem Engagement der Einzelpersonen für sich und die anderen.
Ein ganzes, fast 30 Seiten umfassendes Kapitel widmet Beauvoir dem Thema „Freiheit und Befreiung‘ (S. 113-139). Im Gegensatz zu einigen Kritikern hält sie den Existenzialismus nicht für passivierend, sondern für den Inbegriff konkreten, solidarischen Handelns in be-stimmten Verhaltensweisen. Dabei geht es weder um das Streben nach „Absolutem Wissen“ noch nach perfekter Schönheit oder dem „Glück der Menschheit“, sondern um Existenz-Erweiterung, und zwar auch in Wissenschaft und Technik, in denen nicht Besitzergreifung, sondern kontinuierliche Kreativität und ständige Suche nach neuer Erkenntnis oberste Ziele seien. Als Fernziel nennt Beauvoir die freie Entfaltung jeder Persönlichkeit, ein Fernziel, das durch widersacherische Unterdrückung und Entfremdung in Frage gestellt werde (S. 117). Wogegen jedem/r Unterdrückten das Recht auf Gegenwehr und zur Revolte einzuräumen sei. Der/die Unterdrückte mache positiven Gebrauch von seiner/ihrer Freiheit, wenn er/sie sich gegen Tyrannen und Ausbeuter auflehnt. Dies wohl auch im Sinne von Karl Marx, auch und gerade in dessen Opposition zum Hegelschen Idealismus. Wobei auch die Befreiungskämpfe der Vergangenheit motivierend wirken können, wie Beauvoir am Beispiel der Renaissance-Humanisten aufzeigt (S. 133). Es komme darauf an, sich zu solchen Vorbildern zu bekennen und sie in die eigene Gegenwart zu integrieren. Bloßer Utilitarismus hilft da nicht weiter. Nichts ist nützlich, wenn es nicht wirklich den Menschen nützt. Nichts nützt ihnen, wenn sie unfrei sind und ohne Selbstbestimmung leben müssen. Unterdrückung darf nicht hingenom-men werden.
Marxismus-Kritik
Der Existenzialismus fordert, stets neu die jeweilige Situation zu analysieren, bevor Entschei-dungen über konkrete politische und andere Aktionen getroffen werden. Demgemäß kritisiert Beauvoir die teleologische und deterministische Voreingenommenheit, die teilweise auch bei Marx anzutreffen sei; sie schreibt:
«Aucune tradition historique, aucune structure géographique, aucun fait économique ne peut imposer une ligne d’action: ils constituent seulement des situations à partir desquelles les projets différents sont possibles.»21
(‚Keine historische Tradition, keine geografische Struktur, keine ökonomische Tatsache kann irgendwo eine Handlungs-Richtlinie auferlegen: sie bilden lediglich Situationen, von denen aus die unterschiedlichen Projekte möglich sind.‘)
Daher könne es keine historische Teleologie geben, durch die jegliche politische Aktivität a priori determiniert wäre. Dagegen komme es darauf an, die jeweilige eigene Subjektivität zu mobilisieren, um die geschichtliche Wirklichkeit angemessen analysieren und Handlungs-möglichkeiten eröffnen zu können. In Pour une morale de l‘ambiguïté verstärkt Beauvoir diese Forderung auch im Hinblick auf die Moral. Man dürfe die eigene Freiheit nicht auf-geben z.B. zu Gunsten der Auffassung, wonach der sozialistische Staat bereits das Maß aller Dinge bereitstelle. Marx selbst habe den sozialistischen Staat nicht als das Ende der Ge-schichte, sondern als das Ende der Vorgeschichte der Menschheit bezeichnet, von dem aus erst die wahre Geschichte beginnen könne. An die Stelle der von utopischen Sozialisten bemühten Archetypen wie „Gerechtigkeit“, „Ordnung“, „das Gute“ habe Marx die Forderung gesetzt, von den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen und ihrem revolutionären Poten- zial auszugehen. Dabei beruft Beauvoir sich vor allem auf die Marxschen Frühschriften, insbesondere die Pariser Manuskripte von 1844. Folglich kritisiert sie zeitgenössische Marxi-sten, die die Freiheit in weite Ferne verlegen – statt die Freiheit selbst als Mittel als Mittel der revolutionären Analyse einzusetzen. Daher pocht sie auf das freiheitliche Subjekt-Sein der Individuen, das keineswegs nur als Reflex objektiver Bedingungen zu verstehen sei. Gegen mechanistische und objektivistische Geschichtsauffassungen betont Beauvoir « l’ambiguïté fondamentale de la condition humaine qui ouvrira toujours aux hommes la possibilité d’options opposées » (‚die grundsätzliche Doppelsinnigkeit der menschlichen Grundbefind-lichkeit, die den Menschen auch immer wieder die Möglichkeit gegensätzlicher Optionen er-öffnen wird‘). In der Doppelsinnigkeit drückt sich die unvermeidliche Ungewissheit aus, die mit jedweder Aktion verbunden ist; so dass eine ethische Dimension des politischen Handelns auch aus den mit ihm verbundenen Risiken und Unwägbarkeiten entsteht. Beauvoir:
«Le but n’est pas fixé une fois pour toutes, il se définit tout au long du chemin qui y conduit.»
(‘Das Ziel ist nicht ein für allemal vorgegeben, es wird ständig definiert auf dem Weg, der zu ihm führt.‘ a.a.O.)
Freiheit und Moral – zum gegenwärtigen Forschungsstand
Zum Forschungsstand von Entwicklungs-Psychologie und - Neurologie
Wie aus den Erkenntnissen von Ernst Habermann (1996), Benjamin Libet (2005) und Markus Kiefer (2015) hervorgeht, verfügen Säuglinge bereits über angeborene Fähigkeiten wie dieje-nigen zur Willensfreiheit und zur Unterscheidung von Gut und Böse. Der einstige Ethik-Kommissar Ernst Habermann erklärt hierzu (1996):
„Die Evolution hat zwei feine Sensoren der Solidarität erfunden, nämlich Gewissen und Mitleid, und mit der Befindlichkeit gekoppelt. Die biologisch vorgegebene, späte-stens beim Menschenaffen … gesicherte Einfühlung ist eine wichtige Grundlage unseres Ethos.“22
Wobei Habermann neben dem Streben nach guter Befindlichkeit zwei weitere, evolutionär entstandene Grundfaktoren der Ethik nennt: die Gegenseitigkeit und die Überwindung des puren Egoismus durch Altruismus und Zusammenarbeit. Es sind Faktoren, die Habermann problemlos mit Kants Kategorischem Imperativ verbindet:
„Der Einzelne soll sein spezielles Verhalten so einrichten, daß es sich als Maxime aller Partner eigne.“ (ebd.)
Dies sei ein Satz, mit dem Kant „zutiefst recht“ hatte.
Feststeht allerdings auch, dass Säuglinge noch nicht in der Lage sind, Willensfreiheit und Morals bewusst anzuwenden bzw. zu erproben. Der Hauptgrund hierfür liegt in der Tatsache, dass die für solche Aktivitäten erforderlichen Gehirn-Areale bei Säuglingen noch nicht heran-gereift sind.
Demgemäß lässt sich für die Situation im Säuglingsalter festhalten:
1. Obwohl die Fähigkeiten zu Willensfreiheit und Moral angeboren sind, spielen sie im Säuglingsalter noch fast gar keine Rolle, weil die erforderlichen Gehirn-Areale noch nicht herangereift sind.
2. Allerdings beginnt schon kurz nach der Geburt der Aufbau eines umfangreichen Netz-werks aus Neronenzellen (Neuronen) und deren Verbindungen (Synapsen).
3. Dadurch entsteht hohe neuronale Plastizität.
4. Das Zusammenspiel verschiedener Hirnregionen beginnt.
5. „Säuglinge handeln primär aufgrund von Reflexen und grundlegenden Bedürfnissen, ohne die kognitive Reife, um zwischen komplexen moralischen Kategorien wie „gut“ und „böse“ zu unterscheiden.“ (In: Microsoft-Copilot 28.04.2025)
Zur Entwicklung des Selbst
Für die Entwicklung vom Säuglingsalter zum Kindes- und Jugendalter spielt das Selbst eine entscheidende Rolle. Erst das Selbst schafft Bewusstsein auf der Grundlage u.a. von Wahr-nehmung, Gedächtnis, Verstand und Selbstbewusstsein und damit den Zugang zu allen Ressourcen der Vernunft und des Geistes. Nietzsche hatte dieses Selbst irrtümlich noch mit dem Leib gleichgesetzt. Warum er sich damit im Irrtum befand, geht vor allem aus den For-schungsergebnissen hervor, die der Neurowissenschaftler Joachim Bauer u.a. in seinem Buch Wie wir werden, wer wir sind (2019) vorgetragen hat. Darin weist er auf, dass das Selbst – anders als Nietzsche es vermeinte – nicht mit dem Leib identisch, d.h. nicht angeboren ist, sondern erst durch zwischenmenschliche Beziehungen im Säuglingsalter zu entstehen beginnt:
„Der menschliche Säugling, obwohl ein fühlendes, mit der Würde des Menschen aus-gestattetes Wesen, verfügt über kein Selbst. Die neuronalen Netzwerke, in denen sich Letzteres einnisten wird, sind zum Zeitpunkt der Geburt noch unreif und funktions-untüchtig. Seine Entstehung und Grundstruktur verdankt das menschliche Selbst jenen Bezugspersonen, die uns – vor allem in den ersten Lebensjahren – als »Extended Mind«, das heißt, als eine Art externe Leitstelle gedient haben. An der Komposition des Selbst sind Resonanzvorgänge beteiligt, wie sie sich zum Beispiel zwischen zwei Gitarren beobachten lassen: So, wie der Klang der einen Gitarre die Saiten einer zweiten Gitarre zum Klingen bringen kann, so können Bezugspersonen ihre inneren Melo-dien – ihre Art zu fühlen, die Welt zu deuten und in ihr zu handeln – via Resonanz auf den Säugling übertragen. Da dieser Transfer sich – in reduzierter Form – lebenslang fortsetzt, ist unser Selbst eine Komposition aus entsprechend vielen Themen und Melodien.“ (a.a.O. S. 7)
Das Selbst ist also nicht einfach der Leib, sondern ein Gemisch, ein mixtum compositum, aus dem personalen Individuum – als Einheit aus Leib, Seele und Geist –, seinen Bezugspersonen, seiner Umwelt und der Gesamtheit seiner Erfahrungen. J. Bauer präzisiert:
„In Säuglingen und Kleinkindern komponiert sich ein Selbst, dessen Themen von ihren Bezugspersonen über Resonanzvorgänge in sie hineingelegt wurden. Je weiter wir heranwachsen und persönlich reifen, desto mehr wird das Selbst zu einem Akteur, der mitspricht und beeinflusst, was mit ihm geschieht. Wir entwickeln ein Gefühl, das uns spüren lässt, welche an uns herangetragenen Angebote zu uns passen und zu einem stimmigen Teil unseres Selbst werden könnten, und welche unserer Identität Gewalt antun würden. Der Mensch ist das einzige Wesen, das sich an der Konstruk-tion seiner selbst – und seines Selbst – beteiligen kann, ein Hinweis, der in dieser ex-pliziten Form erstmals durch den Renaissance-Philosophen Pico de la Mirandola gege-ben wurde.“ (a.a.O. S. 8, Hervorhebungen K.R.)
Näheres und Weiteres hierzu führt J. Bauer auf 255 Seiten in 15 Kapiteln aus, darunter spe-ziell zum Selbst-System in den Kap. 1-6, 10, 11, 13 und 14, daneben und zusammen mit Themen wie Resonanz (darunter dem „Resonanzraum der Gesellschaft“, wenn auch nur auf gut 6 Seiten), Pädagogik, Arbeit, Partnerschaft, Psyche und Neurobiologie.
Zur Entstehung des Selbst:
Der Säugling wirkt und ist zunächst einerseits völlig hilflos und unreif, zeigt aber andererseits schon frühzeitig Fähigkeiten zu Anteilnahme und Kommunikation mit seinen/ihren Bezugs-personen, und zwar u.a. dadurch, dass Säuglinge schon früh beginnen, z.B. die Mimik einer Bezugsperson nachzuahmen. Echte Spiegelung und Resonanz wird daraus allmählich auf Grund der sogenannten Spiegelneuronen oder auch: Spiegel-nervenzellen. (Wobei sogleich daran zu erinnern ist, dass diese speziellen Nervenzellen für die Empathie zuständig sind.) Hier liegen nicht Echo-Effekte, sondern echte Resonanz-Funktionen vor, und zwar u.a. in Form von Signalen der Körpersprache bzw. des Gefühlsausdrucks sowohl beim Säugling als auch bei der Bezugsperson. Hierdurch werde sogar das Gehirn des Säuglings geformt (a.a.O. S. 24). Wobei sich das Selbst nach und nach u.a. als Ich-Du-Sinn herausbilde:
„ Der Mensch entwickelt seinen Ich-Sinn in einer absolut einzigartigen Art und Weise: Das Selbst des Menschen als »Ich-Du-Sinn«. Das Resonanzprinzip lässt die Ge-stimmtheiten, Haltungen und Handlungsweisen der primären Beziugsperson(en) zu den Gefühlen und inneren Einstellungen des Kindes werden.“ (J. Bauer a.a.O. S. 31, Hervorhebungen K.R.) Daher fordert der Autor auch für die Kleinsten „ein sozial in-telligentes Umfeld, also Eltern oder gut qualifizierte Bezugspersonen, die ihnen ein verlässliches, liebevolles, dabei aber nicht einengendes, sondern förderndes Du sind.“ (a.a.O. S. 57)
Im Zusammenhang damit beschreibt J. Bauer auch den frühkindlichen Spracherwerb, wobei er hervorhebt, dass von der Sprache auch psycho-physische Top-down-Bewegungen ausgehen, und zwar mittels neurobiologischer Rezeptoren im Gehirn, wobei nicht nur die Sprachzentren des Gehirns, sondern auch die Spiegelneuronen und das neuronale Selbst-System aktiv werden. Zwischen beiden Systemen gebe es eine Arbeitsteilung. Das Selbst-System arbeitet vor allem mit kognitiven Geistesinhalten (Gedanken, Ideen, Begriffe, Theorien, Wertungen usw.), während Spiegelneuronen nach speziellen neurobiologischen Regeln funktionieren, und zwar auf Grund von „Informationen, die sich mit dem Körper ausdrücken oder am Körper ablesen lassen“ (S. 85). (Was natürlich ebenfalls eine Form von Resonanz ist.) Das Erstaunliche daran: Die durch das neurobiologische Resonanzsystem „übertragene Information ist nichtstofflicher Natur“ (S. 86)! Die Körpersprache wird dabei sozusagen „ausgelesen“, indem der Beobachter die beobachtete Handlung „sozusagen »heimlich, still und leise« simuliert, das beobachtete Geschehen also intern als Kopie mitlaufen lässt“ (ebd.), was mit dem Phänomen der „emotionalen Ansteckung“ verbunden sein kann; Gemütszustände wirken dann wechselseitig:
„Das Lesen der Körpersprache kann durch Erfahrung und Übung optimiert werden. Menschen mit Autismus können die Körpersprache anderer nicht »lesen«. Besonders geübt im Entschlüsseln der Körpersprache sollten Menschen sein, die viel mit anderen zu tun habe: Pflegekräfte, Sozialarbeiterinnen uns Sozialarbeiter, Servicepersonal, Ärztinnen und Ärzte, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte, Anwältinnen und An-wälte, Richterinnen und Richter, Eltern und Großeltern.“ (S. 89)
Die Kehrseite: Es gibt auch das Leiden am Selbst, so in Phänomenen wie Narzissmus, Abhängigkeit, Depressionen, bis hin zu ‚Gaslighting‘ (Psychoterror durch Einschüchterung u.a.m.) und zur „Auflösung des Selbst“, z.B. in Erkrankungen wie Traumatisierung und Demenz. – Wogegen das Selbst sich jedoch zu wehren vermag:
„Das Selbst ist jedoch nicht machtlos. Es spürt nicht nur, welche Menschen und welche Ansagen ihm guttun oder nicht behagen, welche seine Kräfte vermehren oder schwächen. Es hat den Selbst-Beobachter an seiner Seite, der es ihm ermöglicht, sich über sich, über die eigenen Motive und über die Motive anderer Gedanken zu machen. Sein Sensorium und seine Analyseinstrumente befähigen das Selbst, Einfluss darauf zu nehmen, mit welchen Menschen es sich umgibt, welchen Menschen es sich anschließt und was mit den Botschaften passiert, die von Mitmenschen im eigenen Selbst landen.“ (S. 161)
Insgesamt gesehen hält J. Bauer den Besitz des Selbst-Systems für ein Erkennungs- und Alleinstellungsmerkmal der menschlichen Spezies. Es befähigt sowohl zur Selbst-Fürsorge als auch zur Fürsorge für andere Menschen. Es verhilft zur Ich-Findung, zur inneren Ruhe und Gelassenheit, so auch in der Meditation, in Yoga und – falls erforderlich – durch Psycho-therapie. Worin J. Bauer auch Möglichkeiten und zugleich Verpflichtungen des ärztlichen Tuns erkennt, die weit über Diagnostik und Therapie hinausgehen:
„Wen adressieren Ärzte, wenn sie eine Diagnose mitteilen oder die Behandlung erklären? Sie adressieren das Selbst-System ihrer Patienten, welches – parallel zu dem, was der Arzt tut – seinerseits, sozusagen als »innerer Arzt«, in den eigenen Körper hineinwirkt. Optimale Heilerfolge erzielen nur solche Ärzte, die in der Kommu-nikation mit ihrem Patienten dessen Selbst-Kräfte und seine Zuversicht stärken und ihm erklären, dass es sich lohnt, den Lebensstil gesundheitsdienlich zu verändern, und die ihm Mut machen, der Krankheit die körpereigenen Heilkräfte entgegenzusetzen. Zu den Aufgaben jedes guten Arztes gehört es, den »inneren Arzt« seiner Patienten anzusprechen und zu stärken.“ (S. 200 f.)
Und Bauers Schlusswort lautet:
„Der Umgang mit unserem Selbst – und mit dem unserer Mitmenschen – erfordert Sensibilität, Geduld, Bewahrung, manchmal aber auch einen mutigen Schritt hinein in Möglichkeits- und Entwicklungsräume. Mehr als alles andere aber braucht unser Selbst – und das unsere Mitmenschen – dieses eine: Liebe.“ (S. 209)
Dies ganz im Sinne meiner eigenen Darlegungen zum Thema „Liebe als Weltknoten“.23 Wobei allerdings zu bedenken ist, dass mit Liebe allein leider nicht alle Welt-Probleme zu lösen sind. (Vgl. Robra 2024 ebd.)
Willensfreiheit und Moral im Kindes- und Jugendalter
Erst unter den Aspekten des Selbst lässt sich verstehen, wie Kinder und Jugendliche Willens-freiheit und Moral zu aktivieren vermögen. Hierzu bemerkt Microsoft Copilot:
„Kinder besitzen in gewissem Maße sowohl Ansätze von Willensfreiheit als auch einen angeborenen moralischen Kompass, doch beide Eigenschaften befinden sich in einem fortwährenden Entwicklungsprozess.
Schon im frühen Kindesalter treffen Kinder erste Entscheidungen – sie zeigen Eigen-initiative und reagieren impulsiv auf ihre unmittelbaren Bedürfnisse. Dieses frühe Entscheidungsverhalten kann als rudimentäre Form von Willensfreiheit betrachtet werden, auch wenn es noch stark von Emotionen, unmittelbaren Belohnungen und der eingeschränkten Fähigkeit zur Perspektivübernahme geprägt ist. Mit zunehmendem Alter und wachsender kognitiver Reife entwickeln sie zunehmend die Fähigkeit, bewusste und reflektierte Entscheidungen zu treffen, auch wenn externe Einflüsse wie Erziehung und kulturelle Normen weiterhin ihre Entscheidungsfreiheit mitbestimmen.
Parallel dazu beginnt sich schon früh ein moralisches Empfinden zu entwickeln. Bereits Kleinkinder reagieren auf ungerechte Situationen oder unfaire Behandlung mit Empörung – sie zeigen ein intuitives Verständnis von Gerechtigkeit und können zwischen „richtig“ und „falsch“ unterscheiden, wenn auch zunächst auf einer emotionalen und erfahrungsbasierten Ebene. Im Laufe der Zeit und unter dem Einfluss von Eltern, Erziehern und Gleichaltrigen lernen Kinder, moralische Normen zu verinnerlichen und diese in ihrem Verhalten zu berücksichtigen. Dabei spielt auch die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten wie Empathie und Perspektivenübernahme eine zentrale Rolle, da sie es den Kindern ermöglicht, die Auswirkungen ihres Handelns auf andere Menschen besser einzuschätzen.
Die Weiterentwicklung von Willensfreiheit und moralischem Urteilsvermögen hängt eng mit der Reifung des Gehirns zusammen – insbesondere mit der Entwicklung des präfrontalen Kortex, der für Impulskontrolle, Planung und die Bewertung langfristiger Konsequenzen verantwortlich ist. Dieses neurologische Wachstum erklärt, warum ältere Kinder und Jugendliche in der Regel eine größere Unabhängigkeit bei Ent-scheidungsfindungen und ein differenzierteres moralisches Verständnis aufweisen als jüngere Kinder. Gleichzeitig bleibt die Frage, inwieweit Entscheidungen und morali-sche Urteile wirklich frei sind oder vielmehr von biologischen, sozialen und kulturellen Faktoren mitbestimmt werden – eine Diskussion, die Philosophen, Psychologen und Neurowissenschaftler bis heute beschäftigt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kinder erste Formen von Willensfreiheit und moralischem Empfinden besitzen, die aber im Laufe der Entwicklung durch kognitive Reifung, soziale Interaktionen und den Einfluss von Erziehung kontinuierlich verfei-nert und erweitert werden. Diese dynamische Entwicklung bildet die Grundlage für die spätere moralische Selbstbestimmung und die Fähigkeit, komplexe, ethisch fundierte Entscheidungen zu treffen.“
Kann es eine allgemein verbindliche Ethik bzw. Moral geben?
Von ausschlaggebender Bedeutung sind also in Erziehung und Sozialisation die Beziehungen der Kinder und Jugendlichen zu ihren Bezugspersonen. Kompliziert wird dies dadurch, dass alle drei Personen-Kreise – und insbesondere die Erwachsenen – in hohem Maße von den sie prägenden gesellschaftlichen Verhältnissen und den damit verbundenen Ideologien beein-flusst werden. Diese Einflüsse zufriedenstellend zu analysieren und zu bewerten, ist kaum möglich, weil sie abhängen
a) von jeder Einzelperson selbst,
b) von den Herrschaftsverhältnissen und sonstigen Bedingungen innerhalb einer gesell-schaftlichen Gruppe, Schicht oder Klasse,
c) von den lokalen, nationalen und globalen Entwicklungen sozialer, politischer und öko-nomischer Art.
Schon diese letztlich unüberschaubaren Zusammenhänge lassen vermuten, dass es eine für alle Menschen verbindliche Moral nicht geben kann. Moral findet in den Köpfen und inner-halb der jeweiligen gesellschaftlichen Formation statt. Sie ist daher u.a. an die Gehirntätig-keit gebunden und damit an die bekanntlich unüberschaubare, mathematisch nicht erfassbare neuronale Kombinatorik.
Hinzu kommt, dass der Prototyp einer verbindlichen Ethik – und damit eines Maßstabs für konkrete Moral –: Kants Kategorischer Imperativ, sich im Ganzen als unhaltbar erwiesen hat.24 Gültigkeit kann anscheinend nur für dessen Zweckformel beansprucht werden. Demnach steht wohl fest, dass jeder Mensch stets als Selbstzweck – und folglich als Rechtsperson –, niemals nur als Mittel zum Zweck behandelt werden muss. Darüber hinaus können allenfalls legitime Forderungen erhoben werden, die z.B. lauten können:
1. „Achte bei allem, was Du tust, darauf, Dich selbst und Deine Mit-Menschen als Rechtspersonen und Persönlichkeiten zu respektieren und möglichst stets das Sittengesetz zu befolgen.
„Möglichst“ deshalb, weil es Ausnahmesituationen gibt, wie z.B. die der Notwehr, in denen die Rechte der eigenen Person gegen existenzielle Bedrohungen und Rechtsbrüche jeder Art zu verteidigen sind.“
2. „Verhalte Dich so, dass Du die Natur in jeder Person und in jeder anderen Erscheinungsform stets als Zweck – und als Mittel nur zu ethisch begründbaren und moralisch vertretbaren Zwecken – behandelst.“ 25
Diese Forderungen betreffen sowohl die humanen bzw. humanistischen als auch die natürli-chen bzw. ökologischen Sphären. Sie können auch in Erziehung und Sozialisation als Orien-tierung dienen. Sie können dazu beitragen, dem Ziel näher zu kommen, das Marx im Sinn hatte, als er feststellte, dass „auch die Erzieher erzogen werden müssen“
Vom Selbst zur Demokratie
Dankbar bin ich für eine politische Perspektive, die sich aus einem von Joachim Bauer nicht erwähnten Aspekt des Selbst-Systems ergibt:
Da das Selbst-System zur Ich-Findung, Selbst-Fürsorge und Fürsorge für andere Menschen befähigt, hat das Individuum – das personale Selbst – einen Rechtsanspruch auf Selbst-bestimmung, und zwar auch deshalb, weil der Mensch das einzige Wesen ist, „das sich an der Konstruktion seiner selbst – und seines Selbst“ beteiligt bzw. beteiligen kann, soll und muss. Beteiligt ist der Mensch vom Säuglingsalter an (s.o.). Beteiligen muss er sich später daran, wie sein Selbst konkret gestaltet wird, dabei auch im gesamtgesellschaftlichen Rahmen. Dieser darf seinem Anspruch auf Selbstbestimmung nicht im Wege stehen, was nur dann möglich zu sein scheint, wenn der Anspruch auf Selbstbestimmung tatsächlich auch gesamt-gesellschaftlich gewährleistet wird. Jedes Volk hat das Recht auf Selbstbestimmung, wobei jedes personale Individuum, die Einzelperson, an der individuellen Inanspruchnahme und Wahrnehmung dieses Rechts nur dann gehindert werden darf, wenn es dabei die Rechte sei-ner Mitmenschen verletzt oder missachtet.
Politisch besagt dies: Demokratie bedeutet nicht nur „Herrschaft des Volkes für das Volk und durch das Volk“, sondern auch Selbstbestimmung des Volkes. Demgemäß erstrebenswert erscheint eine Mischung aus direkter und repräsentativer Demokratie, weil in beiden Formen – und erst recht in ihrer Kombination und effektiver Kooperation – sowohl das Gemeinwohl als auch die Rechte der Einzelpersonen gewahrt werden. – Dieser gesamtgesellschaftliche Aspekt des Selbst-Systems sollte in seiner Bedeutung nicht unterschätzt werden. Ebenso wenig wie die neue Sicht der Systemfrage, die sich aus dem Konzept Demokratie als Selbst-bestimmung ergibt: Weder mit Kapitalismus noch mit Bolschewismus ist dieses Konzept ver-einbar. Demokratie und Selbstbestimmung müssen für alle Gebiete von Wirtschaft und Gesell-schaft eingefordert werden, was angesichts des weltweiten Vordringens des neo-liberalen Kapitalismus einerseits und des undemokratischen Autokratismus andererseits fast wie eine Utopie anmutet.
Allerdings: Weder mit Liebe noch mit Demokratie allein oder zusammen können sämtliche akuten und latenten Welt-Probleme gelöst werden. Hierzu bedarf es weiterer Anstrengungen – nicht nur ethischer, sondern vor allem auch politischer Natur.
Als aktuelle Probleme mit höchstem Bedrohungspotential lassen sich herausstellen:
1. Die Öko-Katastrophe, d.h. die Zerstörung von Lebensgrundlagen in Umwelt, Natur und Klima, greift um sich, auch wenn gelegentlich Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
2. Der neolíberale Turbo-Kapitalismus verschärft in seiner globalisierten Form weltweit die sozialen Ungleichheiten, Gegensätze und Konflikte und lässt dabei u.a. Rechts-radikalismus, Nationalismus und Populismus in gefährlichem Ausmaß erstarken.
3. Die Digitalisierung droht in eine „Digitale Diktatur“ umzuschlagen, z.B. in Folge von zunehmendem Daten-Diebstahl und -Missbrauch, Cyberkrieg, illegalem Drohnen-Einsatz u.a.m.
4. Die Ideologie des Transhumanismus begünstigt ebenfalls den Missbrauch von Digi-talisierung („Big Data“) und Künstlicher Intelligenz.
5. Posthumanismus. Wie u.a. Ray Kurzweil behauptet, gibt die Menschheit sich in der „Singularität“ des Jahres 2045 selbst auf, und zwar zu Gunsten superintelligenter, „unsterblicher“ KI-Roboter. Davon abgesehen, eröffnet KI anscheinend neue Möglichkeiten in unbegrenzter Vielzahl.26
6. Nicht zu vergessen ist auch die Tatsache, dass die Menschen seit 1945, d.h. seit Hiroshima und Nagasaki, in der Angst vor der Atomkriegsgefahr leben.
Nur bei zweien (Nr. 4. u. 5.) dieser aktuellen Probleme lassen sich Bezüge zu Nietzsche herstellen: bei Trans- und Posthumanismus, wenn auch mit eher fragwürdigen Ergebnissen. Nietzsche predigt bekanntlich den Übermenschen, versteht den Menschen als „Etwas, das überwunden werden soll“ und fragt uns, was wir denn zu dieser Überwindung beigetragen hätten. Antworten des 20. Jahrhunderts lauten z.B.: Superman und Cyborg („cybernetic organism“).
Kritische Anmerkungen zu Sartre und Beauvoir
Selbstverständlich konnten Sartre und Beauvoir den gegenwärtigen, nach ihrem Tod erreich-ten Forschungsstand nicht berücksichtigen. Dennoch ist zu fragen, welche ihrer Konzepte heute noch als relevant und akzeptabel gelten können. Hierzu ist es erforderlich, diese Kon-zepte mit dem aktuellen Forschungsstand zu vergleichen. Eine in Bezug auf Sartre relativ leichte Aufgabe, da seine Entwicklung, anders als die seiner Lebensgefährtin, sich in drei klar unterscheidbare Phasen aufteilen lässt, und zwar für die Zeit
1. von den späten 1930er Jahren bis 1960,
2. von 1960 bis 1972,
3. von 1972 bis 1980.
In der 1. Phase entwickelten Sartre und Beauvoir die Philosophie des Existenzialismus; in der 2. versucht Sartre, den Existenzialismus in den Marxismus zu integrieren; in der 3. kehrt Sartre zu seinen frühen Freiheits-Konzepten zurück und versteht sich dabei als „Marxianer“ und „libertärer Sozialist“, zugleich weiterhin als Humanist und Befürworter einer Subjekt-Philosophie.
Letzteres hat Bernard-Henri Lévy radikal in Abrede gestellt, und zwar in seinem 667 Seiten umfassenden Werk Le Siècle de Sartre (‚Das Jahrhundert Sartres‘) aus dem Jahr 2000. Seine Begründung halte ich allerdings für teilweise fadenscheinig und misslungen, so wenn er ein-fach behauptet, Sartres Existenzialismus sei ein „Anti-Humanismus“. In jedem Humanum ge-be es auch Inhumanes, so dass das Humane keinen Bestand haben könne („ne tient pas compte“, a.a.O. S. 240). Genau dies berücksichtigen jedoch Sartre und Beauvoir immer wie-der; für beide gibt es kein Leben ohne Scheitern, ohne Misserfolge, durch die man sich aber niemals entmutigen lassen dürfe (s.o.). Dagegen gibt Lévy zu bedenken, dass man doch im 2. Weltkrieg „la perte totale de toute dignité humaine“ (den totalen Verlust jeglicher Menschen-würde) erlebt habe. – So, als wenn Krieg keine Ausnahmesituation, sondern eine Bedingung der Möglichkeit von Humanität wäre!“ – Zudem erklärt Lévy, kein „Projekt“ der Menschen beinhalte eine „Essenz“ – so als ob Wesens-Merkmale des Humanen nicht feststellbar wären. Außerdem sei Sartres Subjekt-Theorie hinfällig. (Dies wahrscheinlich unter dem schädlichen Einfluss von Foucault, Althusser und den Strukturalisten, die ständig den „Tod des Subjekts“ herbeireden wollten.)
Dagegen ist die Essenz in der Subjekt-Theorie Sartres und Beauvoirs deutlich erkennbar: Ausgehend von Descartes‘ Cogito betonen sie die Fähigkeit jedes Individuums, eigenständig immer wieder neue dialektische Subjekt-Objekt-Beziehungen herauszufinden und zu be-schreiben, und zwar in völliger persönlicher Freiheit. – Dagegen behauptet Lévy, Sartre ver-rate sich selbst, indem dieser darauf hinweise, dass jedes Subjekt immer „etwas“ zum Gegen-stand habe. Im Meer dieser „Etwas“ versinke das Subjekt, erklärt Lévy. – Nein, das Gegenteil ist der Fall! Das Subjekt bezieht sich in der Tat stets auf „etwas“, definiert sich aber nicht durch diesen Vorgang. Substanz des Subjekts ist bei Sartre und Beauvoir nämlich nicht „das Etwas“, sondern die Freiheit, die sie nicht nur der Einzelperson, sondern allen Menschen zubilligen.
Mit der Kritik der dialektischen Vernunft von 1960 will Sartre dieses Konzept in den Marxis-mus integrieren, erkennt aber schon bald, dass dies missverstanden wird, nämlich als Partei-nahme für den z.B. in der UdSSR und in China herrschenden autokratisch-bürokratischen Marxismus-Bolschewismus; zumal auch Sartres Konzept einer „revolutionären Avant-Garde“ als Befürwortung des Leninismus verstanden wurde. Schon nach dem brutal niedergeschlage-nen Ungarn-Aufstand von 1956 kann aber davon bei Sartre keine Rede mehr sein. Erst recht führt Sartres aktive Teilnahme an der Mai-Revolte 1968 ihn dazu, die Forderung nach Freiheit und Befreiung nicht nur vom Kapitalismus, sondern auch vom Bolschewismus zu erheben. Konsequenterweise bekennt Sartre sich spätestens seit 1972 als „Marxianer“ und „freiheitli-cher Sozialist“ (‚socialiste libertaire‘), wohl wissend, dass er sich damit dem Anarchismus an-nähert (zumal die Konnotation ‚anarchisch‘ im französischen ‚libertaire‘ mitschwingt). Einer anarchistischen politischen Bewegung haben sich Sartre und Beauvoir jedoch nie angeschlos-sen. Sie verstehen ‚Anarchie‘ im ursprünglichen Sinne, nämlich als Herrschaftsfreiheit. Uner-träglich ist für sie, von anderen Menschen beherrscht und befehligt zu werden. Herrschaft von Menschen über Menschen – wie sie sowohl im Kapitalismus als auch im Bolschewismus üb-lich ist – lehnen sie generell ab. Sie wollen „Marxianer“, nicht aber „Marxisten“ (wie in der UdSSR und in China) sein und bekräftigen daher das Marxsche Fernziel eines Reichs der Freiheit mit einer „freien Assoziation freier Individuen“, durch die endlich jegliche Ausbeu-tung und Unterdrückung beendet würde – und natürlich auch der Marxsche Determinismus, der sich auf die andauernde Vorgeschichte der Menschheit bezieht, in der letztlich alles noch durch die gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnisse bestimmt wird.
Und doch bleibt an Sartres und Beauvoirs Konzepten noch Einiges zu bemängeln. Zunächst hinsichtlich der Tatsache, dass sie immer wieder herausragende Theoretiker wie Descartes, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Lenin und Heidegger zitieren, ohne deren offensichtliche Irr-tümer zu erwähnen. Sie ignorieren z.B.,
- dass Descartes seinen Subjekt-Begriff einseitig auf das Cogito, als das denkende Ich, gründet, d.h. ohne die körperlichen und seelischen Determinanten zu berücksichtigen;
dass er zudem die Zirbeldrüse als „Schnittstelle“ zwischen Geist und Körper annimmt,
- dass Kant seinen Freiheitsbegriff theologisch zu begründen versucht, während das Ding-an-sich gänzlich und der Kategorische Imperativ größtenteils hinfällig sind,
- dass Hegel in unzulässiger Weise Glauben und Wissen vermengt und sich zu unhalt-baren Konstrukten wie dem „Absoluten Wissen“, dem „Absoluten Geist“ und der „List der Vernunft“ versteigt,
- dass Marx zwischen Determinismus und Selbstbestimmung schwankt und seine Auf-fassung von der „Diktatur des Proletariats“ im Unklaren lässt,
- dass Nietzsches Kritik an Kant und dem Christentum unhaltbar ist und sein Menschen-bild dem Faschismus Tor und Tür öffnet,
- dass Lenin machiavellistisch denkt und handelt, wobei es ihm an Rechts- und Demokratie-Bewusstsein mangelt,
- dass Heidegger überzeugter Nazi war und mit seinem Subjektivismus das Sein nicht zu erklären vermochte.
Befremdlich ist auch, dass Sartre und Beauvoir – wohl im Bewusstsein der eigenen völligen Freiheit als Schriftsteller und Künstler – die Freiheit verabsolutieren, nicht jedoch beachten, dass a) die Willensfreiheit zwar angeboren ist, in ihrer Entwicklung jedoch von dem Umgang der Kinder und Jugendlichen mit ihren Bezugspersonen abhängt, und b) dass sie auf der Klassen-Herrschaft beruhende Hauptgründe der Unfreiheit nicht berücksichtigen, sich aber darüber wundern, dass viele ihrer Mitmenschen angeblich von ihrer Freiheit „keinen Ge-brauch“ machen.
Die Verabsolutierung der Freiheit schlägt sich auch in Sartres und Beauvoirs Atheismus nieder: Gäbe es Gott, so meinen sie, ginge jegliche menschliche Freiheit verloren. Dabei über-sehen sie jedoch, dass sich weder die Existenz noch die Nicht-Existenz Gottes beweisen lässt und die Freiheit auch als Geschenk Gottes verstanden werden kann.
In Sartres und Beauvoirs Begriffen von Subjekt und Humanismus fehlen die unentbehrlichen naturalistischen Komponenten, die bei Marx und auch in Ernst Blochs Natur-Allianztechnik vorhanden sind. Sartre zog (wohl unter dem Einfluss von Baudelaire) auch im Alltag das Künstliche dem Natürlichen vor – was wahrscheinlich zu seinen gravierenden gesundheit-lichen Problemen beigetragen hat. In ähnlicher Weise leugnete Beauvoir jeglichen natürlichen bzw. biologischen Determinismus, so vor allem in ihrem Feminismus (‚Le deuxième sexe‘).
Spezielle Sartre-Kritik
Alles Sein geht ins Nichts. Der Tod besiegt das Leben. Diesem Schicksal kann unser Kosmos nicht entgehen, behaupten einige Kosmologen. Ist das auch der Kern der Botschaft Sartres? Vielleicht sogar der seiner Werte-Welt – in konsequenter Negation? Und warum schätzt er dann den Wert-Begriff selbst so hoch ein, identifiziert ihn mit dem „An-sich-Für-sich“ und sogar mit der absoluten Freiheit? Fragen über Fragen!
Um sie zu klären, reicht vielleicht eine „kleine“ Kritik nicht aus, bedarf es womöglich einer Großen Kritik, die sich nicht nur mit Sartres philosophischem und politischem Engagement, sondern mit seiner Gesamt-Person und -Persönlichkeit – einschließlich des umfangreichen literarischen Oeuvres – auseinandersetzt, was leider auf engem Raum nicht möglich ist.
Sartre selbst hat sich zu seinen Werken oft selbstkritisch geäußert. Gegen Ende seines Lebens versteigt er sich sogar zu der Bemerkung, seine ganze Philosophie tauge nichts, man müsse ganz neu anfangen (vgl. Lévy a.a.O. S. 301) … Nachdem er zuvor immer wieder betont hatte, er stehe zu allen seinen Schriften, auch wenn er sie nicht (mehr) „gut“ finde. Literatur könne jedenfalls stets als „kritischer Spiegel“ dienen: „Aufzeigen, nachweisen, darstellen“, darin bestehe das Engagement des Schriftstellers.27 Im Übrigen sei Schreiben ein Bedürfnis für jedermann. Es sei sogar die „höchste Form des Kommunikationsbedürfnisses“. Und dies sei die einzige Überzeugung, an der er hinsichtlich der Literatur unbedingt festhalte (a.a.O. S. 28).
Unbestreitbar scheint, dass Sartre auch und gerade mit seinen literarischen Werken eine große Breitenwirkung erzielt hat, auch wenn der philosophische Gehalt dieser Werke sich kaum von seinen philosophischen und politischen Arbeiten unterscheidet. Mit anderen Worten: Auch ohne kritische Auseinandersetzung mit Sartres literarischem Werk ist es möglich, seine Werte-Horizonte so darzustellen, wie ich es im Vorherigen versucht habe. Unmöglich scheint es mir dagegen, die Fülle der Sekundärliteratur zu Sartres Philosophie – und damit zu seinen Werte-Horizonten – überschaubar zu machen. Daher muss ich mich im Folgenden auf einige grundsätzliche Kritiken beschränken.
In dem bereits erwähnten Brief über den Humanismus kritisiert Heidegger Sartres Existenz-Begriff. Mit seiner Behauptung des Vorrangs der Existenz vor der Essenz bleibe Sartre der „Seinsvergessenheit“ verhaftet, könne nicht zum Sein gelangen. Existenz – ‚existence‘, wie Sartre sie versteht – bedeute: „actualitas, Wirklichkeit im Unterschied zur bloßen Möglichkeit als Idee“ (a.a.O. S. 18). Damit aber könne das wahre Wesen des Menschen („der Mensch im Geschick der Wahrheit“) nicht erfasst werden. Im Gegensatz zu dem, was er, Heidegger, „Ek-sistenz“ nennt, nämlich: „Hinaus-stehen in die Wahrheit des Seins“ (ebd.).
Aber: Heidegger nimmt solches „Hinaus-stehen“ für sich in Anspruch, ohne selbst das Sein erklären zu können. Was wie eine Erhöhung des Menschen hin zur „Wahrheit des Seins“ erscheint, erweist sich als tatsächliche Herabwürdigung des konkreten Subjekt-Seins, zumal Heidegger sich nicht scheut, die Subjektivität sogar im „Volk“ untergehen zu lassen.
Dagegen bleibt Sartre glaubwürdig, wenn er darauf hinweist, dass das Sein „überall“ anzutreffen und Bewusst-Sein immer Bewusstsein von Etwas ist, während das Ich nur zusammen mit dem anderen Menschen bzw. in der Gruppe existiert. – Und wohl auch, wenn er auf größtmögliche Freiheit pocht – nicht nur für das Ich des Für-sich-Seins, sondern damit zugleich für alle Menschen.
Es sollte aber nicht übersehen werden, dass Sartres Freiheitsbegriff keineswegs unum-stritten ist. Fraglich scheint z.B., ob Sartres Freiheit als „absolut“ gelten kann.28 Dagegen stehen – von Sartre selbst herangezogene – Faktoren wie die Freiheit der Anderen, die Situations-Gebundenheit jeglicher Freiheit, die totale Verantwortung und die Entfremdung. In der Entfremdung droht die Freiheit völlig verloren zu gehen.
Massive Kritik an Sartres Freiheitsbegriff üben daher einige marxistische Denker. Herbert Marcuse (1898-1979) behauptet sogar, Sartre hätte in EN gar nicht die Freiheit selbst analysiert, sondern nur die „Vorbedingungen“ für deren Möglichkeit. Denn in der historischen Realität des Kapitalismus sei die Freiheit tatsächlich völlig „entfremdet“, so dass sie nur durch die sozialistische Revolution überhaupt zu erreichen sei. Und Marcuse fährt fort: „Wenn das wahr ist, wenn durch die Organisation der Gesellschaft die Freiheit des Menschen in solchem Ausmaße entfremdet werden kann, daß sie fast zu existieren aufhört, dann ist menschliche Freiheit wesentlich nicht durch die Struktur des >Für-sich< bestimmt, sondern durch die spezifischen historischen Kräfte, welche die menschliche Gesellschaft formen.“ (H. Marcuse: Existentialismus, in: Kultur und Gesellschaft 2, Frankfurt a.M. 1965, S. 76.) Was nicht bedeutet, dass damit der Mensch als Subjekt verschwindet, schon gar nicht als revolutionäres Subjekt. Denn schon Marx hatte erkannt, dass der Mensch nicht einfach nur das „Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“ ist und nicht nur das Sein das Bewusstsein bestimmt, sondern – umgekehrt – das Bewusstsein „rückwirkend“ auch die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern vermag.
Problematisch werden solche Einsichten dennoch, wenn ein – auf sozio-ökonomischen Mechanismen beruhendes – angebliches „Sinngesetz“ in den Vordergrund rückt – wie insbesondere bei Lenin und Stalin, zumal in Verbindung mit einer Diktatur über das Proletariat. – Genau hier setzt Sartre allerdings seine – zweifellos berechtigte – Kritik am herkömmlichen Marxismus an, aus der er in CRD seine neuen bzw. erweiterten Freiheits- und Befreiungs-Konzepte entwickelt.
Kritik aus christlicher Sicht hat u.a. Thomas Ebinger vorgetragen, und zwar in seiner Dissertation über Verkehrte Freiheit? (Tübingen 2010). Er referiert die – teilweise durchaus positiven – Würdigungen Sartres, die Theologen wie Karl Barth, Helmut Thielicke, Paul Tillich und Gotthold Hasenhüttl geleistet haben. Luthers Freiheitsbegriff bietet er als Alternative zu demjenigen Sartres an, allerdings nicht in überzeugender Weise. Christlich sei die „Freiheit, die ihre Angst vor dem Handeln und der Verantwortung … verlässlich überwindet und im Vertrauen auf die göttliche Freiheit und Souveränität die Welt mitgestaltet“ (a.a.O. S. 190). – Auf die damit verbundenen Kontroversen näher einzugehen, ist mit leider aus Platzgründen nicht möglich.
Kritik an Sartres „Korrektur des Marxismus“
Sartres kritische Bejahung des Marxismus hat ihm nicht nur Camus übelgenommen. Der „Neue Philosoph“ Bernard-Henri Lévy hält diese Bejahung für letztlich unerklärlich. Wohin-gegen klar sei, dass der Marxismus selbst eine „Illusion“ sei, eine äußerst blutige obendrein. Denn: „Stalin war in Lenin, Lenin war in Marx.“ (a.a.O. S. 476) Nicht als eine Doktrin der Befreiung, sondern der Unterwerfung und Unterdrückung sei der Marxismus anzusehen. Womit Lévy natürlich auch Sartres Einsatz für den Marxismus – zumindest indirekt – in Grund und Boden verdammt.
Aber: Lévy macht es sich zu einfach, wenn er eine direkte Schuld-Linie von Marx zu Lenin und Stalin postuliert. Wie kompliziert die historischen Verhältnisse, die zum Abgleiten des Leninismus in den Staatsterror geführt haben, tatsächlich waren, habe ich andernorts bereits angedeutet.29 Vonnöten gewesen wäre eine gründliche Auseinandersetzung mit der Marxschen Theorie, die Lévy uns – und vor allem Sartre – schuldig geblieben ist.
Anders steht es mit Lévys Analysen von Sartres Dialektik -Begriff, den der Kritiker als „neu“, aber „bizarr“ empfindet. Im Unterschied zu Hegels Dreischritt präsentiere Sartre eine „zweitaktige“ Dialektik. A und B vereinigen sich bei Sartre nicht zu C, sondern verharren in der Opposition A gegen B.30 Zwar könne dabei höhere Komplexität entstehen, in geschicht-lichen Abläufen jedoch keinerlei Versöhnung in einem harmonischen Dritten, ganz Neuen. Aus der beklemmenden Dauer-Opposition von A gegen B könne Sartre nicht ausbrechen, zumal er den unversöhnlichen Gegensatz von Gut und Böse für unaufhebbar hält. Dadurch werde das Subjekt für immer in einer „schlechten Unendlichkeit“ eingesperrt, die Hegel nur als Durchgangsstadium zugelassen hatte (Lévy a.a.O. 354 f.).
Aber: Was Lévy hier außer Acht lässt, ist die Tatsache, dass Sartre in der Dialektik im Wesentlichen eine Denkfigur sieht, die es ermöglicht, immer wieder Ganzheiten zu ihren Teilaspekten in Beziehung zu setzen (was Sartre 1972 in einem Interview kurz und bündig erläutert hat, in: Was kann Literatur? a.a.O. S. 117 f.). Diese Denkfigur wirkt befreiend, weil sie tiefer blicken lässt als jede bloß positivistische Analyse.
Ähnlich negativ wie Lévy beurteilt Klaus Hartmann Sartres Rückgriff auf den Marxismus, wenn auch mit weiter ausholender philosophischer Begründung, und zwar folgendermaßen:
Marx übernimmt von Hegel die Idee einer Sinngebung für das Ganze der Geschichte, erkennt den Träger dieser Sinngebung aber nicht im Denken (geschweige denn im „Absoluten Geist“), sondern in der Arbeit und, darauf fußend, im antikapitalistischen Klassenkampf, der – ökonomisch bedingt – unweigerlich zum Ziel einer klassenlosen Gesellschaft führe. Hartmann nennt diese Denk-Bewegung auch das Marxsche „Sinngesetz“. Diesem liege jedoch ein schwerwiegendes Missverständnis der hegelschen Philosophie zu Grunde. Hegel habe die Arbeit als Prozess der Selbsterzeugung gedeutet, der jedoch nicht beim Menschen Halt macht, sondern vom Absoluten zum Absoluten führt. Marx dagegen habe dieses Konzept anthropo-logisch um- und fehlgedeutet, indem er ausgehe vom „Menschen mit seinen Bedürfnissen, Wesenskräften und seiner Bezogenheit auf eine reale Natur“ (HS 42).
Sartre setze hier an, um die Marxsche Theorie zu „korrigieren“. Denn wenn es wirklich um den Menschen gehe, dürften nicht wirtschaftliche Faktoren als die eigentlichen Urheber der Geschichte gelten, sondern „die Einzelnen“, die „in ihrer Bedeutung für den Prozeß berück-sichtigt werden“ müssten (a.a.O. 45). – Das Ergebnis dieser Korrektur sei dennoch katastro-phal, sagt K. Hartmann, nämlich eine Rechtfertigung der skrupellosen Gewalt des Leninis-mus. Sartres Gruppen-Konzept laufe genau hierauf hinaus, nämlich auf „Unfreiheit für die Vielen in einer Gestalt der Freiheit als herrschende Gruppe“ (a.a.O. 196). –
Diese Vorstellung Sartres sei „von Zynismus geprägt“ (ebd.), und zwar im Unterschied zu Marx, der ja auch eine demokratisch-parlamentarisch bewirkte Umwälzung der Gesellschaft für möglich gehalten hatte. Dagegen sei Sartres Auffassung nicht nur zynisch, sondern auch „ideologisch“, weil sie „keine Vermittlung von Existenzen, keine Reflexion auf Pluralität und auch keine Ganzheitskonzeption als geistige Einheit – Intersubjektivität, Recht, Staat“ leisten könne. An die Stelle des Rechts setze Sartre „Aktion und Aktionsverhältnisse“ (a.a.O. 198). – Zynismus, Unfreiheit, Rechtlosigkeit, Rechtfertigung von Gewaltherrschaft – das sind äußerst schwerwiegende Vorwürfe zumal angesichts der Sartreschen Dialektik des ständigen Gegensatzes, die, wie Hartmann betont, schon in EN vorgeformt ist.
Meines Erachtens läuft jedoch Sartres Gruppen-Konzept nicht zwangsläufig auf solche Horror-Szenarien hinaus. Sartre hofft ja gerade auf die Befreiung aller Menschen, z.B. durch Basisdemokratie. Staatliche Drangsalierungen, Behinderungen und Beschränkungen der Freiheit sollen durch demokratische Beschluss-Gremien beendet werden. Diese Gremien sollen gerade nicht durch eine „herrschende Gruppe“ kontrolliert werden. Sartre will nicht „Unfreiheit für die Vielen“, sondern allenthalben freie Menschen, die ihr freies Handeln gemeinsam verantworten. –
Zur angeblichen Fehldeutung Hegels durch Marx: Klaus Hartmann erwähnt überhaupt nicht die religiöse, unwissenschaftliche Grundlage der Hegelschen Geschichtsphilosophie. Ideologisch und unwissenschaftlich ist Hegels Annahme, Arbeit und Geschichte seien nicht vornehmlich Leistungen der Menschen, sondern Gestalten des Absoluten. Marx hat dies durchschaut, K. Hartmann will es anscheinend nicht wahrhaben.
Unerkannte Mängel?
Nichtsdestoweniger halte ich es für geboten, bestimmte Mängel der Theorien Sartres herauszustellen, die von den Kritikern anscheinend nicht oder nur unzureichend berücksichtigt worden sind:
1. Sartre erkennt offenbar nicht, dass es in der Evolutionsgeschichte – trotz oder sogar wegen des „Bösen“ – bei den Lebewesen durch organisierte Kooperation positive Synthesen, d..h. wirkliche Fortschritte, Weiter- und Höherentwicklung, gegeben hat. An Hand einer bloß zweigliedrigen Dialektik (A ständig gegen B) lassen diese positiven Entwicklungen sich nicht erklären.
2. Lebewesen sind zu solcher Kooperation u.a. deswegen fähig, weil sie über Einfühlungs-vermögen (Empathie) und Mitgefühl verfügen. (Von Spiegel-Neuronen der Empathie konnte Sartre noch nichts wissen, wohl aber von Einfühlung und Mitgefühl!) Feststeht: Wo Empathie herrscht, kann dafür gesorgt werden, dass das – zweifellos existierende – Böse nicht Über-hand nimmt, dass der Andere nicht einfach objektiviert, sondern in seinem Person-Sein grundsätzlich anerkannt wird, auch wenn hierfür keine Motivation durch Gruppen- oder Einzel-Interessen vorliegt. Demgemäß erscheint auch Sartres Haltung zur Liebe und zur Sexualität als einseitig negativ und daher unangemessen.
3. Wer Mitgefühl kennt und aktiv praktiziert, nimmt den Mitmenschen in seiner Gesamt-heit wahr, d.h. nicht nur als geistig-seelisches Wesen, sondern auch als Teil der Natur. Das „An-sich“ der Natur gestaltet sich in der menschlichen Person immer schon als „An-und-für-sich“, als Einheit von Natur, Leib, Seele und Geist. Diese Einheit verbindet den Menschen mit sich und mit Seinesgleichen. Und leider ist auch dies ein Aspekt, den Sartre vernachlässigt hat.
Und damit genug der Kritik. Dass Sartres Leistungen und Verdienste nach wie vor Anerkennung verdienen, ist unbestreitbar. Für welche hohen Werte er, Simone de Beauvoir und ihre Mitstreiterinnen und -streiter sich kämpferisch eingesetzt haben, sollte klar gewor-den sein.31
---
Literaturverzeichnis
Bauer, Joachim 2019: Wie wir werden, wer wir sind. Die Entstehung des menschlichen Selbst durch Resonanz, München
Beauvoir, Simone de 1947: Pour und morale de l‘ambiguïté, Paris
Beauvoir, Simone de 1960: La force de l’âge, Paris
Betschart, Alfred: Radikaler Sozialist oder Radikalsozialist? http:/www.sartre.ch/Radikalsozialist.pdf
Betschart, Alfred: Sartre und die Sowjetunion, in: www.sartre.ch/Sartre-SSSR.pdf
Betschart, Alfred: Sartres Weg vom Marxisten zum Anarchisten, https://sartre.ch/marxanar3
Dorando, Juan Michelini 1981: Der Andere in der Dialektik der Freiheit. Eine Unter-suchung zur Philosophie Jean-Paul Sartres, Frankfurt a.M.
Habermann, Ernst 1996: Evolution und Ethik. Skeptische Gedanken eines Ethik-Kommissars, in: www.geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2013/9705/pdf/GU1996_S?9_38...
Hartmann, Klaus 1966: Sartres Sozialphilosophie, Berlin
Kiefer, Markus 2015, in: Studie: Unser Wille ist freier als gedacht (2015), https://www.derstandard.at/story/2000011387060/studie-unser-wille…
Lévy, Bernard-Henri 2000: Le Siècle de Sartre, Paris
Libet, Benjamin 2005: Mind Time. Wie das Gehirn Bewusstsein produziert, Frankfurt a.M.
Lütkehaus, Ludger 1999: Nichts. Abschied vom Sein. Ende der Angst; Zürich
Mares, Detlev: Der Bruch zwischen Sartre und Camus, in: http://www.holtmann-mares.de/Bruch.htm (Erstveröffentlichung in: ‚französisch heute‘ 26, 1995, S. 38-51)
Moser, Susanne: Freiheit und Anerkennung bei Simone de Beauvoir, https://www.moser.iaf.ac.at/down/Moser-Beauvoir%20Freiheit%20und%20Anerkennung.pdf
Münster, Arno: Jean-Paul Sartre und die Verantwortung des Intellektuellen in der Gesellschaft, https://www.praxisphilosophie.de/muenster_uebergang.pdf
Provost, Mickaëlle: Simone de Beauvoir: Le marxisme à l’épreuve de l’expérience vécue, journals.openedition.org› alter› pdf
Robra, Klaus o.J.: Sartre oder Camus? „Mittelmeerisches“ und „nordisches“ Denken um Existenzialismus, Ökologie und Sozialismus, München, https://www.grin.com/document/ 1014596
Robra, Klaus 2019: Künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen der Menschheit?, München, https://www.grin.com/document/454629
Robra, Klaus o.J. (2020): Ethik der Verhaltenssteuerung. Eine Neubegründung, München, https://www.grin.com/document/923015
Robra, Klaus o.J. (2021): Sind die Diktatur des Proletariats und die Bürokratie das Ende des Sozialismus? Die Frage nach Auswegen aus den Sackgassen, München, https://www.grin.com/document/1032082
Robra, Klaus 2022: Das „verkommene“ Subjekt. Hypokeimenon, Cogito, Übermensch? Grundlegung einer Subjekt-Objekt-Philosophie, München, https://www.grin.com/document/1183185
Robra, Klaus 2023: Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Menschheit. Möglichkeiten und Gefahren, München, https://www.grin.com/document/1383067
Robra, Klaus 2024: Was ist der Mensch im KI-Zeitalter? Philosophische Anthropologie im 21. Jahrhundert, München, https://www.grin.com/document/1525673
Sartre, Jean-Paul 1943: L’Etre et le Néant, Paris
Sartre, Jean-Paul: Ist der Existentialismus ein Humanismus?, in: Drei Essays, Berlin 1964
Sartre, Jean-Paul: Materialismus und Revolution, in: Drei Essays, Berlin 1964
Sartre, Jean-Paul 1960: Critique de la raison dialectique, Paris
Sartre, Jean-Paul 1979: Was kann Literatur? Interviews, Reden, Texte 1960-1976, Reinbek
Schulz, Walter 1972: Philosophie in der veränderten Welt, Pfullingen
Seel, Gerhard 1971: Sartres Dialektik, Bonn
[...]
1 In: https://www.grin.com/document/95894, ‚L‘être et le néant’ (Das Sein und das Nichts), Abkürzung: EN.
2 In: https://www.wissen.de/lexikon/sartre-jean-paul
3 J.-P. Sartre: Ist der Existentialismus ein Humanismus?, in: Drei Essays, Berlin 1964, S. 11. Seinen Atheismus hat Sartre gelegentlich relativiert, so in seiner Autobiographie Les mots (‚Die Wörter‘), in der er erklärt, er habe den Atheismus manchmal vielleicht als Spiel aufgefasst, als das Spiel: „wer verliert, gewinnt“.
4 Ich übersetze hier Sartre aus dessen erstem Hauptwerk: L’Etre et le Néant (‚Das Sein und das Nichts‘), Paris 1943, abgekürzt: EN.
5 Dorando, Juan Michelini: Der Andere in der Dialektik der Freiheit. Eine Untersuchung zur Philosophie Jean-Paul Sartres. Frankfurt a.M. 1981, S. 163
6 Vgl. Gerhard Seel: Sartres Dialektik, Bonn 1971, S. 41
7 G. Seel a.a.O. S. 248
8 J.-P. Sartre: Critique de la raison dialectique, Paris 1960, S. 138. Vgl. G. Seel a.a.O. S. 247
9 Vgl. Robra o.J.
10 Vgl. https://www.philosophes.org/philosophes/philosophes-du-xxe-siecle/la-critique-sartrienne-de-la-psychanalyse-freudienne-une-perspective-phenomenologique/
11 In: https://book8.de/skizze-fur-eine-theorie-der-emotionen-1
12 Alfred Betschart, in: http:/www.sartre.ch/Radikalsozialist.pdf, S. 17
13 Bernard-Henri Lévy: Le Siècle de Sartre, Paris 2000
14 Vgl. Alfred Betschart: Sartre und die Sowjetunion, in: www.sartre.ch/Sartre-SSSR.pdf, S. 3
15 Zum Folgenden vgl. A. Betschart: Radikaler Sozialist oder Radikalsozialist? a.a.O. S. 8-14
16 Zitiert von Detlev Mares: Der Bruch zwischen Sartre und Camus, in: http://www.holtmann-mares.de/Bruch.htm, S. 9 (Erstveröffentlichung in: ‚französisch heute‘ 26, 1995, S. 38-51.)
17 In: Arno Münster: Jean-Paul Sartre und die Verantwortung des Intellektuellen in der Gesellschaft, https://www.praxisphilosophie.de/muenster_uebergang.pdf
18 In: Alfred Betschart: Sartres Weg vom Marxisten zum Anarchisten, https://sartre.ch/marxanar3
19 In: https://whoswho.de/bio/simone-de-beauvoir.html#tab_1
20 In: Susanne Moser: Freiheit und Anerkennung bei Simone de Beauvoir, https://www.moser.iaf.ac.at/down/Moser-Beauvoir%20Freiheit%20und%20Anerkennung.pdf
21 Beauvoir in: Mickaëlle Provost: Simone de Beauvoir: Le marxisme à l’épreuve de l’expérience vécue, journals.openedition.org› alter› pdf
22 Ernst Habermann: Evolution und Ethik. Skeptische Gedanken eines Ethik-Kommissars (1996), in: www.geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2013/9705/pdf/GU1996_S?9_38..., S. 31. Hervorhebungen durch mich. Vgl. Robra 2022.
23 Robra 2024, S. 37 ff.
24 Näheres hierzu in: Robra o.J. (2020), S. 3 ff.
25 In: Robra a.a.O. S. 305, 308
26 Näheres zur KI: Robra 2019 bzw. 2024
27 Jean-Paul Sartre: Was kann Literatur? Interviews, Reden, Texte 1960-1976, Reinbek 1979, S. 23
28 Vgl. Walter Schulz: Philosophie in der veränderten Welt, Pfullingen 1972, S. 302 ff.
29 In: Robra o.J. (2021) S. 25 ff.
30 Eine Erstarrung, die u.a. durch die von Gotthard Günther vorgeschlagene Unterscheidung zwischen totaler und partieller Negation vermieden werden kann. (G. Günther: Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik, 2. Band, Hamburg 1979, S. IX ff.)
31 Vgl. Robra o.J.
- Quote paper
- Klaus Robra (Author), 2025, Existenzialismus oder Marxismus? Zu den Freiheitsbegriffen von Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1593874