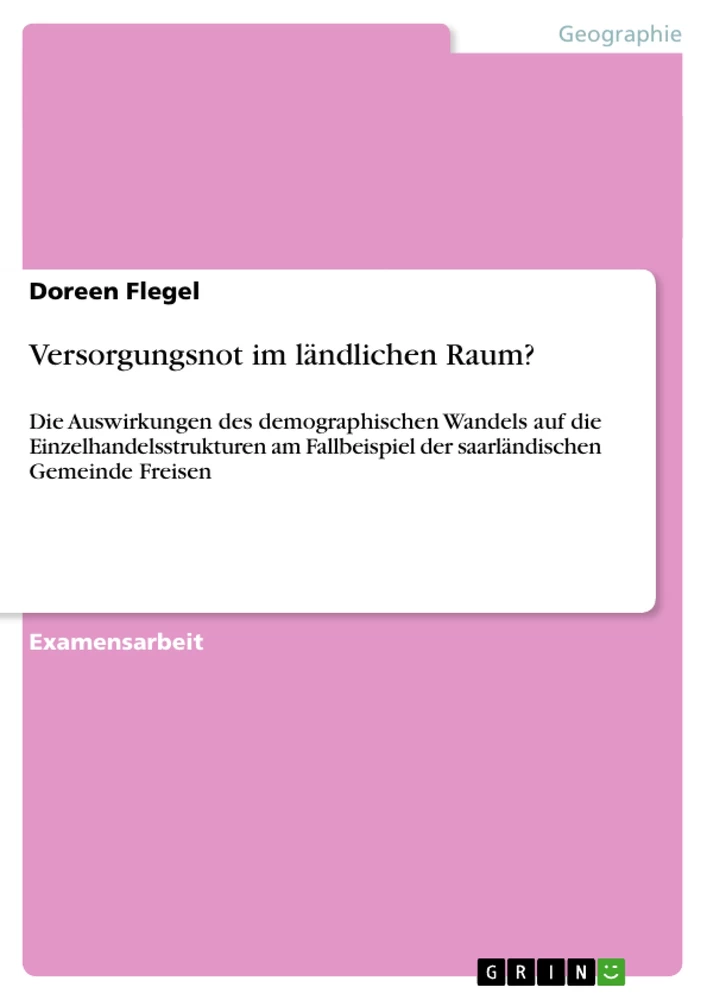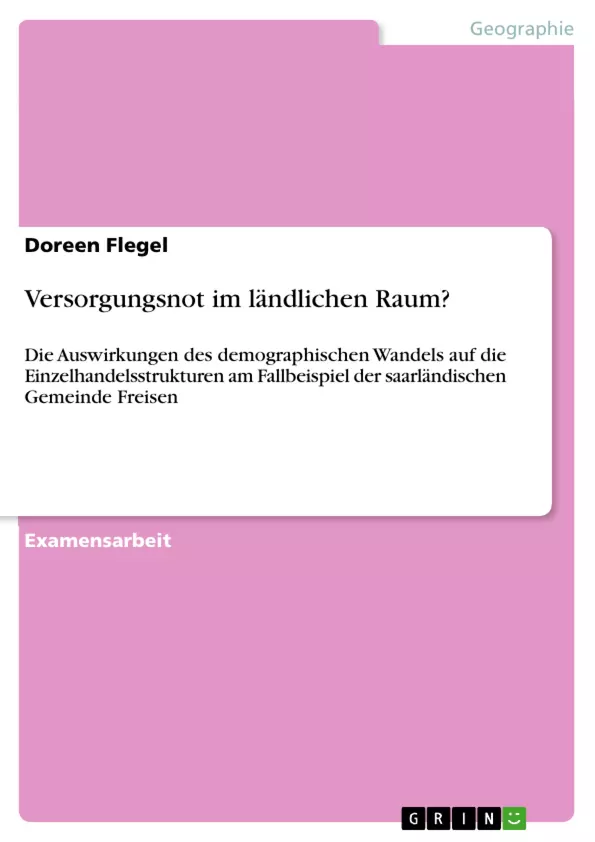„Wie und wo werden wir in Zukunft leben? […] (Wie wird unser Arbeitsalltag sein) und mit welchem Einkommen werden wir unser Dasein finanzieren? Wie werden unsere Schulen aussehen und wie wird sich das Zusammenleben mit den aus dem Ausland zugewanderten Menschen entwickeln? Welche Lasten haben unsere Kinder zu tragen?“ (KRÖHNERT et al. 2007, S. 19) Diese Fragen sind eng mit den Hauptthemen des demographischen Wandels verknüpft. Defizitäre Geburtenzahlen bewirken einen massiven Rückgang junger Menschen; ein Anstieg der Lebenserwartung und die folgende demographische und gesellschaftliche Alterung führt zu einer Umkehrung der Bevölkerungspyramide: Diese Grafik steht im wahrsten Sinne auf dem Kopf. Ein schmaler Sockel, der durch fehlende Kinderzahlen bedingt ist, wird einer immer breiter werdenden Spitze aus älteren Menschen gegenübergestellt. Auch Migrantenströme können diese Entwicklungstrends nicht mehr verhindern, sondern lediglich abmildern.
Zudem werden Zuwanderer aus anderen Ländern der Erde überwiegend durch
Agglomerations- und Verdichtungsräume angezogen, die aufgrund ihrer hohen Bevölkerungsdichte und der damit einhergehenden Unternehmensansiedlung ein reichhaltiges Arbeitsangebot bereit halten.
Beispielhaft sind hier die Städte und Umlandgemeinden des wirtschaftsstarken und auch zukünftig prosperierenden süddeutschen Raumes zu nennen. Eine demographisch und ökonomisch gut funktionierende Gesellschaft ist auf eine altersmäßig durchmischte Bevölkerung angewiesen. Wirtschaft und Bevölkerungsentwicklung bedingen sich gegenseitig und üben gleichermaßen Einfluss aufeinander aus. Demnach bietet eine Region mit einer großen Anzahl junger und qualifizierter Menschen die besten Voraussetzungen unternehmerischen Wirkens. Eine sich daraus ergebende florierende Wirtschaft sorgt für Aufschwung und Wohlstand. Ein demographisch bedingter Geburtenrückgang bewirkt folglich präferierte Unternehmens- und Wirtschaftsstandorte in den bevölkerungsstarken Regionen und führt zwangsläufig zu veränderten
Ausbildungs- und Arbeitsmarktbedingungen (vgl. KRÖHNERT et al. 2007, S. 10). Der demographische Wandel wirkt sich regional ganz differenziert aus, ...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit
- 2. Der demographische Wandel und seine Auswirkungen auf den ländlichen Raum
- 2.1 Bevölkerungsentwicklung in Deutschland von 1950 bis 2050
- 2.1.1 Die Gründe für den langfristigen Rückgang der Bevölkerung
- 2.1.1.1 Die Geburtenrate
- 2.1.1.2 Die Alterung der Bevölkerung
- 2.1.1.3 Die Wanderungsprozesse
- 2.2 Die Auswirkungen des demographischen Wandels
- 2.2.1 Die Folgen für die Erwerbstätigkeit
- 2.2.2 Der demographische Wandel unter dem Wohnungsaspekt
- 2.2.3 Die Folgen innerhalb der Gesundheitsversorgung und des Altensicherungssystems
- 2.2.4 Die Folgen innerhalb des Bildungssektors
- 2.2.5 Die Folgen im Verkehrswesen
- 2.3 Zusammenfassung und zukünftiger Handlungsbedarf
- 3. Die Einzelhandelsentwicklung und Versorgungsstruktur im ländlichen Raum
- 3.1 Die gegenwärtige Versorgungssituation
- 3.2 Ursachen des Strukturwandels im Einzelhandel
- 3.2.1 Die Nachfrageseite
- 3.2.2 Angebotsseite und Wandel der Betriebsformen
- 3.2.3 Die politischen Einflussfaktoren
- 3.3 Folgen für die Versorgungsleistungen
- 3.4 Zusammenfassung der Einzelhandelsentwicklung
- 4. Der demographische Wandel und seine Auswirkungen auf den Einzelhandel in der saarländischen Gemeinde Freisen
- 4.1 Die Struktur der Gemeinde Freisen
- 4.1.1 Geschichtliche Grundlagen
- 4.1.2 Die Landesnatur und -kultur der Gemeinde Freisen
- 4.1.3 Die Gemeinde innerhalb ihrer administrativen Gliederung
- 4.1.4 Die Bevölkerungsentwicklung
- 4.1.5 Bildungsrelevante Einrichtungen
- 4.1.6 Die Siedlungs- und Wohnungsstruktur
- 4.1.7 Die verkehrstechnische Einbindung der Gemeinde und das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung
- 4.1.8 Wirtschaft und Erwerb
- 4.2 Bestandsanalyse der Versorgungsstruktur in der Gemeinde Freisen
- 4.2.1 Erhebungsmethode und Fragebogen
- 4.2.2 Stationäre Konzepte
- 4.2.2.1 Einzelhandelsunternehmen vor Ort
- 4.2.2.2 Die Direktvermarktung
- 4.2.3 Mobile Konzepte
- 4.2.3.1 Mobile Händler in der Freisener Gemeinde
- 4.2.3.2 Flexibler ÖPNV durch bedarfsorientierte Bedienung
- 4.2.4 Zusammenfassende Darstellung der Versorgungsmöglichkeit mit Gütern des täglichen Bedarfs in der Gemeinde Freisen
- 4.3 Handlungsfelder und zukünftige Lösungskonzepte der Gemeinde Freisen
- 4.3.1 Handlungsfelder im Einzelhandelsbereich
- 4.3.2 'Mehr Dorf schaffen für weniger Menschen' – Das MELanIE-Projekt
- 4.3.3 Begegnungsstätte für Jung und Alt: Das Mehrgenerationenhaus
- 4.3.4 Familien stärken und das Gemeindewesen fördern – Der Generationentreff 'Hand-in-Hand'
- 4.3.5 Internetkurse
- 4.3.6 Stärkung der Dorfgemeinschaft durch Vereinstätigkeit
- 4.3.7 Das Konzept der Freisener Achatwege
- 4.3.8 Thermische Sonnenkollektoren
- Analyse der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland und den daraus resultierenden Herausforderungen für den ländlichen Raum
- Untersuchung des Strukturwandels im Einzelhandel und der Folgen für die Versorgungsleistungen
- Bewertung der Versorgungssituation in der Gemeinde Freisen und der Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Einzelhandelslandschaft
- Entwicklung von Handlungsfeldern und Lösungskonzepten für die Gemeinde Freisen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Lebensqualität im ländlichen Raum zu erhalten
- Analyse des Einflusses von Mobilität und Infrastruktur auf die Versorgungsstruktur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Einzelhandelsstrukturen im ländlichen Raum, am Beispiel der saarländischen Gemeinde Freisen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit. Es wird die Relevanz des demographischen Wandels für den ländlichen Raum und insbesondere für die Einzelhandelslandschaft beleuchtet. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland und den Auswirkungen des demographischen Wandels auf verschiedene Lebensbereiche, wie z.B. Erwerbstätigkeit, Wohnen, Gesundheitsversorgung, Bildung und Verkehr.
Das dritte Kapitel untersucht den Strukturwandel im Einzelhandel und beleuchtet die Ursachen, die Folgen für die Versorgungsleistungen sowie die Auswirkungen auf die Versorgungsstruktur im ländlichen Raum. Im vierten Kapitel wird die Gemeinde Freisen im Saarland als Fallbeispiel herangezogen. Hierbei werden die Bevölkerungsentwicklung, die Siedlungsstruktur, die Wirtschaft und die aktuelle Versorgungssituation analysiert.
Das Kapitel endet mit der Erörterung von Handlungsfeldern und zukünftigen Lösungskonzepten für die Gemeinde Freisen, um den Herausforderungen des demographischen Wandels zu begegnen und die Lebensqualität im ländlichen Raum zu erhalten.
Schlüsselwörter
Demographischer Wandel, ländlicher Raum, Einzelhandel, Versorgungssicherheit, Freisen, Saarland, Strukturwandel, Bevölkerungsentwicklung, Mobilität, Infrastruktur, Handlungsfelder, Lösungskonzepte.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich der demographische Wandel auf den ländlichen Raum aus?
Durch Geburtenrückgang und Abwanderung sinkt die Bevölkerungszahl, was zu Leerständen und einer Verschlechterung der Infrastruktur führt.
Warum ist die Nahversorgung im Dorf gefährdet?
Ein Strukturwandel im Einzelhandel hin zu großen Flächen auf der „grünen Wiese“ und sinkende Kaufkraft vor Ort machen kleine Dorfläden oft unrentabel.
Was ist das MELanIE-Projekt?
Ein Projekt unter dem Motto „Mehr Dorf schaffen für weniger Menschen“, das Konzepte zur Anpassung der Lebensqualität bei schrumpfender Bevölkerung entwickelt.
Welche Rolle spielen mobile Händler in Gemeinden wie Freisen?
Mobile Konzepte dienen als wichtige Ergänzung zur stationären Versorgung, um insbesondere weniger mobilen älteren Menschen den Zugang zu Gütern des täglichen Bedarfs zu ermöglichen.
Wie kann die Dorfgemeinschaft gestärkt werden?
Durch Mehrgenerationenhäuser, Vereinstätigkeit und Projekte wie den Generationentreff „Hand-in-Hand“.
- Quote paper
- Doreen Flegel (Author), 2009, Versorgungsnot im ländlichen Raum?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159573