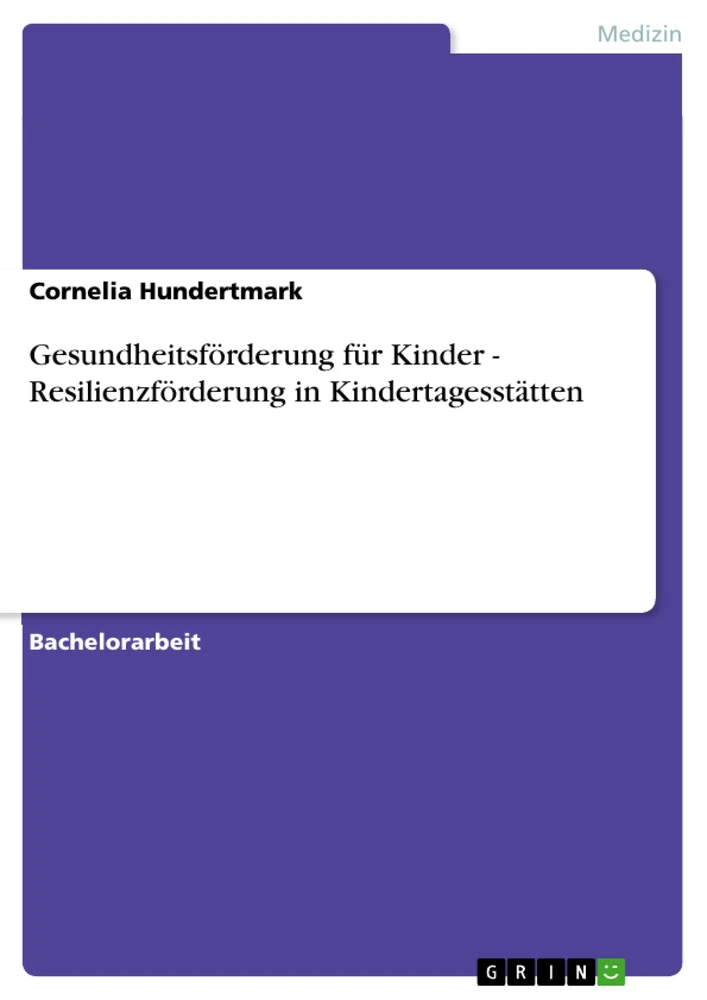Soziale Benachteiligung stellt für Kinder eine psychosoziale Belastung dar, die sich nachhaltig auf ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit auswirkt (Lampert, Schenk& Stolzenberg, 2002).
Das Konzept der Resilienz, dem der salutogenetische, ressourcenorientierte Ansatz zugrunde liegt, beschäftigt sich mit den Bedingungen, die dazu führen, dass sich Menschen trotz widriger Lebensumstände gesund und positiv entwickeln. Durch die Resilienzforschung wurden bereits viele protektive Faktoren identifiziert, die es zu fördern gilt, um Kindern in schwierigen Lebenslagen die Chance auf eine gesunde Entwicklung zu geben (Wustmann, 2004). Da gerade innerhalb der Familien, die einen niedrigen sozioökonomischen Status haben, die Förderung dieser protektiven Faktoren schwierig umzusetzen ist, erscheint die Förderung in Kindertagesstätten sinnvoll, daher gilt es die in dieser Arbeit aufgestellte These:
„Resilienzförderung in Kindertagesstätten- eine Chance für sozial benachteiligte Kinder“ zu überprüfen.
In der vorliegenden Arbeit erwartet den Leser* eine ausführlich Beschreibung des Resilienzkonzepts, in der vor allem auf die Risiko- und Schutzfaktoren, die verschiedenen Modelle der Resilienz und den Forschungsstand im Allgemeinen eingegangen wird, sowie eine Erläuterung der Möglichkeiten der Resilienzförderung in Kindertagesstätten. Dabei wird speziell auf die Schwierigkeiten in der Umsetzbarkeit des Konzepts eingegangen, die sich hauptsächlich auf ein fehlendes Gesamtkonzept zur Resilienzförderung und auf die verbesserungswürdigen Rahmenbedingungen, die in Kindertagesstätten vorherrschen, beziehen. Die Realisierbarkeit der Resilienzförderung in Kindertagesstätten wird also kritisch geprüft. Hierbei wird das Ergebnis erlangt, das Resilienzförderung in Kindertagesstätten, vor allem für sozial benachteiligte Kinder, sehr sinnvoll wäre. Sie stellt eine große Chance dar, so dass dringend daran gearbeitet werden muss, ein ganzheitliches Gesamtkonzept zur Förderung der Resilienz bei Kindern zu entwickeln und die Rahmenbedingungen für die Umsetzbarkeit zu schaffen.
*Zum besseren Textverständnis, wird in der vorliegenden Arbeit ausschließlich in maskuliner Form geschrieben. Selbstverständlich schließt dies immer auch die feminine Form mit ein.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- Situation der Kinder in Deutschland und Auswirkungen sozialer Benachteiligung
- Kindertagesstätte
- Elternarbeit und ihre Schwierigkeiten
- "Starke Eltern- Starke Kinder"
- Das Salutogenetische Modell von Antonovsky
- Generalisierte Widerstandsressourcen
- Definition: Resilienz
- Zu den Zielen und Strategien der Resilienzförderung
- Das Stress- Coping- Modell
- Die "Kauai- Längsschnittstudie"
- Risiko- und Schutzfaktoren
- Personale Ressourcen des Kindes
- Soziale Ressourcen des Kindes
- Resilienzmodelle
- Ansätze der Resilienzförderung in Kindertagesstätten
- Beispiel für die praktische Umsetzung der Resilienzförderung in Kindertagesstätten
- Programm zur Förderung von Resilienz: "I can problem solve"
- Diskussion
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert das Konzept der Resilienz im Kontext von Kindertagesstätten und untersucht dessen Relevanz für die Förderung sozial benachteiligter Kinder. Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung von Resilienzförderung für die Entwicklung von Kindern in schwierigen Lebenslagen zu verdeutlichen und die praktische Umsetzbarkeit des Konzepts in Kindertagesstätten zu beleuchten.
- Das Konzept der Resilienz und dessen salutogenetischer Ansatz
- Risiko- und Schutzfaktoren, die Resilienz beeinflussen
- Resilienzmodelle und ihre Anwendung in der Praxis
- Die Rolle von Kindertagesstätten in der Förderung von Resilienz
- Praktische Ansätze und Programme zur Förderung von Resilienz in Kindertagesstätten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung der Situation von Kindern in Deutschland und den Auswirkungen sozialer Benachteiligung. Anschließend wird die Rolle der Kindertagesstätten und die Bedeutung der Elternarbeit beleuchtet. Im Anschluss wird das salutogenetische Modell von Antonovsky vorgestellt, das die Grundlage für das Konzept der Resilienz bildet. Die Arbeit geht dann auf die Definition von Resilienz und die Ziele sowie Strategien der Resilienzförderung ein. Das Stress-Coping-Modell wird im Zusammenhang mit den Zielen und Strategien der Resilienzförderung erläutert. Die "Kauai- Längsschnittstudie" wird als ein Beispiel für die Forschung zur Resilienz vorgestellt.
Die Arbeit behandelt die Bedeutung der Risiko- und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Resilienz, wobei die personalen und sozialen Ressourcen des Kindes im Detail betrachtet werden. Die Wirkungsmechanismen der Risiko- und Schutzfaktoren werden in verschiedenen Resilienzmodellen dargestellt. Anschließend werden allgemeine Ansätze der Resilienzförderung in Kindertagesstätten vorgestellt und praktische Beispiele für die pädagogische Umsetzung der Resilienzförderung im Setting Kindertagesstätte gegeben. In der Diskussion wird das Konzept der Resilienzförderung kritisch betrachtet und die Umsetzbarkeit im pädagogischen Kontext analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Resilienzförderung, Kindertagesstätten, sozial benachteiligte Kinder, salutogenetischer Ansatz, Risiko- und Schutzfaktoren, Resilienzmodelle, praktische Ansätze zur Förderung von Resilienz.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Resilienz bei Kindern?
Resilienz ist die Fähigkeit von Kindern, sich trotz widriger Lebensumstände und hoher Belastungen gesund und positiv zu entwickeln.
Warum ist Resilienzförderung in Kitas besonders wichtig?
Für sozial benachteiligte Kinder bietet die Kita oft den stabilsten Rahmen, um Schutzfaktoren zu stärken, die im familiären Umfeld fehlen könnten.
Was ist das salutogenetische Modell von Antonovsky?
Ein ressourcenorientierter Ansatz, der fragt, was Menschen gesund hält, anstatt sich nur auf die Ursachen von Krankheiten zu konzentrieren.
Welche Rolle spielen Risiko- und Schutzfaktoren?
Risikofaktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit für Entwicklungsstörungen, während Schutzfaktoren (personale und soziale Ressourcen) diese Risiken abmildern.
Gibt es konkrete Programme zur Förderung?
In der Arbeit wird beispielsweise das Programm "I can problem solve" zur Förderung der Problemlösekompetenz genannt.
- Citation du texte
- Cornelia Hundertmark (Auteur), 2008, Gesundheitsförderung für Kinder - Resilienzförderung in Kindertagesstätten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159675