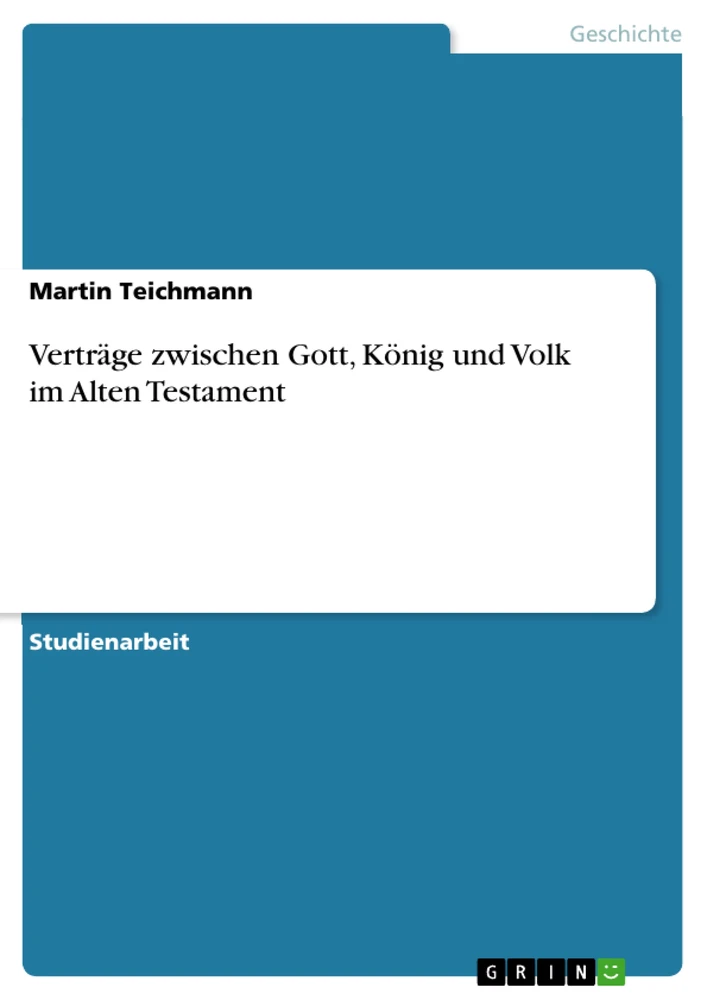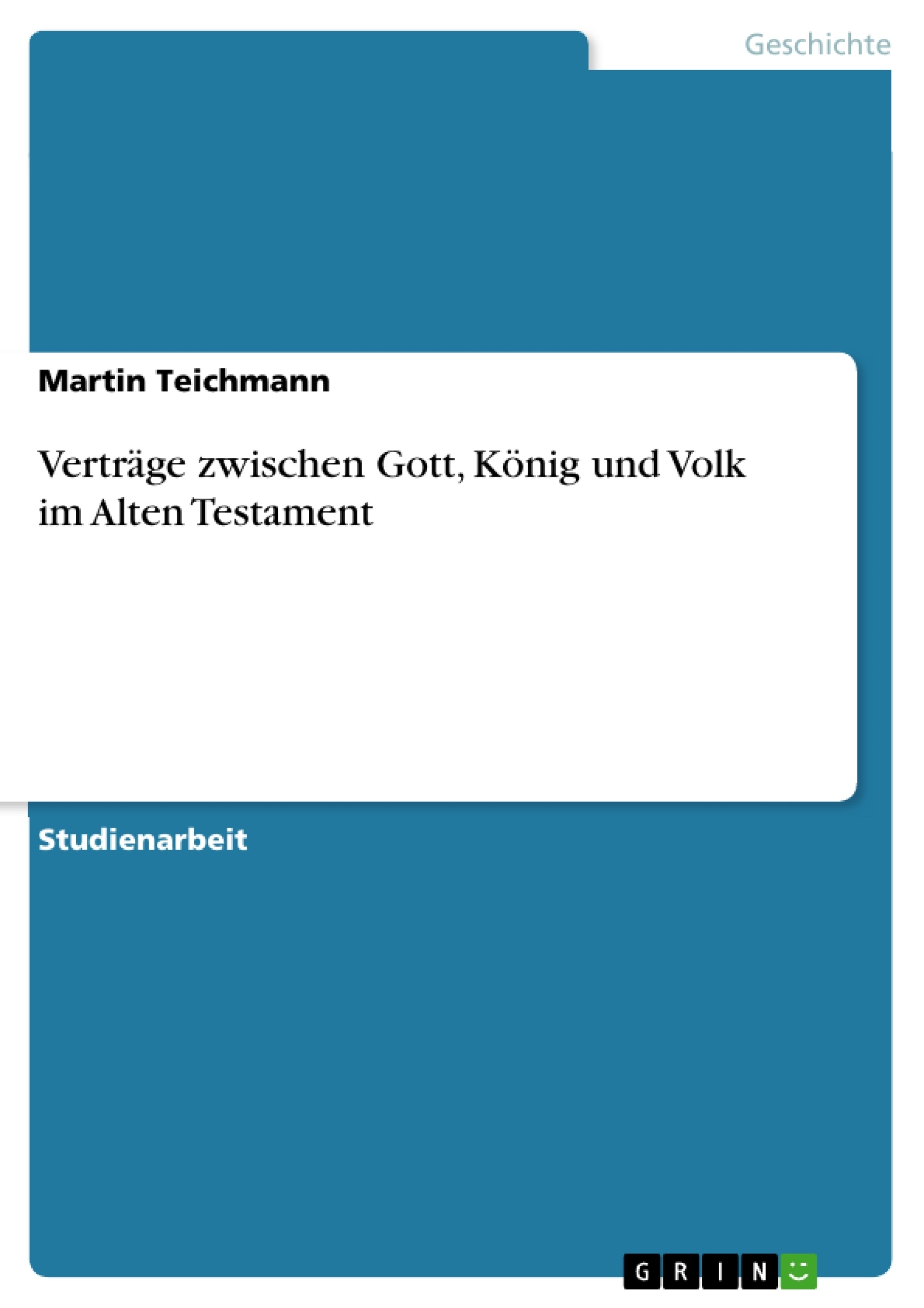In der vorliegenden Arbeit zum Hauptseminar „Herrschaftsverträge im Mittelalter“ möchte ich mich mit dem Thema „Verträge zwischen Gott, König und Volk im Alten Testament“ beschäftigen. Dabei soll versucht werden darzustellen, inwieweit Textstellen im Alten Testament zu finden sind, die vertragsähnliche Formalien aufweisen und folglich auch als eine Art Vertrag angesehen werden können. Um den Bogen zum Hauptseminar zu spannen, möchte ich die alttestamentarischen Verträge - oder zumindest vertragsähnlichen Fragmente - in einen formalen Vergleich zu einem Vertrag aus dem Mittelalter stellen. Es sollen dabei durchaus existierende Parallelen bei den Formalien aufgezeigt werden, obgleich hier doch Vertragsarten verglichen werden, bei denen - zwischen dem Dekalog und einer mittelalterlichen Urkunde - immerhin eine Zeitspanne von über 1500 Jahren liegt
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begrifflichkeiten
- Der Vertrag
- Der Bund
- Bund und Ritus
- Philologische Untersuchungen zum Begriff „Bund“
- Die Vertragsgestalt des Bundes und die deuteronomische Reform
- Formgeschichtlicher Vergleich des Dekalogs an einem hethitischen Vasallenvertrag nach Mendenhall
- Vertragsgeschichtliche Herkunft des alttestamentarischen Bundes
- Kritik an formgeschichtlichen Vergleichen
- Bundeserneuerung und Bundesbestätigung im Alten Testament
- Die verschiedenen Bundesvorstellungen
- Zusammenfassungen über den Stand der theol. Diskussionen
- Vergleich vertragsähnlicher Fragmente
- Entstehungsvorgang einer mittelalterlichen Urkunde
- Form und Aufbau einer mittelalterlichen Urkunde
- Formgeschichtlicher Vergleich
- Fazit
- Abkürzungsverzeichnis
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Textstellen im Alten Testament vertragsähnliche Formalien aufweisen und folglich als Verträge betrachtet werden können. Im Mittelpunkt stehen die Verträge zwischen Gott, König und Volk im Alten Testament. Die Arbeit zieht Parallelen zu einem Vertrag aus dem Mittelalter und untersucht Gemeinsamkeiten in den Formalien, trotz der Zeitspanne von über 1500 Jahren zwischen Dekalog und mittelalterlicher Urkunde.
- Untersuchung der vertragsähnlichen Formalien in Texten des Alten Testaments
- Vergleich der alttestamentarischen Verträge mit einem mittelalterlichen Vertrag
- Analyse von Parallelen und Unterschieden in den Vertragsformen
- Einbezug anderer Elemente mit vertragsähnlicher Gestalt aus dem Alten Testament, wie z.B. Vasallenverträge
- Besonderer Fokus auf die Bedeutung des Begriffs „Bund“ im Alten Testament
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Thema und den Forschungsgegenstand vor, sowie die primären Quellen und die Methodik der Untersuchung.
- Begrifflichkeiten: Definiert die Begriffe „Vertrag“ und „Bund“ im historischen Kontext und beleuchtet die unterschiedlichen Formen und Bedeutungen im Laufe der Geschichte.
- Bund und Ritus: Analysiert die Verbindung von Bund und rituellen Handlungen im Alten Testament.
- Philologische Untersuchungen zum Begriff „Bund“: Beleuchtet den Begriff „Bund“ aus philologischer Sicht und untersucht die verschiedenen Bedeutungsnuancen.
- Die Vertragsgestalt des Bundes und die deuteronomische Reform: Untersucht die Rolle der deuteronomischen Reform für die Vertragsgestalt des Bundes im Alten Testament.
- Formgeschichtlicher Vergleich des Dekalogs an einem hethitischen Vasallenvertrag nach Mendenhall: Vergleicht den Dekalog mit einem hethitischen Vasallenvertrag und untersucht mögliche formgeschichtliche Einflüsse.
- Vertragsgeschichtliche Herkunft des alttestamentarischen Bundes: Beleuchtet die historischen und kulturellen Einflüsse auf die Entstehung des alttestamentarischen Bundes.
- Kritik an formgeschichtlichen Vergleichen: Präsentiert kritische Einwände gegen formgeschichtliche Vergleiche im Kontext des Alten Testaments.
- Bundeserneuerung und Bundesbestätigung im Alten Testament: Analysiert die Rolle von Bundeserneuerungen und Bundesbestätigungen in der alttestamentarischen Geschichte.
- Die verschiedenen Bundesvorstellungen: Stellt die unterschiedlichen Vorstellungen vom Bund im Alten Testament dar.
- Zusammenfassungen über den Stand der theol. Diskussionen: Fasst die wichtigsten Erkenntnisse der theologischen Forschung zum Thema „Bund“ im Alten Testament zusammen.
- Vergleich vertragsähnlicher Fragmente: Vergleicht Fragmente mit vertragsähnlichem Charakter aus dem Alten Testament mit einer mittelalterlichen Urkunde.
Schlüsselwörter
Altes Testament, Bund, Vertrag, Dekalog, Mittelalter, Königsurkunde, Ludwigs des Jüngeren, Gandersheim, Vasallenvertrag, Hethiterreich, formgeschichtliche Vergleich, theologische Diskussion, Vertragsformalien.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es 'Verträge' im Alten Testament?
Die Arbeit zeigt auf, dass viele Textstellen im Alten Testament (wie der Dekalog) vertragsähnliche Formalien aufweisen, die als 'Bund' bezeichnet werden.
Was ist der formgeschichtliche Vergleich nach Mendenhall?
Mendenhall vergleicht den biblischen Dekalog mit hethitischen Vasallenverträgen, um Parallelen in der Struktur antiker Rechtsdokumente aufzuzeigen.
Wie hängen biblische Bünde und mittelalterliche Urkunden zusammen?
Trotz einer Zeitspanne von 1500 Jahren lassen sich formale Parallelen in der Gestaltung von Herrschaftsverträgen und Urkunden feststellen.
Was bedeutet der Begriff 'Bund' (Berit) philologisch?
Die Arbeit untersucht die verschiedenen Bedeutungsnuancen des Begriffs 'Bund' und dessen rituelle sowie rechtliche Verankerung im Alten Testament.
Welche Rolle spielte die deuteronomische Reform?
Die Reform beeinflusste maßgeblich die Vertragsgestalt des Bundes und die rechtliche Beziehung zwischen Gott, König und Volk.
- Quote paper
- Martin Teichmann (Author), 2008, Verträge zwischen Gott, König und Volk im Alten Testament, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159759