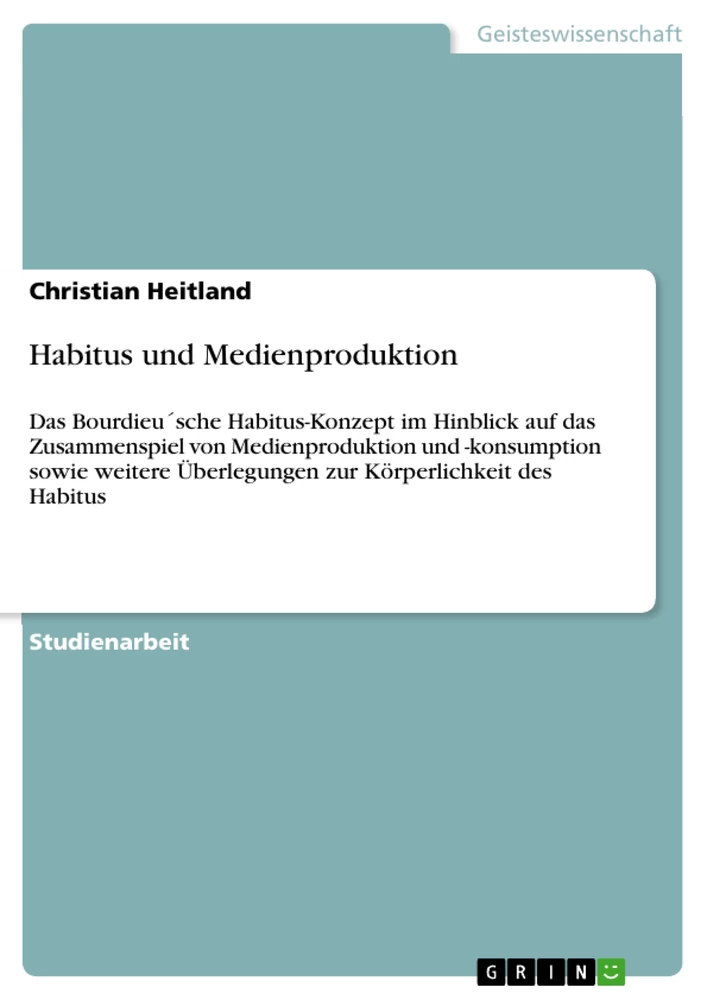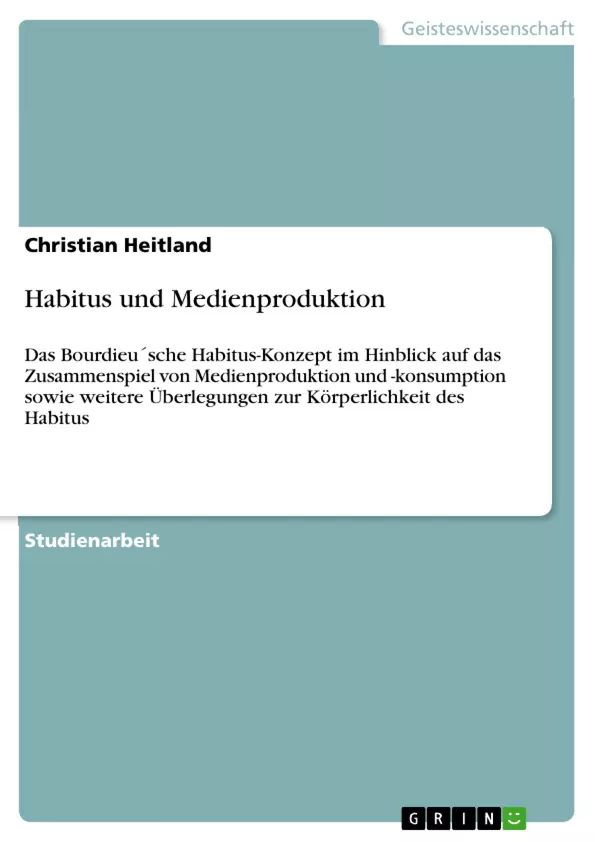Als 1979 Bourdieus La distinction. Critique sociale du jugement (Die feinen Unterschiede.
Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, 1987) erschien, war dies im
Großen und Ganzen ein der Öffentlichkeit präsentierter, empirischer Beleg seiner
Habitus-Theorie, die sich als sein Lebenswerk verstehen lässt. Durch seine ethnologischen
Studien im französisch besetzten Algerien der 50er und 60er Jahre wurde
Bourdieu auf die gesellschaftlichen Unterschiede aufmerksam, die sich in der
sozialen Praxis der Bevölkerungsmitglieder äußerten. So gut wie gar nicht vom
rationalen Geist der westlichen Industrienationen erfasst, schienen die Handlungen
der kabylischen Bauern völlig anderen Regeln zu folgen, wie sie der junge
Franzose von seiner Heimat kannte. Dieses Erlebnis kann wohl als der Zeitpunkt
gelten, in dem aus dem studierten Philosoph auch ein Soziologe wurde. Wieder
zurück in Frankreich folgte Bourdieu nun der Hypothese, dass sich ähnliche Verhaltensunterschiede
nicht nur zwischen Gesellschaften, sondern auch innerhalb
einer Gesellschaft finden müssten, insbesondere, wenn derselben eine ausgeprägte
soziale Hierarchie zugrunde liegt. So fand er denn auch heraus, dass die Besetzung
sozialer Positionen innerhalb der französischen Gesellschaft nicht zufällig ist,
sondern eng mit der Verfügung über bestimmte Kapitalien, maßgeblich ökonomischer
und kultureller Art, zusammenhängt. Diese Kapitalien, über die ein Individuum
vermittels sozialer Beziehungen (soziales Kapital) beispielsweise innerhalb
der Familie verfügen kann, tragen maßgeblich zum schulischen Erfolg und damit
wiederum zur Vermehrung des kulturellen Kapitals bei, welches seinerseits in
Form von Bildungstiteln und Berufsabschlüssen den Zugang zum ökonomischen
Kapital bestimmt. Dies hielten Bourdieu und Passeron 1964 in Les héritiers. Les
étudiants et la culture fest, einer Studie zum französischen Bildungssystem. So gesehen
ist es bei Weitem keine neue Erkenntnis, wenn in Deutschland angesichts
der Ergebnisse der letzten PISA-Studien auf die Korrelation von sozialer Herkunft
und Bildungsweg aufmerksam gemacht und angesichts der „Entdeckung“ eines
abgehängten Prekariats von vererbter Armut gesprochen wird.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Habitus und soziale Ordnung
- Geschmack und Klasse
- Legitimer Geschmack
- Vulgärer Geschmack
- Mittlerer Geschmack
- Klassenlage, Geschmack und Distinktion
- Habitus
- Soziale Felder
- Illusio und Hysteresis
- Körperlichkeit und Habitus
- Habitus-Theorie und Medienproduktion
- Legitimer Geschmack und Herrschaft
- Zusammenspiel von Güterproduktion und Geschmacks-produktion
- Bourdieu über das Fernsehen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu im Kontext von Medienproduktion und -konsumption. Die Arbeit analysiert die Rolle des Habitus bei der Gestaltung und Rezeption von Medienprodukten und untersucht die Relevanz des Bourdieu'schen Konzepts für die Medienlandschaft. Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit die Körperlichkeit des Habitus und die Frage, ob sich die soziale Ordnung auch auf Grundlage naturwissenschaftlicher Erkenntnisse erklären lässt.
- Die Verbindung zwischen Habitus und sozialer Ordnung
- Die Bedeutung von Geschmack und Klasse für die Medienproduktion und -konsumption
- Die Rolle des Habitus in der Konstruktion von sozialen Feldern
- Die Körperlichkeit des Habitus und die Verbindung zu neuronalen Netzwerken
- Die Anwendung der Habitus-Theorie auf Medienproduktionen wie Fernsehen und Journalismus
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Konzept von Geschmack und Klasse in der Bourdieu'schen Theorie. Es werden drei verschiedene Geschmacksdimensionen vorgestellt: der legitime, der mittlere und der populäre Geschmack. Das Kapitel analysiert die Korrelation zwischen Klassenzugehörigkeit und Geschmackspräferenzen und untersucht die Faktoren, die diesen Zusammenhang beeinflussen.
Kapitel zwei beschäftigt sich mit der Anwendung der Habitus-Theorie auf die Medienproduktion. Es wird die Rolle des legitimen Geschmacks in der Reproduktion von Herrschaft und die Verbindung zwischen Güterproduktion und Geschmacksbildung analysiert. Das Kapitel beleuchtet auch Bourdieus eigene Ansichten zum Fernsehen und Journalismus.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe Habitus, Geschmack, Klasse, soziale Ordnung, Medienproduktion, Medienkonsumption, Körperlichkeit, Inkorporierung und neuronale Netzwerke. Die Arbeit untersucht, wie diese Konzepte zusammenhängen und die Interaktion zwischen Individuen und der sozialen Welt prägen. Die Arbeit befasst sich außerdem mit dem Einfluss von sozialen Feldern und der Rolle von Medien in der Reproduktion von Machtstrukturen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Pierre Bourdieu unter dem Begriff "Habitus"?
Der Habitus ist ein System dauerhafter Dispositionen, das durch soziale Herkunft und Erfahrungen geprägt wird und das Denken, Fühlen und Handeln eines Individuums steuert.
Wie hängen Geschmack und soziale Klasse zusammen?
Bourdieu zeigt, dass Geschmackspräferenzen (z.B. legitimer vs. vulgärer Geschmack) eng mit der Verfügung über ökonomisches und kulturelles Kapital verbunden sind.
Was ist "kulturelles Kapital" laut Bourdieu?
Kulturelles Kapital umfasst Bildung, Wissen und kulturelle Güter, die innerhalb der Familie weitergegeben werden und den Schulerfolg sowie den sozialen Status beeinflussen.
Wie beeinflusst der Habitus die Medienproduktion?
Der Habitus der Medienproduzenten bestimmt, welche Inhalte als "wertvoll" oder "massentauglich" angesehen werden und prägt so die Darstellung der sozialen Wirklichkeit.
Was kritisierte Bourdieu am Fernsehen?
In seinem Werk "Über das Fernsehen" kritisierte er die Oberflächlichkeit und die Tendenz des Mediums, bestehende Machtstrukturen eher zu reproduzieren als zu hinterfragen.
- Quote paper
- Christian Heitland (Author), 2006, Habitus und Medienproduktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159798